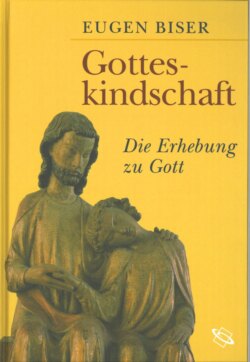Читать книгу Gotteskindschaft - Eugen Biser - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Der Vorbegriff
ОглавлениеIsrael verdankt die Welt das nicht hoch genug zu würdigende Geschenk des monotheistischen Gottesglaubens; das Geschenk eines Gottes, auf den man sich glaubend begründen und den man in der Gewißheit anrufen konnte, daß er als Offenbarer mit sich reden ließ. Denn dieser Glaube brach die Fesseln der natürlichen Kreisläufe, der kosmischen ebenso wie der biologischen, in die der Polytheismus seine Gläubigen eingebunden hatte. So erst entstand der Atem- und Gestaltungsraum, in dem sich der Mensch auf sich selbst zurückbesinnen und das Ergebnis dieser Selbstfindung in seinen Kulturleistungen darstellen konnte33. Grund dieses Durchbruchs war die Erfahrung des befreienden und rettenden Geschichtshandelns Gottes an Israel, wie sie sich, prototypisch, in der Erzählung des Buches Exodus von der Befreiung aus der „ägyptischen Gefangenschaft“ niederschlug (Preuß). Denn Gott hatte nach dem Schlüsselbericht von der Berufung des Mose am brennenden Dornbusch (Ex 3,1– 22) den Aufschrei seines versklavten Volkes gehört und stand im Begriff, ihm den Retter aus seiner Not zu senden34. Auch wenn sich diese Deutung der Geburt des jüdischen Monotheismus aus heutiger Sicht als Rückprojektion nachexilischer Klärungsprozesse darstellt (Loretz), gilt doch auch im Sinne moderner Forschung, daß Israel „mit dem Schritt zur absoluten Einzigkeit Jahwes unter den ,Göttern‘ und Völkern“ den die Bibel bestimmenden altorientalischen Sprach- und Vorstellungsraum verließ und eine ihn transzendierende „neue reflexive Ebene“ gewann35. Inzwischen wurde diese Klärung jedoch durch Jan Assmanns „Mosaische Unterscheidung“, die dem Monotheismus den Einbruch der Intoleranz und Gewalt in die eher friedliche Religiosität der ägyptischen Vorzeit anlastet, in Frage gestellt; nur als Gegenstand einer „unablässigen Reflexion“ und „diskursiven Verflüssigung“ (Habermas) könne sie weiterhin „Grundlage eines Fortschritts in der Menschlichkeit bleiben“. Doch unbeschadet der von Oswald Loretz angestrebten Revision der traditionellen Einschätzung der Ablösung Israels von Ägypten und der von Jan Assmann geübten Fundamentalkritik, bleibt das Zeugnis der Texte, die nun nach ihrer Bezeugung der Gotteskindschaft befragt werden müssen36.
Auch wenn in ihnen nach Rusam nur gelegentlich vom Vatersein Jahwes und der Sohnschaft des Volkes die Rede ist, liegt auf diesen Ausdrücken, schon aufgrund des zwischen beiden bestehenden Wechselverhältnisses, ein besonderer Akzent37. In ihnen artikuliert sich das exzeptionelle Verhältnis, in dem der Bundesgott zu seinem Volk und dieses zu ihm steht. Indem es ihn als Vater anruft, wird es sich seiner Zuwendung und Nähe bewußt. Gleichzeitig weiß es sich in eine Intimbeziehung zu ihm aufgenommen, die ihm das Gefühl seiner Auserwählung verleiht. Grundlegend dafür ist die auch in der Kindheitsgeschichte Jesu (Mt 2,15) zitierte Hoseastelle:
Als Israel noch jung war, gewann ich ihn lieb, und ich rief meinen Sohn aus Ägypten … Ich war es, der Ephraim gehen lehrte. Ich nahm ihn auf meine Arme. Sie aber erkannten nicht, daß ich sie heilen wollte (Hos 11,1– 3).
Erzürnt über die Bosheit des Volkes, das er vergeblich mit „Seilen der Liebe“ an sich zu binden suchte (Hos 1,4), wird der Bundesgott für die Abtrünnigen zum reißenden Löwen (5,14), und er stellt ihnen wie ein Jäger nach (7,12). Doch in dem im Herzen Gottes entbrannten Kampf zwischen Zorn und Liebe siegt diese immer wieder, so daß er mit einem Wort, das an Kühnheit in der ganzen Prophetie beispiellos dasteht (Rad), gestehen muß:
Mein Herz dreht sich um in mir; mein ganzes Erbarmen ist entbrannt. Ich will meinen glühenden Zorn nicht vollstrecken, will Ephraim nicht wieder verderben; denn Gott bin ich und nicht Mensch (Hos 11,8f)38.
Was bei Menschen unmöglich wäre – auf derartige Kränkungen mit noch größerem Erbarmen zu reagieren –, vollzieht sich diesem Wort zufolge in Gott, der dem treulosen Sohn sein glühendes Erbarmen zuwendet. Wie kaum einmal sonst läßt das Alte Testament hier sein ambivalentes Gottesbild (Görg) hinter sich, während an seinem Horizont der Gott aufscheint, der nach der Spitzenaussage der lukanischen Bergpredigt sogar „gegen die Undankbaren und Bösen gütig“ ist (Lk 6,35)39. Im Vorgriff auf diesen Gott konnte sich Israel nun doch als seinen trotz aller Untreue geliebten Sohn wiedererkennen40.
An dieser Stelle übernahm Angelika Strotmann die Fortführung der von Rusam gebotenen Darstellung mit ihrer ungemein kenntnisreichen und sorgfältig analysierenden, wenngleich mit einem Rundumschlag gegen die Mehrzahl der von ihr erfaßten Vorarbeiten einsetzenden Studie über die Bedeutung der Vaterschaft Gottes in den frühjüdischen Schriften41. Hauptziel ihrer Kritik ist Joachim Jeremias mit seinem Versuch, die Abba-Anrede Jesu als innovative Gottesanrufung und als das „Herzstück seines Gottesverhältnisses“ zu erweisen“42. Wenn sie aber mit anderen Kritikern wie insbesondere mit Feneberg aus den Äußerungen des Angegriffenen einen „impliziten Antijudaismus“ – eine nur allzu gängige Invektive – heraushört, gleitet ihre Kritik in ebenso unbegründete wie ungerechte Polemik ab. Daher dann auch ihre Ablehnung der These, daß in der alttestamentlichen Gottesanrufung „der Geist des wahren Vaterglaubens“ noch fehle (Schrenk). Unberührt davon ist das auf der Basis der von ihr untersuchten frühjüdischen Schriften eingebrachte Ergebnis, das hauptsächlich in einer Korrektur der bisherigen Annahme besteht, wonach die Vaterschaft Gottes hauptsächlich durch die Konnotation der „Gehorsam verlangenden Autorität“ gekennzeichnet ist. Dominierendes Moment ist ihr zufolge vielmehr Gottes Liebe, Barmherzigkeit und Güte, die er selbst seinem untreu gewordenen „Sohn“ Israel gegenüber wahrt. Auch wenn sich diese im angesprochenen Fall in Strenge und Strafgerechtigkeit äußere, bleibe sie doch auch darin ihrem affirmativen Grundcharakter treu43.
Eindrucksvollste Bestätigung dieses Ergebnisses ist die vom Propheten Hosea vorweggenommene (Hos 11,1– 4) und von Ezechiel dramatisch beschriebene Liebesgeschichte Jahwes mit Israel, das er als ein in seinem Blut zappelndes Findelkind in der Wüste aufliest, umkleidet und aufzieht, um sich dann der zur Jungfrau erblühten und von ihm mit kostbarem Geschmeide Geschmückten anzuverloben (Ez 16,2 –14). Angesichts des von ihr begangenen Treuebruchs und ihrer Prostitution, die der von ihr enttäuschte Bundesgott mit schrecklichen Strafgerichten vergilt (16,15 – 43), muß dieses Drama freilich zusammengesehen werden mit dem bereits mitgeteilten Geständnis Gottes, daß es ihm angesichts der Treulosigkeit Israels das Herz umdrehe und er seinen glühenden Zorn unterdrücke, und dies mit der in der Geschichte der göttlichen Selbstzeugnisse einzigartig dastehenden Begründung: „denn ich bin Gott und nicht ein Mensch“ (Hos 11,8f)44.
Auffällig ist an dieser Darstellung der Vaterschaft Gottes die nur schwach betonte Rückbezüglichkeit des Motivs. Zwar gewinnen die Kinder Gottes nach Strotmann Anteil an Gottes „Macht, Herrlichkeit und Erkenntnis“, wenngleich immer nur als „Einzelpersonen“45. Doch erhebt sich keiner von ihnen zum Vollbewußtsein oder gar zur Artikulation der ihm dadurch zugeeigneten Würde. Da sich davon der christliche Begriff der Gotteskindschaft signifikant unterscheidet, drängt sich der Rückschluß auf, daß die Vaterschaft Gottes in den alttestamentlichen Schriften nicht jenes Profil erreicht, das den von Gott in ein Kindesverhältnis Aufgenommenen über seinen kreatürlichen Status hinaushebt. Nicht umsonst wird die Vaterschaft Gottes vielfach mit seinem Schöpfertum zusammengesehen, wenn nicht geradezu gleichgesetzt. Bezeichnend ist dafür auch die Beobachtung, daß das Motiv der Gotteskindschaft erst im Buch der Weisheit mit einem Sendungsbewußtsein einhergeht und daß von „Wiedergeburt“ nur in den Mysterienreligionen die Rede ist46. Daran ändert auch die Feststellung nichts, daß das Motiv in den Qumranschriften eng mit dem Erwählungsgedanken verknüpft ist47. Ungeachtet dessen hat aber das Motiv der Vaterschaft Gottes, zusammen mit dem der Gotteskindschaft, in den alttestamentlichen Zeugnissen eine von deren Vorkommen in der antiken Literatur signifikant verschiedene Qualität. Trotz allen Gleichklangs ist die Vaterschaft Gottes im jüdischen Glauben ein Derivat der Entdeckung der Transzendenz und Personalität Gottes, mit der das Judentum die entscheidende Innovation im Gottesverständnis herbeiführte. In den alttestamentlichen Aussagen gewinnt die Vaterschaft Gottes somit die dem antiken Denken unerreichbare Qualität einer Personalbezeichnung, die sich unmittelbar auch auf das sich daraus ergebende Kindsein Israels niederschlägt. Wie aber verhält sich dazu die christliche Konzeption dieser Motive?