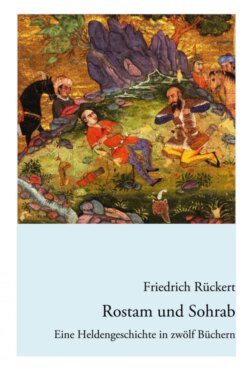Читать книгу Rostam und Sohrab - Friedrich Ruckert - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеVorwort
1838 veröffentlichte Friedrich Rückert, seit 1826 Professor für Orientalische Sprachen der Universität Erlangen, im Verlag Theodor Bläsing Rostem und Suhrab - Eine Heldengeschichte in zwölf Büchern. Mit den einleitenden Worten „Lass aus dem Königsbuch der Perser dir berichten …“ verweist er in der ersten Zeile auf das Schahname, das iranische Nationalepos, aus dem die Geschichte von Rostam und Sohrab, wie wir die beiden Helden heute nennen, stammt. Das Schahname, das Buch der Könige, gilt mit mehr als 50.000 Versen als das umfangreichste Epos der Welt. Es ist das Lebenswerk des Dichters Ferdausi, der 940 in Tus im Iran geboren wurde und dort 1020 hochbetagt verstarb.
Rückert arbeitete Zeit seines Lebens an der Übersetzung des Schahname, konnte die Arbeit aber nicht zu Ende bringen. Bei seinem Tod am 31. Januar 1866 war bis auf Rostem und Suhrab, das inzwischen bei S.G.Liesching in einer zweiten, leicht überarbeiteten Auflage erschienen war, kein weiterer Teil aus dem „Königsbuch der Perser“ veröffentlich worden. Es sollte bis 1890 dauern, bis Edmund Bayer den ersten Band der Rückertschen Übersetzung unter dem Titel Firdosi’s Königsbuch (Schahname) bei Georg Reimer in Berlin aus dem Nachlass Rückerts herausbrachte. Der erste Band enthält die Sagen I bis XIII und endet genau an der Stelle, an der die Geschichte von Rostam und Sohrab beginnt. Der zweite, 1894 erschienene Band beginnt mit Sage XV und endet mit Sage XIX. Die Geschichte von Rostam und Sohrab, in dieser Zählung Sage XIV, fehlt, da sie sich, wie Edmund Bayer in der Einleitung vermerkte, „trotz intensiver Suche nicht habe auffinden lassen“. Mit dem dritten, 1895 erschienen Band, der die Sagen XX bis XXVI enthält, endet die Übersetzung des Schahname von Rückert nach ungefähr 25.000 Versen.
Rostam und Sohrab ist, anders als die nahezu wortgetreue Übersetzung des Schahname, eine freie Nachdichtung. Rückert gliederte den Text in zwölf Bücher. Rückert benutzte keine Paginierung sondern eine Foliierung, bei der nicht die Seiten sondern die Blätter (Folio) eines Buches gezählt werden.
Der Text unserer Ausgabe von Rostam und Sohrab folgt der Erstausgabe, übernimmt aber nicht die Orthographie sondern passt den Text an die heutige Rechtschreibung an. In einem Glossar werden zudem die heute nicht mehr gebräuchlichen Ausdrücke erläutert. Ein Verzeichnis der mythologischen Namen gibt Auskunft über Personen und Orte. Wie bereits Edmund Bayer in dem von ihm herausgegeben ersten Band des Schahname in der Einleitung vermerkt, schrieb Rückert die Eigennamen auf verschiedene Weise, so Sijamek und Siamek, Gajumarth und Gajomarth, Tamuhrat und Thamurath, Bizhen und Bischen, Ersheng und Erscheng oder Erzhengm Naudher und Nudher, Ka’us und Kaus oder Kawus, Chosro und Chosrow oder Chosru, usw. Diese Nachlässigkeiten mochten ihren Grund darin haben, dass Rückert, wie er selbst im poetischen Tagebuch von 1850-1866 bekannte, nicht nachschlug, was er früher geschrieben hatte. In der vorliegenden Ausgabe wurde die Schreibweise der Eigennamen Rückerts nicht übernommen sondern der heute üblichen Schreibweise angepasst. Das Problem, dass bei der Transkription iranischer Schriftzeichen in lateinische Buchstaben sich die Lautwerte der beiden Schriften nicht immer deckungsgenau übertragen lassen, bleibt naturgemäß bestehen. Auf die in wissenschaftlichen Veröffentlichungen verwendeten diakritischen Zeichen zur genaueren Bezeichnung der einzelnen Laute wurde in der vorliegenden Ausgabe weitestgehend verzichtet, um dem Leser die Lektüre zu erleichtern.
Mein besonderer Dank für seine tatkräftige Unterstützung gilt dem Geschäftsführer der Rückert-Gesellschaft Herrn Dr. Rudolf Kreutner.
Wolfgang von Keitz