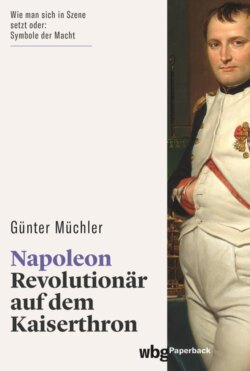Читать книгу Napoleon - Günter Müchler - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Vulkan bricht aus
ОглавлениеWährend der Unterleutnant Bonaparte mit Kanonen hantiert und von Heldentaten träumt, melden sich in Frankreich die Vorboten eines politischen Erdbebens. Das Land steckt in einer Wirtschaftskrise, gegen die die Regierung kein Mittel findet, weil der Staat am Rande des Bankrotts steht. Unruhen brechen aus, sie greifen bald auf weite Teile des Landes über. Hier richtet sich der Protest gegen hohen Steuern, dort gegen hohe Lebensmittelpreise. In Rennes werden im Januar 1789 Adlige von Studenten tätlich angegriffen. In Paris randalieren Arbeiter gegen Fabrikbesitzer, die die Löhne drücken wollen. In Marseille wendet sich der Volkszorn gegen das Militär, ein hoher Offizier wird erschossen. Besonders angespannt ist die Situation auf dem Land. Die Getreidebauern haben zehn Jahre lang ihren Weizen zu Niedrigstpreisen verkaufen müssen. 1788 schießen die Preise infolge einer Missernte zwar in die Höhe, aber das nimmt den Bauern nicht die Zukunftsangst, und die Städter haben einen weiteren Grund, mit den Verhältnissen zu hadern. Die Industrialisierung wirft ihre Schatten voraus. Der Übergang zur industriellen Produktion ist schwierig. Die junge französische Textilindustrie kann mit der englischen Konkurrenz, die seit dem britisch-französischen Friedensschluss von 1786 ihre Waren ungehindert in Frankreich absetzen kann, nicht Schritt halten. Arbeitslosigkeit ist die Folge. In der Seidenstadt Lyon muss die Hälfte aller Betriebe schließen. Die explosive Lage reflektiert nicht unbedingt die ökonomischen Fakten. Lange hat man die Steuerlast als Hauptgrund dafür angesehen, dass die Revolution ausgerechnet in Frankreich ausbricht. Sie liegt in England aber deutlich höher.64 Zum Vulkanausbruch müsste es also nicht unbedingt kommen. Mitverantwortlich sind die wechselnden königlichen Regierungen, die nicht den Eindruck vermitteln, als wüssten sie einen Ausweg aus der Krise. Ihre Hilflosigkeit verstärkt die durch diffuse Ängste hochgeputschte Untergangsstimmung, die sich jederzeit unkontrolliert entladen kann.
Im April wird Napoleon mit seiner Kompanie nach Seurre geschickt. In dem 20 Meilen südlich von Auxonne gelegenen Ort ist es zu Tumulten gekommen. Als Vizekommandierender seiner Einheit macht er seine Sache so gut, dass ihn General du Theil belobigt. Mit den Worten „Die anständigen Leute können nach Hause gehen; ich schieße nur auf die Canaille“, soll er den Aufruhr beendet haben.65 Doch lokale Löscherfolge können den Flächenbrand nicht mehr verhindern. Ein Vierteljahr später wird in Paris mit der Erstürmung des Stadtgefängnisses ein neues Kapitel der Weltgeschichte aufgeschlagen. Am 19. Juli, fünf Tage nach dem Fall der Bastille, ist Napoleon Zeuge, wie in Auxonne das Finanzamt besetzt wird. Die Unruhen machen auch vor der Garnison nicht halt. Soldaten bemächtigen sich der Regimentskasse. Meutereien brechen aus; niemand will mehr gehorchen. Napoleon ist weit davon entfernt, die Dimension des Geschehens zu erfassen. „Ich wiederhole, was ich dir schon gesagt habe“, schreibt er Joseph abwiegelnd, „die Ruhe wird wieder einkehren. In einem Monat wird man von alledem nicht mehr reden.“66 Am 9. August schickt er Joseph einen neuen Lagebericht: „Man beschäftigt sich sehr mit der Verfassung, kommt aber nur langsam voran. Sie [die Mitglieder der Nationalversammlung, GM] schwatzen zu viel.“67 Der junge Offizier hält das Weltereignis für eine Tageslaune. Seine Gedanken sind woanders. Er schreibt an der Geschichte Korsikas. Außerdem will er endlich die Finanzen der Familie in Ordnung bringen. Er beantragt Urlaub und ist im September 1789 wieder in Ajaccio.
Seit der Verbannung Paolis fehlt den Autonomisten auf der „Insel der Schönheit“ der Kopf. Es herrscht wieder korsischer Normalzustand, das heißt, rivalisierende Clans bestimmen das Bild. Die einen kollaborieren mit den Franzosen, die anderen frondieren gegen die Fremdherrschaft. Durch die Umwälzung auf dem Festland ist ein neues Element hinzugetreten, das die gewohnte Demarkationslinie überlagert und verwirrt. Die Frage lautet nicht mehr nur, für oder gegen Frankreich, sondern für oder gegen den König. Bald ist Korsika eine Nebenspielstätte des großen Revolutionstheaters und ähnlich möbliert wie die Hauptbühne. Politische Klubs werden gegründet, Milizen machen dem regulären Militär Konkurrenz, die königlichen Behörden geraten unter Beschuss, Kirche und Klöster zitterten um ihren Besitz. Oft ist das revolutionäre Bekenntnis nur Taktik. Die alten Autonomisten sehen im universellen Freiheitsversprechen eine Abkürzung ihres Weges. Sie glauben, die Revolution könne gar nicht anders, als Korsika die Unabhängigkeit zu schenken. Das ist allerdings ein Irrtum.
Napoleon stürzt sich sofort ins Getümmel. Er lässt von Anfang an keinen Zweifel daran, auf welcher Seite er steht. Wie er engagieren sich auch Joseph und Lucien für die politische Linke. Joseph sitzt im Stadtrat von Ajaccio. Eine Weile erwägt er, sich Scaevola zu nennen, nach einem tapferen Römer, der lieber seine Hand verbrennen ließ, als die Namen seiner Mitverschwörer preiszugeben.68 Besonders radikal tritt der 16-jährige Lucien auf. Sein republikanischer Kampfname lautet Brutus. Die drei Brüder frequentieren den eng mit den Jakobinern liierten Patriotischen Klub von Ajaccio. Am Stadthaus der Familie prangt auf einer Banderole: Evviva la Nazione! Evviva Paoli! Evviva Mirabeau! In Napoleons Ruhmeshalle sitzen der babbù und der Feuerkopf Mirabeau gemeinsam in der ersten Reihe. Nach der familiären Arbeitsteilung soll sich der Älteste auf den politischen Karriereweg konzentrieren, der Zweitälteste auf die neue Nationalgarde. Napoleon vertraut darauf, dass ihm als „erfahrenem“ Offizier in dieser nach französischem Muster geschaffenen Bürgerwehr die Führungsposition automatisch zufallen werde. Das Verbot der Nationalgarde durch den Gouverneur entmutigt ihn nicht. Als die örtlichen Jakobiner ihn einladen, eine Botschaft an die Pariser Nationalversammlung zu verfassen, nimmt er dankbar an. In dem pathetisch formulierten Text behauptet er kühn, Korsika habe in den 20 Jahren unter der Krone Frankreichs keinen einzigen guten Tag erlebt. Stets sei der Freiheitswille des Volkes durch die königliche Verwaltung geknebelt worden. „Erst die glückliche Revolution, die dem Menschen das Recht zurückgegeben hat, hat uns wieder Mut gemacht.“ Der Appell schließt mit der flammenden Aufforderung: „Kümmert Euch um uns, sonst sind wir verloren!“69
Der Napoleon der korsischen Revolutionswirren hat viele Gesichter. Was ist er nun? Korse oder Franzose? Soldat oder Politiker? Offizier des Königs oder Jakobiner? In erstaunlicher Weise ignoriert er die Widersprüche. Er führt kernige Reden gegen die Monarchie und kassiert ungeniert den Sold des Königs. Er agiert als Freischärler, ohne seine Offizierscharge in der regulären Armee aufzugeben. Er verschreibt sich Korsika mit Haut und Haaren und verliert nicht einen Moment die Vorteile aus den Augen, die ihm sein Franzose-Sein beschert. In der Phase von 1786 bis 1793 pendelt er viermal zwischen dem Kontinent und Korsika hin und her. Die Vergleichsrechnung macht deutlich, wo seine Priorität liegt: Ganze zwei Jahre und neun Monate verbringt er bei der Armee, fünf Jahre und neun Monate in der Heimat.70 Was ihn immer wieder nach Korsika treibt, ist der Ehrgeiz. Die Bonapartes sollen zur ersten Familie auf der Insel werden, natürlich mit ihm an der Spitze. Um dieses Ziel zu erreichen, tanzt er auf vielen Hochzeiten.
Im Januar 1791 – erneut hat er seinen Urlaub überzogen – kehrt er widerwillig nach Frankreich zurück und findet die Armee im Zustand fortgeschrittener Auflösung vor. Zahlreiche königstreue Offiziere haben sich ins Ausland abgesetzt, die meisten nach Deutschland. Für Napoleon steht der Absprung nicht zur Debatte. Er hegt keinerlei Sympathie für die Monarchie. Als ihn eines Tages Kameraden bedrängen, sich zum König zu bekennen, kommt es zum Streit. Um ein Haar hätten ihn die Royalisten in die Saône geworfen. Nicht ungern kehrt Napoleon Auxonne den Rücken. Zum Leutnant befördert und mit einem um 200 Livres erhöhten Jahressold ausgestattet, ist er im Juni zurück in Valence. Auch hier macht er aus seiner politischen Präferenz keinen Hehl. Im örtlichen Klub der Verfassungsfreunde fungiert er als Sekretär. „Seit langem habe ich Geschmack an den öffentlichen Angelegenheiten.“ Der Satz steht zuoberst in einem Aufsatz, in dem er sich kämpferisch mit der These auseinandersetzt, eine Republik tauge vielleicht für Zwergstaaten, nicht aber für ein Land von der Größe Frankreichs. „Wenn man behauptet, dass 25 Millionen Menschen nicht als Republikaner leben könnten, so ist das weiter nichts als eine unpolitische Redensart.“71 Das Bekenntnis zur republikanischen Staatsform ist zu diesem Zeitpunkt alles andere als selbstverständlich. Noch gibt es den König, und nach der Verfassung von 1791 versteht sich Frankreich als konstitutionelle Monarchie. Auf sie leistet Napoleon den Eid. Er schwört, „die von der Nationalversammlung dekretierte Verfassung gegen alle inneren und äußeren Feinde aufrecht [zu] erhalten, lieber [zu] sterben als die Invasion fremder Truppen [zu] dulden und nur denjenigen Befehlen gehorchen zu wollen, die im Vollzug der Dekrete der Nationalversammlung gegeben werden“.72 Die Erklärung datiert vom 7. Juli, unterzeichnet ist sie mit „Buonaparte, Offizier im 4. Artillerie-Regiment“. Das „de“ unterschlägt er. Sich als Adliger zu bekennen, käme bei seinen patriotischen Freunden nicht gut an.