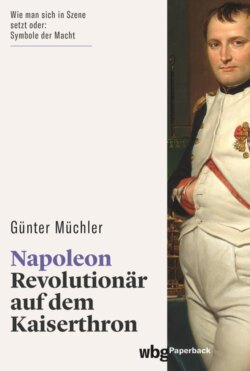Читать книгу Napoleon - Günter Müchler - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеNeben dem Garnisonsdienst, der Arbeit im Klub der Verfassungsfreunde und der Unterrichtung des kleinen Bruders Louis betreibt Napoleon weiter seine Schriftstellerei. Im Dialog über die Liebe, einem fiktiven Streitgespräch mit seinem Freund de Mazis, verficht er den Standpunkt, die Liebe sei schädlich für die Gesellschaft und für das Glück des Einzelnen. „Ich glaube, dass sie mehr Übles als Gutes verursacht, und hielte es für eine Wohltat, wenn die Gottheit uns und die Welt davon befreien wollte.“73 Ob die Feder sich sträubt, als er diese Sätze niederschreibt? Hier äußert sich ja kein abgeklärter Greis, sondern ein junger Mann, den es vor einiger Zeit noch unwiderstehlich ins Rotlichtviertel gezogen hat. Wahrscheinlich opfert Napoleon mit dem mönchischen Abgesang auf die Fleischeslust dem neuen Zeitgeist. Wer ein wahrer Patriot sein will, der huldigt, jedenfalls in Worten, dem republikanischen Tugendideal. Verdorbenheit gilt als Attribut des Ancien Régime, Sittenstrenge ist die Standarte der neuen Zeit. Nicht zufällig fallen dem Blutrausch der Septembermorde viele Prostituierte zum Opfer. Dem Zeitgeist verpflichtet zeigt sich Napoleon auch bei einem Beitrag, den er zum Preiswettbewerb der Akademie von Lyon einreicht. Die Preisfrage lautet: Welche Wahrheiten und welche Gefühle sind den Menschen für ihr Glück am meisten einzuprägen? Er gibt sich als Republikaner zu erkennen und singt das Hohelied vom Freiheitskämpfer Paoli. Was die „Wahrheiten und Gefühle“ angeht, benutzt er Rousseau und den Abbé Raynal als Stichwortgeber. Der Essay ist schwülstig und verworren. Die Juroren senken zu Recht den Daumen. Die Handschrift, in der das Manuskript ausgefertigt ist, finden sie außerdem eine Zumutung,74 und so muss Napoleon die ausgelobten 1200 Livres in den Wind schreiben. Als ihm etliche Jahre später Außenminister Talleyrand eine Kopie des Essays überreicht, wirft er die Blätter ins Feuer. An Niederlagen erinnert er sich ungern.
In Valence erfährt Napoleon, dass die Volksvertretung in Paris mit Rücksicht auf die Kriegsgefahr beschlossen hat, besoldete Freiwilligenbataillone aufzustellen, auch in Korsika. An der Spitze eines jeden Bataillons sollen zwei von ihren Untergebenen gewählte Oberstleutnants stehen. Napoleon ist Feuer und Flamme. Wenn es ihm gelingt, gewählt zu werden, kann er im korsischen Durcheinander eine Macht sein, ohne seinen Rang in der regulären Armee zu riskieren. Als er im Oktober auf der Insel eintrifft, ist eine Menge passiert. Erstens hat Frankreich per Parlamentsbeschluss Korsika in aller Form annektiert; die Insel wird in zwei Départements unterteilt. Zweitens ist Paoli aus dem Londoner Exil zurückgekehrt. Bei einem rauschenden Empfang in Paris hat er vor der Assemblée Nationale die Verfassung beschworen. Der babbù betreibt ein Doppelspiel. Nach außen gibt er sich als loyaler Untertan Frankreichs, in Wirklichkeit verliert er sein Ziel, Korsika in die Unabhängigkeit zu führen, nicht aus den Augen.
Es ist unklar, ob Napoleon das Doppelspiel von Anfang an durchschaut. Paoli bleibt seine Leitfigur. An der Seite des Meisters will er die Erfolgsleiter erklimmen. Paoli ist noch in London, da dient Napoleon sich ihm brieflich als korsischer Nationalist an. „General, ich bin geboren, als das Vaterland unterging. 30 000 Franzosen, an unseren Küsten ausgespien, hatten den Thron der Freiheit in Fluten von Blut ertränkt. Dieses hassenswerte Schauspiel war mein erster Anblick“, beginnt sein Schreiben.75 Paoli hält es für unnötig, auf diesen Erguss zu antworten. Ungeachtet der Enttäuschung bemüht sich Napoleon weiter, die Aufmerksamkeit seines Idols auf sich zu lenken. Jener Brief an Buttafoco, den er in Dôle hat drucken lassen und in dem er Matteo Buttafoco, den konservativen Abgeordneten in der französischen Nationalversammlung, als Verräter an der Sache Korsikas hinstellt, ist nichts anderes als ein Bewerbungsschreiben. Doch er erntet nur den Tadel Paolis, der die gegen Buttafoco erhobenen Vorwürfe übertrieben und ungerecht findet.76 Warum lässt der babbù den jungen Mann, der unermüdlich um seine Gunst buhlt, derart abblitzen? Er hat wohl nicht vergessen, dass sich Charles Bonaparte nach der verlorenen Schlacht von Ponte Novo aus dem Staub machte. Vielleicht ist der Opportunismus des Vaters erblich? Auch ein anderer Grund lässt ihn Distanz wahren. Die Bonaparte-Söhne gerieren sich überehrgeizig und vorlaut, und das missfällt dem erfahrenen Politiker. Paoli ist übrigens nicht der Einzige, den Napoleons Umtriebigkeit beunruhig. La Féraudière, der Stadtkommandant von Ajaccio, drängt schon Ende 1789 das Pariser Kriegsministerium, ihn von dem Störenfried zu befreien: „Dieser junge Offizier (…) wäre besser bei seinem Regiment aufgehoben, denn hier sorgt er ohne Unterlass für Unruhe.“77 So sieht das auch Paoli. Es kann nicht schaden, den jungen Wilden Mores zu lehren. Als Napoleon höflich darum bittet, ihm für seine Geschichte Korsikas Dokumente zur Verfügung zu stellen, kanzelt er ihn ab: „Geschichte schreibt sich nicht in so jungen Jahren.“78
In der Folge kühlt das Verhältnis zwischen Paoli und den Bonapartes spürbar ab. Paoli begünstigt den konservativen Pozzo di Borgo, den er für besonnener hält, und sorgt dafür, dass Joseph, der sich um ein Mandat in der Assemblée bewirbt, durchfällt. Er kann jedoch nicht verhindern, dass Napoleon zum Kommandanten eines der beiden Freiwilligenbataillone gewählt wird. Bei der Wahl wird kräftig geschmiert, das Geld ist geerbt vom inzwischen verstorbenen Onkel Lucien, dem Erzdiakon. Wahlbeeinflussung mit und ohne Geld ist nichts Ungewöhnliches, Napoleon treibt es allerdings besonders stark. Er schreckt noch nicht einmal davor zurück, einen der Wahlkommissare entführen zu lassen. Seinen ersten Staatsstreich nennt das der Napoleon-Biograf August Fournier.79 Offen ist, was mit der Truppe geschehen soll. Eigentlich sind die Freiwilligenbataillone als Reservearmee für den Fall gedacht, dass die Monarchien Europas über das revolutionäre Frankreich herfallen. Dafür sind sie geschaffen worden. Aber erstens herrscht noch Frieden, und zweitens ist es äußerst unwahrscheinlich, dass Frankreich, sollte es zum Krieg kommen, seine Unabhängigkeit ausgerechnet in Korsika verteidigen muss. Indessen eignen sich die Bataillone bestens für den Bürgerkrieg oder für andere Unternehmungen, die der französischen Zentralmacht nicht recht sein können. Das hat auch Paoli erkannt. Paoli beabsichtigt, die Franzosen Schritt für Schritt aus allen wichtigen Positionen auf der Insel zu verdrängen. In den Departementsbehörden sollen nur noch Landeskinder tätig sein. Ein Dorn im Auge ist die reguläre Armee, die die Befestigungsanlagen der Städte in der Hand hat. Die Aneignung der Zitadelle von Ajaccio fällt in das Ressort des Freiwilligen-Kommandeurs Bonaparte. Napoleon ist sofort bereit. Natürlich kollidiert der Plan mit dem Verfassungseid, den er genauso wie Paoli geleistet hat. Aber das beschwert weder den einen noch den anderen.
Unter Napoleons Freiwilligen ist es mit den Tugendidealen nicht weit her. Das Gesindel überwiegt und führt sich in einer Weise auf, dass sich die Bürger von Ajaccio schon bald hilfesuchend an die Ordnungsmacht wenden. Die Atmosphäre in der Stadt ist gereizt. Für böses Blut sorgt besonders der nun auch in Korsika einsetzende Kirchenkampf. Napoleon gießt Öl ins Feuer. Er lässt das von seinen Patres verlassene örtliche Kapuzinerkloster besetzen, obwohl gerade erst eine Abordnung der Bürgerschaft um die Wiederherstellung der beliebten Ordenseinrichtung gebeten hat. Als er von der Munizipalbehörde aufgefordert wird, seine Männer aus der Stadt abzuziehen, stellt er sich taub. An den Ostertagen 1792 brechen Straßenkämpfe aus. Die Soldateska plündert und schießt auf harmlose Kirchgänger, ohne dass der Bataillonschef einschreitet. Stattdessen verlangt Napoleon vom Kommandanten der Zitadelle die Übergabe. Da dieser sich weigert und eine direkte Konfrontation ausscheidet, endet die Operation als Fiasko. Der Bataillonschef hat nichts erreicht und sich in seiner Heimatstadt viele Sympathien verscherzt. Obendrein wäscht Paoli, der ihn angestiftet hat, seine Hände in Unschuld, sodass die Schuld an den Osterunruhen allein Napoleon angelastet wird. Eilends macht er sich auf den Weg nach Paris, um einer drohenden Anklage entgegenzuwirken.
Als er am 20. Mai in der Hauptstadt eintrifft, erkennt er sie kaum wieder. Das Ancien Régime liegt in Agonie. Ludwig XVI. ist von seinen Herrschaftsrechten gerade noch das aufschiebende Veto gegen Parlamentsbeschlüsse geblieben. Im Tuilerienschloss, in das man ihn gesperrt hat, zittert er vor der Unberechenbarkeit seines Volkes. Mit Ludwigs Unterschrift hat Frankreich am 20. April dem „König von Ungarn und Böhmen“ den Krieg erklärt. Damit ist Kaiser Franz gemeint, ein Neffe der Königin Marie Antoinette, die die Internierung Ludwigs in den Tuilerien teilt. Den Krieg wollen Royalisten und Revolutionäre, allerdings mit gegensätzlichen Hintergedanken. Die Royalisten setzen auf Baisse. Sie drücken heimlich dem „König von Ungarn und Böhmen“ die Daumen, der, wie sie glauben, nach dem erwarteten militärischen Erfolg dem revolutionären „Spuk“ in Paris ein Ende bereiten werde. Dagegen verspricht sich die linke Mehrheit in der Nationalversammlung von einem Sieg über die Konterrevolution den Rückenwind, den sie braucht, um der Monarchie den Todesstoß zu versetzen.
Bisher hat Napoleon von der Revolution nur einen schwachen Lufthauch verspürt. Jetzt erlebt er ihre Urgewalt. Am 20. Juni beobachtet er vom Seine-Ufer aus zusammen mit Bourienne, dem Schulkameraden aus Brienne, den er zufällig getroffen hat, wie eine mit Piken und Stöcken bewaffnete Menge in die Tuilerien eindringt und den fassungslosen König zwingt, sich auf dem Balkon dem Volk zu zeigen. Napoleon schildert die Begebenheit: „Sie durchbrachen die Absperrungen, drangen in den Palast ein, richteten eine Kanone auf des Königs Appartement, rissen vier Türen ein und hielten dem König zwei Kokarden vor, eine weiße und eine dreifarbige.* Dann sollte er wählen. Wähle, riefen sie, ob du hier oder in Koblenz regieren willst.** Der König zeigte sich der Menge. Er setzte sich eine rote Mütze auf, dasselbe taten die Königin und der königliche Prinz. Sie gaben dem König zu trinken und hielten sich stundenlang im Schloss auf. (…) Natürlich ist das alles verfassungswidrig und schafft ein gefährliches Beispiel. Es lässt sich nur schwer vorhersagen, was unter solch stürmischen Umständen aus dem Land werden wird.“80 Für den Terror im Schloss ist das Wort „verfassungswidrig“ reichlich beschönigend. Deutlicher lässt sich Napoleon gegenüber Bourienne aus: „Wie konnte man nur dem Pöbel freie Bahn lassen? Warum hat man nicht vier oder fünfhundert von ihnen mit der Kanone weggefegt?“81 Für Napoleon ist der König ein Feigling. Er hat sich nicht gewehrt, er hat sich demütigen lassen und trägt damit die Verantwortung für alles Weitere. Bei diesem Urteil über Ludwig XVI. bleibt es.
Knapp zwei Monate später, am 10. August, wird Napoleon Zeuge einer weiteren Eskalation der Gewalt. Nach Anfangserfolgen haben die französischen Armeen Rückschläge erlitten. Es droht die Invasion der verbündeten Österreicher und Preußen. Ein Manifest des Herzogs von Braunschweig, des alliierten Oberbefehlshabers, schürt die Angst. Es stellt die Zerstörung von Paris in Aussicht, falls die Bevölkerung sich ihrem König nicht unterwerfe. Die Revolutionsfreunde nutzen die ungeschickte Drohgebärde, indem sie eine Verschwörungstheorie in Umlauf bringen. Noch gefährlicher als der Feind an der Grenze sei der innere Feind. Er wühle im Königsschloss, im Herzen von Paris! Die Angstspirale dreht sich. Mit jedem Tag verliert die Nationalversammlung ein Stück mehr Autorität an die Straße beziehungsweise an die Stadtverwaltung, in der anarchistische Elemente den Ton angeben. Am 10. August ziehen Volkshaufen aus den Arbeitervorstädten Richtung Tuilerien. Aufgeschreckt durch den Lärm der Sturmglocke, verlässt Napoleon sein Hotel. „Ehe ich an die Place du Carrousel gelangt war, hatte ich in der rue des Petits-Champs eine Horde abscheulicher Menschen getroffen, die einen aufgespießten Kopf vor sich hertrugen. Als sie mich sahen – ich war ordentlich gekleidet und wirkte wie ein Herr –, kamen sie auf mich zu und zwangen mich, ‚Vive la Nation!‘ auszurufen, was ich kaum über die Lippen brachte, wie man sich denken kann.“82 Schließlich erreicht er das Haus des Möbelhändlers Fauvelet, der ein Bruder von Bourrienne ist. Es liegt an der Place du Carrousel, von wo aus man einen guten Blick auf das Schloss hat. Anders als am 20. Juni macht der Pöbel diesmal keine halben Sachen. Die Tuilerien werden gestürmt, das Mobiliar wird zerschlagen. Ludwig XVI. rettet sich in die Arme der Assemblée, die beinahe so hilflos ist wie er selbst. Aus sicherer Entfernung verfolgt Napoleon, wie die Schweizer Garde, die Schutztruppe des Königs, gnadenlos niedergemetzelt wird. Auf keinem Schlachtfeld habe er so viele menschliche Kadaver auf einem Haufen gesehen, erzählt er später. Was ihn erschüttert, ist die Hemmungslosigkeit, die sich an den im Stich gelassenen Beschützern des Königs austobt. „Ich habe gut gekleidete Frauen gesehen, die sich zu unaussprechlichen Unanständigkeiten an den toten Schweizern hergegeben haben.“83 Frauen fallen während der Revolution durch besondere Brutalität auf. So beobachtet der deutsche Reisende Friedrich Schulz 1789 das Verhalten der Poissarden (Marktfrauen): „Der Anblick des Blutes schien sie wie gewisse reißende Thiere rasend zu machen und sie bemächtigten sich der Rümpfe der Hingerichteten, und schleppten sie mit großichem Geschrey durch die Straßen, während ihre Freunde die Köpfe auf Piken durch die Stadt trugen.“84
Es kommt noch schlimmer. Mit den „Septembermorden“* erreicht die Brutalisierung einen neuen Spitzenwert. Jetzt knöpft sich der Mob die Gefängnisse vor. Am Anfang lässt die Wahl der Opfer noch ein gewisses System erkennen. Man erschlägt, ersticht oder erdrosselt zunächst Priester, Nonnen und Mönche, dann diejenigen, die wie Aristokraten aussehen. „Das Wort ‚der Herr mit der zarten Haut‘ war schon ein Todesurteil“, schreibt der Historiker Michelet.85 Die Leiche der Prinzessin Lamballe, einer Freundin Marie-Antoinettes, wird abscheulich verstümmelt. Je länger der apokalyptische Tanz dauert, desto weniger macht man sich die Mühe der Unterscheidung. Die Täter – Michelet spricht von etwa 400 – massakrieren einfach alles, was ihnen in den Weg kommt, simple Strafgefangene und Prostituierte, auch Kinder werden nicht geschont. Die Bilanz des Blutrauschs sind 1200 Tote, darunter 115 Priester.86 Von Napoleon haben wir keinen Bericht über diese schrecklichen Tage. Er hält sich an unbekanntem Ort in der Stadt auf. Wahrscheinlich ist er abgetaucht wie viele andere, in der Hoffnung, dass der Blutdurst irgendwann gestillt ist.87 Er hat genug gesehen. Den Horror vor dem losgelassenen Mob wird er nie loswerden.
Die Guillotine, errichtet auf der Place du Carroussel, um die „conspirateurs et ennemis de la Patrie“ zu vernichten.
Sein Aufenthalt in Paris zieht sich in die Länge. Das Ministerium hat mit der Untersuchung der Osterunruhen keine Eile. Napoleon geht das Geld aus, er versetzt seine Uhr und macht Schulden. In einem Anflug von Selbstmitleid versteigt er sich zu der Behauptung, alles, was er vom Leben wünsche, sei ein ruhiges Familienleben mit einer Rente von vier- oder fünftausend Franken.88 Für Frankreich sieht er schwarz. Das Land werde unweigerlich im Ruin versinken. Korsika werde aber davon profitieren „Alles läuft auf unsere Unabhängigkeit hin“, schreibt er Joseph.89 Der Bescheid des Ministeriums ist, als er endlich eintrifft, günstig. Zwar gehöre Napoleon wegen der Osterunruhen eigentlich vor ein Kriegsgericht. Doch andererseits sei das Ministerium unzuständig. Vermutlich gehen den Beamten die korsischen Querelen auf die Nerven, man möchte die unbedeutende Affäre vom Tisch haben. So lässt man fünfe gerade sein und erlaubt die Wiedereingliederung des Leutnants Bonaparte, um die sein Regiment gebeten hat. Napoleon wird sogar rückwirkend zum Hauptmann ernannt. Die Ernennungsurkunde trägt die Unterschrift des Königs, eine der letzten, die Ludwig XVI. leistet. Im Ganzen bleibt der Vorgang rätselhaft. Ein vom Kriegsminister unterschriebener Brief an den Gestrauchelten verblüfft durch den fast kniefälligen Ton. Es wäre „wünschenswert“, heißt es darin, „Ihr Dienst in der Nationalgarde [d. h. bei den Freiwilligen] gestattete Ihnen in diesem Augenblick, wo Ihr Regiment in der größten Aktivität ist, bei ihm Ihre Funktion als Hauptmann zu erfüllen“.90 Einen höflicheren Stellungsbefehl hat es wohl nie gegeben.
Man möchte annehmen, Napoleon könne sein Glück kaum fassen: Statt vors Kriegsgericht gestellt zu werden, ist er zum Hauptmann aufgerückt! Aber statt mit fliegenden Fahnen zu seinem Regiment zu eilen, sucht er einen Vorwand, der es ihm erlaubt, abermals nach Korsika zu entweichen. Eine Familienangelegenheit kommt ihm zupass. In Frankreich sind die adligen Damenstifte aufgehoben worden. Die kleine Schwester Elisa, die ihre Erziehung im Stift von Saint Cyr genießt, ist davon betroffen. Sie muss nach Hause begleitet werden. Das übernimmt der große Bruder gern. Als am 20. September bei Valmy in den Argonnen die Kanonen donnern und die blau-weiß-rote Armee Goethe und alle Welt in Erstaunen versetzt, gehen Napoleon und Elisa in Marseille an Bord des Schiffes, das sie auf die Heimatinsel bringt.