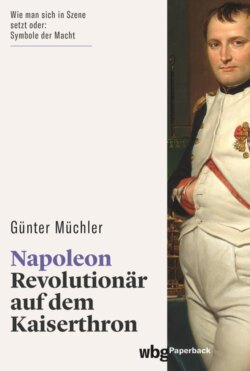Читать книгу Napoleon - Günter Müchler - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Verstoßene Liebe
ОглавлениеAlles, was der Vulkan auf dem Festland ausspeit, kommt auch in Korsika an, wo sich die Lava mit den Giftströmen der Inselintrigen vermengt. Personalisiert wird das Ringen zwischen Revolution und Ancien Régime durch den Syndikus Saliceti, linker Abgeordneter im Pariser Konvent, und dem Monarchisten Pozzo di Borgo. Wie immer wenn die Politisierung Siedegrade angenommen hat, zerbricht als Erstes die politische Mitte. Paoli zehrt noch von seinem Ruhm als Freiheitsheld, aber mehr und mehr entgleitet ihm die Kontrolle. Die Entwicklung auf dem Festland arbeitet gegen ihn. In Paris setzt sich die zentralistische Bergpartei gegen die föderalistische Gironde durch. Paolis Ziel einer Teilautonomie Korsikas im Rahmen eines föderativ geordneten Frankreich ist damit der Boden entzogen. Auch die Pariser Außenpolitik steht quer zu Paolis Interessen. Der Erfolg von Valmy bläht den Revolutionären die Brust. Aus dem Verteidigungs- wird ein Eroberungskrieg. Nizza wird annektiert, die Armee marschiert in Savoyen ein. Das führt zum bewaffneten Konflikt nun auch mit dem Doppelkönigreich Sardinien-Piemont, zu dem Savoyen gehört. Plötzlich befindet sich Korsika mitten im Kriegstheater.
Paolis Favorit heißt jetzt mehr denn je Pozzo di Borgo. Mithilfe des babbù besetzen Pozzo und seine Freunde alle Schlüsselstellungen in Ajaccio. Joseph wird kalt gestellt. Damit sind die Bonapartes den Nachstellungen des verfeindeten Clans schutzlos ausgesetzt. In einer logischen Reaktion schlägt sich Napoleon auf die Seite des Jakobiners Saliceti. Noch vermeidet er den offenen Bruch mit Paoli, vielleicht lässt sich das Blatt ja noch einmal wenden. Eine Chance tut sich auf, als in Paris eine Militärexpedition mit korsischer Beteiligung gegen Sardinien beschlossen wird. Zwei Flottillen werden auf die Reise geschickt. Die eine soll Cagliari im Süden Sardiniens angreifen, die andere nimmt Kurs auf das zwischen Bonifacio im Süden Korsikas und der sardischen Nordküste gelegene Inselarchipel von La Maddalena. Napoleon ist mit seinen Freiwilligen der zweiten Flottille zugeteilt. Das Oberkommando liegt bei Colonna Cesari, einem Neffen Paolis, das Kommando über die mit einem Mörser und zwei Kanonen nicht sehr eindrucksvolle Arillerieeinheit hat Napoleon. Die dilettantisch vorbereitete Expedition endet mit einem zweifachen Fehlschlag. Vor Cagliari nimmt die franco-korsische Einheit nach dem ersten Gegenfeuer Reißaus. Auf der Korvette La Fauvette, die den Angriff auf La Maddalena decken soll, meutern die kurzerhand zu Marinesoldaten umfunktionierten provencalischen Bauern und nötigen Colonna Cesari zum Rückzug. Napoleon, der von dem Eiland San Stefano aus gerade mit der Beschießung von La Maddalena begonnen hat, muss Hals über Kopf seine Stellung aufgeben. Der sardische Unteroffizier Domenico Millelire, dem die auf San Stefano zurückgelassenen Kanonen in die Hände fallen, wird noch heute auf La Maddalena als Held und Sieger über Napoleon gefeiert.
Napoleon schäumt vor Wut. Er trägt für das Scheitern vor La Maddalena keine Verantwortung, aber die Blamage ist groß. Er attackiert Colonna Cesari und meint Paoli. Tatsächlich hat der babbù die Expedition nur halbherzig mitgetragen. Ihm passt die ganze Entwicklung nicht. Die Unabhängigkeit Korsikas? Die Regierung der Republik will davon trotz aller Freiheitsparolen genauso wenig wissen wie seinerzeit die königliche Regierung. Ludwig XVI. ist abgeurteilt und hingerichtet (21. Januar 1793). Man wird sehen, was aus Frankreich wird. Mittlerweile steht es mit der halben Welt auf Kriegsfuß. Paoli setzt auf Abwarten. Da plötzlich, am 2. April, stellt der Konvent in Paris ihn unter Anklage. Paoli macht dafür eine innerkorsische Intrige verantwortlich. Er irrt sich nicht. Zwei Wochen zuvor hat der Jakobinerklub von Toulon Paoli in einer an den Konvent gerichteten Botschaft als Verräter und Konterrevolutionär angeschwärzt. Verfasser ist Lucien Bonaparte, der sich in Toulon aufhält. Die Denunziation fällt in Paris auf fruchtbaren Boden. Dort schwirrt es gerade wieder von Verschwörungstheorien. General Dumouriez, der gefeierte Sieger von Jemappes, hat mit der Konventsregierung gebrochen und droht, auf die Hauptstadt zu marschieren. Warum soll nicht auch Paoli ein Verräter sein? Triumphierend berichtet Lucien den großen Brüdern von seiner Heldentat: „Ihr werdet die Nachricht den Zeitungen entnommen haben. Damit habt ihr nicht gerechnet? Paoli und Pozzo sind angeklagt, und unser Glück ist gemacht!“91 Napoleon ist entsetzt. Wenn herauskommt, dass Lucien hinter der Aktion steckt, ist höchste Alarmstufe für die ganze Familie gegeben. Eilig schickt er dem Konvent eine Ehrenerklärung für Paoli, aber es ist zu spät. Luciens Brief ist abgefangen worden. Damit herrscht Vendetta zwischen Paoli und den Bonapartes. Napoleon wird festgenommen. Zwar gelingt es Gefolgsleuten aus dem Dorf Bocagnano, wo die Bonapartes Land besitzen, ihn zu befreien, aber er ist jetzt nirgendwo mehr sicher. Das Paoli ergebene Parlament in Corte erklärt die Familie Bonaparte für vogelfrei, die Casa Bonaparte in Ajaccio wird geplündert. Napoleon bereitet die Flucht vor. Den Familienmitgliedern schreibt er: „Macht euch fertig für die Abreise. Dieses Land ist nicht für uns.“92 Gemeinsam mit Saliceti unternimmt er von Bastia aus einen letzten Versuch, Ajaccio zurückzugewinnen. Als der Befreiungsschlag scheitert, ist es so weit. Am 11. Juni 1793 schifft sich die Familie im Hafen von Calvi für die Überfahrt auf das französische Festland ein. Auch Saliceti flieht. Die Partei der Revolution hat den Kampf um Korsika fürs Erste verloren. Paoli erkennt Georg III. als König an. Korsika wird, wenn auch nur für eine Übergangszeit, englisch.
Die Flucht nach Toulon setzt einen Schlussstrich unter das korsischfranzösische Doppelleben, das Napoleon sieben Jahre lang geführt hat. Erst jetzt ist er wirklich Franzose. „Korsika ist nicht für uns!“ Die Erkenntnis ist bitter. Die schöne Insel ist für ihn ja nie bloß Berechnung gewesen. Sie war ein Traum, wie man ihn in der Jugend träumt. Die Hingabe ist ihm schlecht vergolten worden. Korsika hat ihn ausgespien, so wie Paoli, den er verehrte wie einen Vater, ihn verstoßen hat. So schwer ihn der doppelte Liebesverrat trifft, er wirft ihn nicht aus der Bahn. Die Enttäuschung verarbeitet er produktiv als Ent-Täuschung. Den Idealismus wirft er ab wie eine verbrauchte Haut. In Zukunft wird er vor großen Ideen auf der Hut sein. Was von nun an zählt, sind Tatsachen, ist das Vertrauen in die eigene Kraft. Das Scheitern in Korsika macht ihn zum Empiriker und Skeptiker.
Deshalb überträgt er die Gefühle, die er für Korsika empfunden hat, auch nicht einfach auf Frankreich. Allen künftigen Phrasen zum Trotz bleibt sein Verhältnis zu dem Land, dem er jetzt endgültig angehört, immer instrumentell. Frankreich ist seine Bühne, nicht seine Liebe. Kompliziert ist sein Verhältnis zur Revolution. Bei Licht betrachtet hat er wenig Ahnung von dem, was in Paris politisch abläuft. Er liest Zeitungen. Frankreich erlebt seit 1789 eine Zeitungsblüte. Aber die meisten Blätter sind sektiererisch und vermitteln kein zuverlässiges Bild. Die Fraktionskämpfe im Konvent* lassen ihn kalt. In einer permanent erregten Umwelt fällt er auf durch einen Mangel an Leidenschaftlichkeit. Ist der Artillerie-Hauptmann Bonaparte ein Opportunist?
Zum Zeitpunkt seiner Flucht aus Korsika steht Napoleon zweifellos auf dem Boden des revolutionären Grundgesetzes, das heißt, er billigt die Abschaffung der Standesunterschiede, die Enteignung des Kirchenbesitzes und die Gleichheit vor dem Gesetz. Das Gottesgnadentum gehört in seinen Augen einer „gotischen“ Vorzeit an, ist Mittelalter. Er meint es ernst, wenn er schreibt: „Nur wenige Könige hätten es verdient, nicht abgesetzt zu werden.“ Herrschaftsrechte erwirbt man nicht durch Geburt, sondern durch Verdienst. Mit dem schwachen Ludwig XVI. hat er kein Mitleid. Umgekehrt empfindet er für die Richter des Königs keine Hochachtung. Als er von der Exekution erfährt, lautet sein erster Kommentar: „Die elenden Wichte! Sie werden sich die Anarchie aufhalsen!“93 Er hält die Hinrichtung für einen taktischen Fehler, den Justizmord verurteilt er nicht, so wie er sich mit Urteilen über die terreur, die Schreckensherrschaft zurückhält. Er ist vorsichtig geworden. Davon abgesehen fragt er lieber nach der Fähigkeit als nach der Moral. In dieser Hinsicht wachsen seine Zweifel an den Akteuren. Man braucht keine Könige, aber Autorität ist unerlässlich. Wohin die Vergötzung des Volkes führt, hat er bei den Meutereien in seinem Regiment erlebt und noch stärker am 10. August 92 in Paris. Grundsätzlich ist die Revolution eine gute Sache, sie darf nur nicht in Unordnung münden. Prosélyte heißt das Schiff, das die Bonapartes von Ajaccio nach Toulon befördert. Napoleons Glaube an die Vernunft der Revolution ist unerschüttert, der an die Vernunft der Revolutionäre hat allerdings Risse bekommen.
Die Bonapartes sind jetzt politische Flüchtlinge. Eine Bleibe finden sie in La Valette, einem Vorort von Toulon. Der Familie steckt noch der Schrecken in den Knochen. Die materielle Situation ist angespannt. Außer einigen Ersparnissen, die Letizia gerettet hat, bleibt nur der Hauptmannssold Napoleons. Napoleon ist jetzt in Nizza stationiert, wo die armée d’Italie, die Armee, die Österreich in Italien attackieren soll, ihr Hauptquartier hat. Wieder einmal steht er vor dem Problem, sein langes Fernbleiben vom Regiment rechtfertigen zu müssen. Saliceti, der Abgeordnete und Landsmann, der mittlerweile für die ganze Familie Bonaparte so etwas „wie eine gute Fee“94 geworden ist, stellt ihm ein „Attest“ aus, und der Regimentskommandeur gibt sich zufrieden. Von 80 Offiziersstellen hat er nur 14 besetzt. So ähnlich sieht es in der ganzen Italienarmee aus. Dabei kommt es gerade jetzt auf die Streitkräfte an. Die Republik führt inzwischen Krieg gegen Österreicher, Preußen, England, die Niederlande, Piemont und Spanien. Fast noch bedrohlicher ist die Situation im Innern.
In der Vendée tobt ein gnadenloser Bürgerkrieg. Hier kämpfen Weiße gegen Blaue, Königstreue gegen Konventstruppen, Brüder gegen Brüder. Noch Jahre wird dieser mit kaum vorstellbarer Brutalität geführte Krieg dauern. Victor Hugo hat ihn in Siebzehndreiundneunzig beschrieben. Am Ende wird eine Viertelmillion Menschen ihr Leben verloren haben, man kann von einem Genozid sprechen.95 Mitte des Jahres kommt es auch in der Normandie, in der Bretagne, in der Franche-Comté und im Midi zu Aufstandsbewegungen. Halb Frankreich befindet sich im Bürgerkrieg. Die Motive der Aufständischen changieren. Eine Triebkraft ist die Kirchenverfolgung. Jede Revolution braucht ihr Hassobjekt, das Hassobjekt der Konventsmehrheit ist der Katholizismus. Längst geht es nicht mehr nur darum, Kirche und Klerus dafür zu strafen, dass sie einst der Monarchie die Legitimation verliehen und die Privilegien der alten, ungerechten Ordnung geteilt haben. Die Religion soll zerstört werden. Vorstufe ist das Schisma, das dadurch herbeigeführt wird, dass Bischöfe und Priester den Eid auf die Verfassung schwören müssen. Die Eidverweigerer, die réfractaires, werden verfolgt, Tausende ins Exil getrieben, andere massakriert oder deportiert. Gotteshäuser werden zerstört, Heiligenfiguren zertrümmert. Eine Ersatzgottheit wird geschaffen, die ausgerechnet die Vernunft repräsentieren soll. Dabei ist die Kirchenverfolgung alles andere als vernünftig. Frankreich ist immer noch ein katholisches Land. Vor allem in der Provinz hängen die Menschen an ihrem Glauben. Mit ihrem pathologischen Hass auf die Kirche treibt die Konventsmehrheit die Bauern in den Widerstand und in die Arme der Royalisten. Das ist die Situation in der Vendée. Im Süden sind es die Städte, die aufstehen. Hier geht es weniger um Thron und Altar. Die Empörung richtet sich gegen die Hauptstadt, die nur ein 83stel des Landes repräsentiert und sich doch allmächtiger aufführt als das absolutistische Königtum in seiner Hochzeit. Die Anti-Paris-Bewegung der fédérés hat bald Marseille, Toulon, Avignon und Lyon in der Hand.