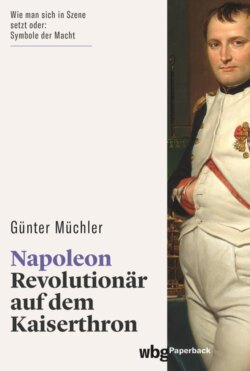Читать книгу Napoleon - Günter Müchler - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung
ОглавлениеAm 26. Juni 1813 empfängt Napoleon in seinem Dresdner Hauptquartier den österreichischen Minister Klemens von Metternich. Nach zwei Achtungserfolgen über Russen und Preußen hat er Waffenstillstand geschlossen. Seine Armee braucht Erholung. Politisch kommt es darauf an, Österreich bei der Stange zu halten. Der Habsburgerstaat ist seit dem für Napoleon katastrophalen Ausgang des Russlandfeldzugs nur noch ein lauer Bündnispartner. Wechselt Österreich die Seite, ist die antifranzösische Koalition, zu der schon jetzt neben Russland und Preußen auch noch England und Schweden gehören, endgültig übermächtig. Für Napoleon steht also viel auf dem Spiel.
Die Begegnung im Sommerschlösschen des Grafen Marcolini zieht sich über mehr als acht Stunden hin. Am Ende haben sich die Kontrahenten keinen Zentimeter bewegt. Metternich bleibt entschlossen, Österreich in den Schoß der Mächteallianz zu führen. Napoleon lehnt Konzessionen ab, solange er hoffen kann, den Konflikt auf dem Schlachtfeld zu entscheiden. Trotzdem ist das Treffen mehr als Randgeschehen. Wer sich nicht damit zufriedengibt, bei der Beurteilung Napoleons nur die Taten sprechen zu lassen, sondern nach den Motiven und Triebkräften hinter seinem Handeln sucht, stößt mit der Dresdner Entrevue auf eine kapitale Erkenntnisquelle, ja auf eine Sternstunde. Warum fällt Napoleon im Entscheidungsjahr 1813 derart in politische Apathie? Warum schaut er fast tatenlos zu, wie ihm zuerst Preußen abhandenkommt, dann Österreich? Vielleicht hätte er das Netz, das Metternich so klug um ihn gesponnen hat, beim besten Willen nicht zerreißen können. Die Frage ist, weshalb er es gar nicht erst versucht. In Österreich und sogar in Preußen gibt es in den ersten Monaten des Jahres noch Anhänger des Bündnisses mit Frankreich, denen er durch einen diplomatischen Befreiungsschlag Munition liefern könnte. Eine Antwort bietet die Dresdner Unterredung. Sie ist ein Psycho-Duell, das seine Dramatik auch aus der Gegensätzlichkeit der Protagonisten bezieht. Da ist dieser Mann Napoleon. In rasend kurzer Zeit hat er ein Großreich zusammengeklaubt, wie Europa es seit Karl dem Großen und Karl V. nicht gesehen hat. Seine Truppen stehen in Sachsen, in Spanien und in Italien. Rom, Amsterdam, Köln und Hamburg sind französische Städte. Allein viermal hat er Österreich aufs Haupt geschlagen. Und nun steht der Lenker dieses Verliererstaates ihm von gleich zu gleich gegenüber – Metternich, der supererlastische Diplomat, le beau Clément, dem er einst seine Schwester Caroline schmunzelnd zum Zeitvertreib überlassen und den er lange für einen Windbeutel gehalten hat. Für Napoleon ist das eine kaum zu ertragende Situation. Streckenweise verläuft die Entrevue stürmisch. Einmal feuert er theatralisch seinen Hut auf den Boden. Den Höhepunkt erreicht die Begegnung, als er Metternich entgegenschleudert: „Eure Majestäten, die auf dem Thron geboren sind, halten es aus, zwanzigmal geschlagen zu werden. Jedesmal kehren sie zurück in ihre Hauptstadt. Ich bin nur der Sohn des Glücks. Ich würde von dem Tag an nicht mehr regieren, an dem ich aufhörte, stark zu sein.“1
Wir kennen die Szene aus einer sieben Jahre später abgefassten Aufzeichnung Metternichs. Womöglich sind die drei Sätze nicht Wort für Wort so gefallen, aber das ist unerheblich. Napoleon hat sich mehrfach in ähnlichem Sinne geäußert. Mit den Eingangsworten „Eure Majestäten“ zieht er einen Trennungsstrich zwischen Frankreich, dem Land der Revolution, und dem Ancien Régime, der Welt Metternichs, in der noch immer Gottesgnadentum und Geburtsvorrang maßgeblich sind. 1810 waren durch seine Heirat mit einer österreichischen Erzherzogin Zweifel aufgekommen, welcher Hemisphäre er selbst angehöre. Den Versuch, die beiden Welten zu versöhnen, betrachtet er jetzt als gescheitert. Er, der Kaiser der Franzosen, ist wieder der „Sohn des Glücks“, der einzig auf seine Stärke bauen kann und mit dem es vorüber ist, wenn das Glück ihn verlässt.
Was Napoleon hier vor dem Antipoden Metternich wie ein Bekenntnis formuliert, ist das Gesetz des Eroberers. Er gibt zu, ein gefesselter Riese zu sein. Sein Lindenblatt ist, dass er als Emporkömmling nicht über die volle Entscheidungsfreiheit verfügt. Er darf keine Schwäche zeigen und ist zum ewigen Voranschreiten verdammt. Für die Situation von 1813 bedeutet das: Bevor er den Frieden verhandelt, muss er noch einmal siegen, andernfalls implodiert seine Herrschaft, die auf vorzeigbarer Überlegenheit ruht. Verblendung? Realitätsverlust? Die folgenden Ereignisse bestätigen ihn eher, als dass sie ihn widerlegten. Nach der Niederlage von Leipzig, der „Völkerschlacht“, sucht ein Verbündeter nach dem anderen das Weite. Ein paar Monate später rücken die Alliierten in Paris ein. Der Revolutionskrieg, der mit der Mattsetzung Ludwigs XVI. begonnen hat, endet mit der Thronbesteigung Ludwigs XVIII. Die Restauration beginnt.
***
In den Schulbüchern scheitert Napoleon meistens an seinen Charaktereigenschaften. Er sei großmannssüchtig gewesen, kriegslüstern und maßlos. Deshalb habe er sein Reich verloren. Viele Historiker nehmen beim Jahr 1804 einen scharfen Schnitt vor. Den Konsul Bonaparte lassen sie gelten, den Kaiser Napoleon wenig oder gar nicht.2 Für sie sind die Jahre nach der Kaiserkrönung eine Abfolge von Verrat und Verfall – des Verrats an der Revolution und an sich selbst, des Verfalls durch Überheblichkeit. In dieser zweigeteilten Optik wird das simple Erzählmuster „Männer machen Geschichte“ gegen Napoleon gewendet. Der Korse wird zu einer Art Supermann, der alles vermag und deshalb in allen Punkten der Anklage schuldig sein muss. Vernachlässigt werden die Rahmenbedingungen seines Handelns. Die Dynamik des Epochengegensatzes wird ebenso ausgeblendet wie der Zusammenhang, der zwischen Revolution und cäsarischer Herrschaft besteht. So bleibt für die über allem stehende Frage, weshalb Napoleon das Erreichte nicht halten konnte, tatsächlich nur die Charakter-Antwort.
Das vorliegende Buch stellt den Mann in die Zeit. Es will herausfinden, wo Napoleon Gestalter und wo er Getriebener war. In seiner Abhandlung Die Ohnmacht des allmächtigen Diktators Cäsar urteilt Christian Meier sehr fein, Cäsar habe wohl „alle Macht in den Verhältnissen, aber keine über sie“ gehabt.3 Das trifft auch auf Napoleon zu. Er ist zweifellos der überragende Akteur seiner Zeit und dennoch keineswegs frei, nach Gutdünken durch die Weltgeschichte zu surfen. Er hat das übrigens selbst so gesehen. Auf Sankt Helena sagt er zu dem Gefährten Las Cases: „Die Wahrheit ist, dass ich niemals ganz Herr meiner Bewegungen war. Ich habe Pläne gehabt, aber niemals die Freiheit, sie auszuführen. (…) Immer war ich durch die Umstände bestimmt.“4
„Die Umstände“ – das ist zuallererst die Revolution. Niemand, der in den Jahren nach 1789 Politik macht, kann die Tatsachen, die sie geschaffen hat, ignorieren. Napoleon ist beim quatorze juillet 19 Jahre alt. Die Bekanntschaft mit einzelnen Jakobinern verschafft ihm die Eintrittskarte in seine Karriere. Als Heranwachsender hat er die Philosophen gelesen, die Wegbereiter der Revolution. Sie haben gelehrt, dass die Geschichte, anders als man bis dahin geglaubt hat, nicht die ewige Wiederkehr des immer Gleichen ist. Man kann den Lauf der Geschichte verändern. Diese Erkenntnis ist der Zündfunke für die Geschehnisse von 1789. Sie erklärt den Enthusiasmus der Revolutionäre, auch die Rücksichtslosigkeit, mit der sie zur Tat schreiten. Ça ira! („Wir schaffen das!“), johlen die Sansculotten. Wer sich auf der richtigen Seite der Geschichte weiß, darf sich alles herausnehmen. Von diesem Wein trinkt der junge Napoleon, und wenn er später kaltschnäuzig Grenzen verschiebt, Reiche zerstört und neue fabriziert, klingt die Verachtung des Revolutionärs für das Alte nach.
Madame de Staël, die scharfzüngige Tochter des früheren königlichen Finanzministers Necker, sagt von Napoleon, er sei das Kind der Revolution gewesen, allerdings ein „muttermörderisches“. Weit gefehlt! Als der Konsul Bonaparte 1799 die Revolution für beendet erklärt, ist diese kompromittiert bis auf die Knochen. Napoleon rettet, was von ihr zu retten ist. Wichtige Ergebnisse wie breite Umverteilung des Eigentums, die aus der Konfiszierung der Güter von Kirche und Emigranten herrührt, zementiert er durch seinen Eid. Selbst die restaurierten Bourbonen wagen nicht, daran zu rütteln.
Teil des revolutionären Erbes, das Napoleon annimmt, ist der Krieg. Dieser bricht 1792 aus und dauert mit der Unterbrechung eines Jahres bis 1814. Von „napoleonischen Kriegen“ zu sprechen, verbietet allein der Blick auf den Kalender. Erst ab dem Brumaire-Putsch hat Napoleon politischen Durchgriff. Zu diesem Zeitpunkt dauert der Konflikt bereits acht Jahre. Der erste Krieg, der einzig auf Napoleons Konto geht, ist der Spanienkrieg, der 1807 beginnt.
Dass sich der Konflikt zwischen Alt-Europa und dem Land der Revolution fast so lang hinzieht wie der Dreißigjährige Krieg, liegt hauptsächlich daran, dass er wie dieser partiell ein Religionskrieg ist, und wo es um letzte Dinge geht, sind Verstand und Humanität oft suspendiert. Für den zweiten Grund sorgen die Führer der Revolution. 1795 beschließt die Konventsregierung die Einverleibung Belgiens, in vollem Wissen um die Folgen. England, das die Revolution zunächst als innerfranzösische Angelegenheit betrachtet hat, nimmt die Kontrolle des Rivalen über den Hafen Antwerpen und die ehemals österreichischen Niederlande niemals hin. Es wird mit seiner Flotte und seinem Geld zum unermüdlichen Antreiber des Krieges. Für Napoleon, der am Tag der Kaiserkrönung schwören muss, keinen Zipfel des Territoriums der nation une et indivisible, der „einen und unteilbaren Nation“, preiszugeben, bleibt Belgien eine Hypothek bis zum Ende seiner Herrschaft, das die Geschichte, die immer gern ein Ausrufungszeichen setzt, in Belgien besiegelt, auf dem Schlachtfeld von Waterloo. Die paix générale, der Friede unter Einbeziehung Englands, würde den Verzicht auf Belgien oder das Niederringen Britanniens voraussetzen. Das Erste traut sich der Erbe der Revolution nicht zu, das Zweite schafft er nicht. Er kann das amphibische Albion weder erobern noch wirtschaftlich strangulieren. Nebenbei bemerkt sind die Pläne für Invasion und Kontinentalsperre keine Erfindungen Napoleons. Die Dossiers findet er in den Schubladen des Konvents, woher er auch die Anleitung zum organisierten Kunstraub bezieht, dessen Begründer zu sein er bis in die Gegenwart fälschlicherweise beschuldigt wird.5 Zwar praktiziert er als General der Italienarmee 1796/97 den Kunstraub in großem Stil, aber die ersten Beutezüge finden 1794/95 in Belgien und Deutschland statt, auf Anordnung des Wohlfahrtsausschusses.
Die Aufspaltung der Epoche von 1789 bis 1815 in eine Revolutions- und eine Napoleonszeit steht dem Verständnis der Epoche mehr im Weg als jedes andere Klischee. Der Brumaire-Putsch von 1799, der Napoleon in den Sattel hebt, wird nicht von Revisionisten ins Werk gesetzt, sondern vom Stammpersonal der Revolution, das mithilfe eines starken Mannes die Gegenrevolution verhindern will. Dieselben Kräfte und Motive treiben zur Kaiserkrönung von 1804. Schon deshalb wäre es falsch, Napoleons Kaisertum als Wiederkehr des Ancien Régime anzusehen. In Wirklichkeit wird dem Cäsarismus die Krone aufgesetzt, einer eigentümlichen Herrschaftsform, die sich auf die Volkssouveränität und auf das Charisma des Staatschefs stützt und die von der Monarchie alten Typs weiter entfernt ist als von der Revolution, aus deren Schoß sie kommt. Mitverantwortlich für das Missverständnis sind die monumentalen Krönungsporträts und der antikisierende Kitsch der Zeremonie in Notre Dame, den auch viele Zeitgenossen schwer verdaulich finden. Napoleon wirft den Hermelinmantel allerdings rasch ab und schlüpft wieder in seine wenig hermachende Gardistenuniform. Er braucht den Purpur nicht für sein Ego und auch nicht für seine Machtvollkommenheit. „König der Revolution“ (François Furet) ist er schon als Konsul auf Lebenszeit. Für ihn gehorcht die Anverwandlung an Charlemagne den Bedürfnissen eines noch ungefestigten Staatswesens, das gerade erst aus dem Vulkanausausbruch von 1789 emaniert ist und auf dem wackligen Sockel des Königsmordes ruht.
Die Republik braucht Stabilität. Sie wird bedroht von den konservativen Mächten und vom Hass der bourbonischen Partei, die sich nach dem für sie verlorenen Bürgerkrieg auf Terroranschläge verlegt. Ein Geburtsfehler schwächt die Abwehrkräfte der Republik. Die Jakobiner fürchten die Militärdiktatur fast noch mehr als die Rache der Royalisten. Schon der Anschein personaler Autorität versetzt sie in Alarmstimmung. Ängstlich halten sie die ausübende Gewalt an der kurzen Leine. 1799 hat der von Ideologie herbeigeführte Schwächezustand der Republik ein Maß erreicht, dass weithin der Ruf nach dem sauveur erschallt, dem Retter. Am lautesten rufen die, die sich entweder in ihrer revolutionären Laufbahn mit Blut befleckt haben oder als Bodenspekulanten erfolgreich waren, kurz gesagt die „Königsmörder“ und die Zigtausend Aufkäufer des geraubten Kirchengutes. Sie haben am meisten zu fürchten, wenn die Republik kollabiert und die Bourbonen Vergeltung üben. Daher sind sie es auch, die dem General Bonaparte in den Novembertagen des Jahres 1799 die Tür öffnen und ihn mit diktatorischen Vollmachten ausstatten. Mit ihrer Billigung nimmt Napoleon Stufe um Stufe zur Alleinherrschaft. Aus dem Konsul mit zehnjähriger Amtszeit wird der Konsul auf Lebenszeit, dann der Revolutionär auf dem Kaiserthron. Den Antrag zur Kaiserernennung bringt im Tribunat nicht zufällig ein ehemaliger Jakobiner ein, ein Gefolgsmann des „Königsmörders“ Fouché.
Zum Diktator wird Napoleon im Auftrag. Allerdings liegt das Autokratische auch in seiner Natur. Die Franzosen, denen nicht nur Tocqueville nachsagt, dass es sie mehr nach Gleichheit als nach Freiheit verlangt, nehmen die Abstriche an der liberté gelassen hin. Die Lebensverhältnisse sind trotz der Belastungen durch den Krieg besser als in den 90er-Jahren. An die Stelle des Willkürregimes der Terror- und Nachterrorzeit ist ein System polizeilicher Beaufsichtigung getreten, das das repressive Niveau der europäischen Nachbarn nicht übersteigt, und wenn doch, nur weil Fouchés Polizei effektiver ist. Zwei Justizmorde sind mit dem Namen Napoleons verbunden, die Erschießung des Herzogs von Enghien 1805 und die des Nürnberger Buchhändlers Palm 1806. Beide sind unentschuldbar, aber angesichts der Allgegenwart von Verschwörung und Anschlagsgefahr statistisch unauffällig. Im Ganzen gesehen geht es den Franzosen gut. Sie werden in ihrer Leidenschaft, dem Ruhm, bestens bedient, und so hält Napoleons cäsaristisches Regime selbst dann noch, als das Charisma des Cäsar zu schwinden beginnt.
2. Dezember 1804: „Die Krönung Napoleons“, in der Kathedrale Notre-Dame in Gegenwart von Papst Pius VII. Gemälde von Jacques-Louis David (Ausschnitt, 1806/07).
***
Maßstab für die Beurteilung geschichtlicher Akteure ist, was sie getan und was sie an Bleibendem hinterlassen haben. Napoleon ist ein überragender Feldherr. Die Ortsnamen seiner zahlreichen Siege sind im Mauerwerk des Arc de Triomphe eingraviert. Er selbst veranschlagt seine zivilen Leistungen höher als die militärischen. Die Reformen, die mit seinem Namen verbunden sind und die er vor allem in den ersten Jahren seiner Herrschaft durchsetzt, sind kaum zu zählen. Viele haben ihn überdauert wie das Präfektensystem, die Bank von Frankreich, der franc germinal, das staatliche Gymnasium, das Bac und natürlich das Bürgerliche Gesetzbuch, auf das er besonders stolz ist. „Was nichts auslöschen kann, was ewig bleiben wird, das ist mein Code civil.“6 Der moderne Verwaltungsstaat Frankreich trägt Napoleons Monogramm.
Die Reformen werden mit dem räumlichen Ausgreifen Frankreichs exportiert. Sie fahren gleichsam im Tross der dreifarbenen Armeen mit. In Deutschland profitiert vor allem der Westen von diesem Modernitätsschub. So kommt es, dass die Bevölkerung im französisch gewordenen Rheinland die „Preußisierung“ 1815 nicht als Glücksmoment erlebt. Ein anderes Kapitel ist die territoriale Neuordnung. Bei der Aufräumaktion durch Säkularisierung und Mediatisierung wird zwar hundertfach Recht gebrochen, aber die Flurbereinigung ist langfristig doch ein Fortschritt. Die kräftig arrondierten und zu Königreichen erhobenen Bayern und Württemberg sowie das Großherzogtum Baden bilden den Kern des künftigen Dritten Deutschland. Sie haben ihre Gestalt im Wesentlichen bis heute erhalten. Thomas Nipperdey kann deshalb seine Deutsche Geschichte 1800 bis 1866 mit dem programmatischen Satz eröffnen: „Am Anfang war Napoleon.“
Ganz anders sieht die französische Bilanz aus. Die inneren Reformen haben Bestand, aber das gewaltige Grand Empire stürzt zusammen wie der Turm von Babel. Frankreich wird auf seine alten Grenzen zurückgeworfen, Napoleon ist ein Verlierer, und Verlierer straft normalerweise das Vergessen. Es sei denn, sie haben uns etwas zu sagen, das Raum und Zeit übergreift und über das Allgemeinmenschliche Auskunft gibt. Das ist bei Napoleon der Fall. Niemand hat die conditio humana so ausgemessen wie er. Napoleon wird 52 Jahre alt. 26 ist er, als ihm das Kommando der Italienarmee zufällt. Die vier folgenden Jahre begründen seinen Ruf als ausgezeichneter General, sind aber nicht mehr als ein Vorspiel. Die Sphäre des Öffentlichen betritt er an der Schwelle des neuen Jahrhunderts. Da ist er 30. Zieht man die letzten sechs Lebensjahre ab, die er, zur Tatenlosigkeit verurteilt, in der Verbannung auf Sankt Helena verbringt, sind ihm ganze 15 Jahre als Akteur beschieden, mehr nicht. Sie genügen ihm, um die Welt zu verändern. In diesen 15 Jahren wird Napoleon zum stupor mundi, dem Mann, der den Erdball zum Staunen bringt. Sein Charisma überwältigt; magische Kräfte werden ihm zugeschrieben. Wie auch, wenn nicht durch Magie, soll man sich seinen kometenhaften Aufstieg erklären? Alexander und Karl, die Großen, mit denen er sich gern vergleicht, waren Herrschersöhne, Cäsar berief sich auf die Abstammung aus Göttergeschlecht. Napoleon dagegen, der rotznäsige Junge, den die Kameraden an der Militärschule von Brienne wegen seiner modesten Herkunft aus Korsika, also beinahe aus der Barbarei, hänseln, hat keine Ahnen und keinen Namen. Er ist „das Produkt seiner eigenen Werke; er erschafft sich selbst“ (Jean d’Ormesson).
Natürlich, ohne Starthilfe geht es nicht. Erst muss die Revolution die Standesschranken niederreißen, damit der Elitentausch stattfinden kann, dessen prominentester Zeuge er sein wird. Aber um den Gipfel zu erklimmen, braucht es Genie oder, wie er einmal korrigierend sagt, Arbeit. Napoleon ist ein gigantischer Arbeiter, ein niemals ruhender Geist. Gedächtnis und Vorstellungkraft sind überragend. Seine Konzentrationsfähigkeit, die alle, die ihn kennen, hervorheben, erlaubt ihm, einen Feldzug zu führen und gleichzeitig ein Riesenreich zu lenken. Er ist ein Meister der politischen PR, der durch seine Proklamationen und Bulletins Bilder in die Köpfe pflanzt und durch genau bedachte Accessoirs (den in besonderer Weise getragenen Zweispitz, die schmucklose Uniform und den langen Mantel, die redingote grise) optische Alleinstellungsmerkmale herstellt, damit die große Masse, die ihn nie zu sehen bekommt, in ihm den Herrscher erkennt.
Nicht alle Eigenschaften nehmen für ihn ein. Napoleon kann nachtragend sein, herrisch und zynisch. Er widersteht nicht der Krankheit der Dauererfolgreichen und wird im Laufe der Jahre beratungsresistent. Nicht durchweg ist er der Kühle, Klare. Mit seinem ausgeprägten Wirklichkeitssinn koexistiert ein Hang zur Träumerei. Gewiss hat die Ägypten-Expedition einen harten politischen Kern. Andererseits zeigt sie Napoleon als Abenteurer, der in einem märchenhaften, aus der Lektüre gewonnenen Orient den Raum für Ruhm und Heroismus sucht, den er in Europa vermisst. Eine Zeit lang reizt Indien seine Fantasie. 1815 schließlich, kurz bevor er sich den Briten ergibt, träumt er von einer Entdeckerkarriere in Amerika. Seine Fixiertheit auf den Feind England grenzt an Starrsinn und manchmal fehlt ihm der Weitblick. Erstaunlich ist seine Blindheit für den Eigen-Sinn der Völker. Ihn, der doch als junger Mann voller Leidenschaft für die korsische Unabhängigkeit gekämpft hat, trifft der Fanatismus der Spanier vollkommen unvorbereitet, so wie er die Gärung in Preußen zu spät erkennt. In vielem denkt er modern, aber in einem zentralen Punkt verrechnet er sich: Das 19. Jahrhundert wird dem Nationalismus gehören und nicht der Universalmonarchie, die er zusammenhämmert. Diese Universalmonarchie, ein Kranz unterschiedlich konturierter abhängiger Staaten, ist ein Zufallsprodukt, ein Beifang gewonnener Kriege, und nicht das Resultat eines Plans oder gar einer Vision. Napoleon ist ein Mann, der Gelegenheiten mit sicherem Blick erfasst und entschlossen nutzt. Auf langfristige Ziele lässt er sich nicht ein, als schrecke ihn die Fesselung. Diese Disposition erleichtert das Ausgreifen, erklärt aber auch die Unfähigkeit, das Erreichte festzuhalten.
Letztlich ist es sein Leben, das bis heute in den Bann schlägt. Es ist ein Leben voll an hinreißenden Bildern; ein Leben, dessen Spannweite für hundert reichen würde. Es ist gleich grandios im Aufsteigen und im Niederstürzen, was Napoleon wiederum von Alexander, Cäsar, Karl dem Großen oder Friedrich von Preußen unterscheidet. Allein seine Lebensbahn erreicht die volle Rundung. Im Scheitern gewinnt sie die Eindringlichkeit einer Menschheitserzählung. Es lohnt sich, zum 250. Geburtstag den Faden dieser Erzählung wieder aufzunehmen.