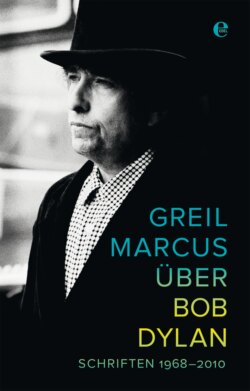Читать книгу Über Bob Dylan - Greil Marcus - Страница 10
ОглавлениеMit keuchendem Atem
Creem
Mai 1974
Im vergangenen Januar schrieb Langdon Winner mir Folgendes aus den Niederlanden:
Ich bin wieder beim Rock and Roll gelandet, jedenfalls bei dem Teil, der hier von holländischen, englischen und französischen Sendern oder vom AFN gespielt wird. Es fällt mir schwer zu sagen, welche der Songs (mit Ausnahme der Hits von Soulgruppen) aus Europa stammen und welche aus den USA. Jeder kann lernen, wie Mick Jagger zu singen, und deshalb vermute ich, dass einige der großen Hits diesseits des Atlantiks holländischer Rock sind und dass diese Nummern bei euch da drüben niemand kennt. Eine Sache ist jedoch zu Beginn dieses Jahres vollkommen offenkundig und bei euch dürfte es wohl schon länger so sein: Das Radio strotzt bis zum Bersten von Songs, die sich, auf eine sehr bewusste Weise, mit dem Thema Rock and Roll befassen, also wie man ihn macht, wie man sein Leben daran ausrichtet usw. Zwei Titel, die mir spontan einfallen: »Rock and Roll Baby« und »Rock and Roll I Gave You the Best Years of My Life«. Ich erinnere mich noch daran, wie ungewöhnlich es war, wenn man früher einen Song zu hören bekam, der sich auf sein eigenes Medium bezog. Jetzt scheint es so, als gäbe es nichts anderes mehr!
Vielleicht ist diese Zeit einer gesteigerten, aber letztlich lächerlichen Selbstbezogenheit ja nur das Vorspiel zu dem, was wir alle erwarten – das Erscheinen von etwas wirklich Neuem. Und damit meine ich nicht bloß die Musik. Es gibt gute Anzeichen dafür, dass das gesamte Klima, das politische wie das kulturelle, nicht nur in den USA, sondern auch im Rest der Welt vor einem grundlegenden Wandel steht. Zu viele Dinge bleiben ungelöst, nachdem sie angeblich gelöst worden sind, z. B. das »Ende« des Vietnamkriegs, die »rückhaltlose Aufklärung« von Watergate sowie eine Reihe von unter den Teppich gekehrten Problemen, die sich während der letzten zwölf Jahre angehäuft haben. Es herrscht eine große Anspannung und die reicht sehr tief. Ich glaube, dass sich daraus zwangsläufig gewaltige Kräfte entwickeln werden, die unseren Schwerpunkt in diese oder jene Richtung verlagern werden. So wie der Zuhalter eines Türschlosses einschnappt, wenn ein Schlüssel hineingesteckt und gedreht wird, so wird es meiner Ansicht nach eine Konvergenz von neuen Stimmen, Stilen und Interessen geben, die in eine bestimmte Richtung weisen. Ich weiß nicht, aber vielleicht wird so etwas wie Dylans Tournee mit der Band ein Zeichen sein. Vielleicht wird George Wallace zur Halbzeit des Superbowl herauskommen, seine Krücken von sich werfen und einen Marsch auf Washington anführen, eine Art Erstürmung der Bastille, um die Macht im Staat an sich zu reißen. Das Bedürfnis danach ist vorhanden – und ich denke, dass es gerade zurzeit definitiv zu einem kollektiven Bedürfnis wird. Der Zeitgeist und das Spektrum der jedem überhaupt noch zur Verfügung stehenden Möglichkeiten basieren auf dem oftmals rein zufälligen Zusammentreffen von willkürlich kombinierten menschlichen Faktoren. Auf die Logik ist kein Verlass mehr. Aber es kann auch nicht bestritten werden, dass etwaige Dinge von Belang, die wir außerhalb unseres Privatlebens tun können, von einem bestimmten Klima abhängen, das durch diese oder jene offene Tür erst spürbar wird. Ich befürchte jedoch, dass das Wirken dieser Kräfte derzeit nur die Form eines Anführers annehmen kann, der das personifiziert, was die Leute empfinden. Sollte bewiesen werden, dass das Attentat auf Wallace mit Watergate zusammenhängt, dann gnade uns Gott! Was immer diese Personifizierung sein mag, sie wird uns wahrscheinlich nicht gefallen. Es liegt zu viel Böses in der Luft, zu viel, was Agnew und Nixon in der gequälten amerikanischen Seele nicht bereinigt haben. Aber womöglich gibt es, wie ich immer zu sagen pflege, einen gewissen Spielraum, die Ritzen zum Reißen zu bringen. Wir sollten uns allerdings davor hüten, das wirklich Neue nach den Kriterien des Alten und Vertrauten zu beurteilen. Man gerät so leicht in die Irre. Das Interessante an den New York Dolls sind ein paar neue Beulen und Risse – ein starkes Schuldgefühl, eine pauschale moralische Empörung, der Mangel an Humor. Tatsächlich erinnert das in vielerlei Hinsicht an alte Geschichten. Ich habe jedoch das Gefühl, dass sich bei einem Teil der Dinge, die wir demnächst erleben werden, der Schlüssel im Schloss möglicherweise um einen Klick weitergedreht haben wird.
Ich hatte schon viel über Bob Dylans Tournee mit der Band gelesen, bevor diese am 11. Februar in der Oakland-Coliseum-Arena Station machte, nur wenige Tage vor den Abschlusskonzerten in Los Angeles – von meiner Zeitungslektüre wusste ich alles darüber. Ich wusste ganz genau, wie die Show gegliedert war: Dylan & die Band, die Band ohne Dylan, Dylan & die Band, Pause, Dylan solo, Dylan & die Band, »Like a Rolling Stone«, Zugabe. Obwohl minimale Abwandlungen des Programms möglich waren, wusste ich, welche Songs ich zu hören bekäme, und ich kannte sogar deren Reihenfolge. Ich wusste, wie das Publikum reagieren würde: dass es bei der Zeile »Even the president of the United States sometimes must have to stand naked« völlig aus dem Häuschen geriet und dass ein paar Schwachköpfe während des Auftritts der Band »We want Dylan!« schreien würden. Ich wusste, dass gut getimtes Scheinwerferlicht das Einsatzzeichen für die Publikumsreaktion auf »Like a Rolling Stone« geben würde und dass man den Song am folgenden Tag in den Zeitungen als »eine Hymne« apostrophieren würde; ich wusste, dass die Leute im Publikum Streichhölzer anzünden würden, um die Zugabe herauszukitzeln. Das Ganze schien eine streng durchgeplante Inszenierung zu sein, die nichts dem Zufall überließ. Ich freute mich darauf, Bob Dylan stehend eine Ovation zu bereiten, wenn er von der Bühne abging, aber ich wollte verdammt sein, wenn ich irgendwelche blöden Streichhölzer anzündete!
Worauf mich die Presse jedoch nicht vorbereitet hatte, das waren der Sound, der Gesang, die Musik als solche und die Intensität des Ganzen. Ich war nicht darauf vorbereitet, »Rainy Day Women« als einen satten, lauten Chicagoblues von der Bühne purzeln zu hören. Ich war auch nicht gefasst auf den schwarzen Platzanweiser, der die Stufen des Saals hinuntertanzte, wobei er seine Taschenlampe durch die Luft schwenkte und »Knock, knock, knockin’ on heaven’s door« sang, oder auf den Wonneschauer, der mich durchfuhr, als Robbie Robertson und Rick Danko sich bei einem Refrain ein Mikrofon teilten und dabei ihre Köpfe zusammensteckten wie Paul und George in A Hard Day’s Night12. Auf die Dinge, die die Show zu etwas Besonderem machten, war ich kein bisschen vorbereitet und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch sonst niemand war.
12 Yeah! Yeah! Yeah! (Regie: Richard Lester, Großbritannien 1964).
Noch nie – nicht 1965, als sie noch die Hawks waren, nicht bei ihrem Debüt 1969 im Winterland oder bei einem halben Dutzend anderer Konzerte – habe ich die Band mit dem Feuer spielen hören, das Dylan ihr diesmal entlockte. Ich habe Zeitungsberichte gelesen, in denen ihre Anwesenheit kaum erwähnt wurde, geschweige denn die Musik, die sie machten, doch zwischen den einzelnen Sets oder am darauffolgenden Tag war die Band das, worüber sich die Leute als Erstes unterhalten wollten. Robbies Gitarrenspiel war unvergleichlich – während der zwei Shows entfaltete er eine ungezügelte Wildheit, wie er sie bei seinen sonstigen Auftritten meist nur andeutet –, doch was diesmal den Unterschied ausmachte, war der Beat.
Es war ein massives, intensiv synkopiertes KRACHEN, das zunächst alles andere übertönte. Jeder weiß, dass Levon Helm ein großartiger Drummer ist, doch diesmal spielte er wie ein Star. Er agierte unmittelbar am Puls des Rock ’n’ Roll – gelegentlich gesellte sich Richard Manuel an einem zweiten Schlagzeug hinzu, und obgleich es Spaß machte, den beiden dabei zuzuschauen, konnte ich in musikalischer Hinsicht keinen Unterschied hören. Die Autorität von Levons Beat ließ Dylan, Robbie und Garth Hudson mit einer Freiheit singen und spielen, die mit einem weniger starken Fundament bloß wie etwas Persönliches gewirkt hätte; mit der von Levon geschaffenen Grundlage war diese Freiheit zwar noch immer etwas Persönliches, zugleich aber auch etwas, was mit den anderen geteilt wurde, ein Ausdruck von Empathie und gegenseitigem Vertrauen – oben auf der Bühne, aber auch draußen im Publikum.
Nichts von dem, was die Band allein darbot, reichte an das heran, was sie gemeinsam mit Dylan zum Besten gab. Im Kontrast zur Kameradschaft der Band bietet er ein physisches Bild von absolutem Selbstvertrauen (auch wenn er ohne die Band nicht dorthin gelangt, wohin er gelangen möchte, und seine neuen Songs davon handeln, wie frustrierend es ist, auf sich allein gestellt zu sein); gegen ihre umsichtige Intelligenz setzt er sein Genie, erratisch und stets auf der Suche nach Regeln, die man brechen könnte (in ihren schlechtesten Momenten ist die Band nie so peinlich wie Dylan in den seinen und in ihren besten Momenten schreibt sie Geschichte, während er sie macht); gegen das Vergnügen, das die Mitglieder der Band beim Musikmachen empfinden (sie lächeln, er runzelt die Stirn), setzt er eine nervöse Wildheit, einen Hang zur Dramatik.
Es gibt eine Seite an der Band, die unsicher ist und die eine gewisse Scheu vor dem Publikum offenbart, eine Seite, die ihr Heil in einer Art rationalem handwerklichen Können sucht. Es ist eine emotionale Beschränkung, die Garth Hudson als Einziger ständig zu überwinden versteht, und diese ist womöglich die Quelle nicht nur der sparsamen Eleganz der besten Licks von Robbie, sondern auch der präzisen, ja sogar kargen Arrangements, die die Band auf der Bühne und auf ihren Platten verwendet. Es gibt auch eine wilde, verrückte und chaotische Seite, doch diese tritt, in ihrer Musik, nur in kurzen Augenblicken hervor: bei einem der seltenen Gitarrensoli, bei dem irren Klavierspiel, das Garth zu »The Weight« oder zu »Don’t Do It« beisteuert.
Doch das ist eine Seite der Band, die Bob Dylan fast immer weit aufbricht. Er steht im Rampenlicht und sie können nach Lust und Laune ihren Eingebungen folgen. Wenn sie mit ihm zusammen spielen, entfesseln sie eine Energie, wie sie sie bei ihren eigenen Auftritten nie an den Tag legen – doch seinen exaltierten gesanglichen Darbietungen wäre mit sorgfältig geplanten Arrangements ohnehin nicht beizukommen. Sie müssen den Beat vorgeben, sie müssen mit ihm spielen und gegen ihn, und um die Zuhörer emotional berühren zu können, müssen sie es sogar riskieren, dass der Song in sich zusammenbricht. Sie müssen Dylan den Schwung verleihen, den dieser so offenkundig verlangt, und gleichzeitig müssen sie für sich spielen.
Die Musik war also nicht sorgfältig geplant, sie war nicht ordentlich, sie war nicht elegant. Sie war wild: Sie ritt auf jenem Beat, voller schwer erkämpfter Arroganz, Liebe und Zorn. Anfangs traf einen die Musik in Gestalt von Explosionen, doch dann löste sie sich in Strukturen auf – Garths Orgel, wie sie zart über ein Solo von Robbie strich, das die reine Anarchie war, während Dylans Geheul durch beides hindurchschnitt. Und dann, wenn du dachtest, du hättest die Musik irgendwie erfasst, du hättest gehört, was sie zu sagen hatten, dann zauberten sie etwas noch Härteres aus dem Ärmel – zum Beispiel »All Along the Watchtower«.
Es war ein abgehacktes, laut grollendes Getöse: Die Band versuchte die Melodie zu packen und Dylan schrie an der Melodie vorbei. Sie ließen die offizielle, auf John Wesley Harding veröffentlichte Version – die vermutlich das Beste ist, was Dylan seit Highway 61 Revisited gemacht hat – zaghaft und schwach erscheinen, als sei Dylan 1967 unten in Nashville auf Nummer sicher gegangen. Und jetzt, sieben Jahre später, erhöhte er sogar noch den Einsatz.
Während ich das hier schreibe, höre ich, wie James und Carly »Ride with the tide, go with the flow« singen, und obwohl ich darüber froh bin, dass die beiden sich keine höheren Ziele stecken, als ihr Talent zulässt, kommt mir dieses Credo wie das genaue Gegenteil von dem vor, worum es bei Bob Dylan – oder überhaupt bei jedem Künstler – geht. Es war nicht leicht, einen Bezug zu der Musik herzustellen, die Dylan mit der Band gemeinsam machte. Wenn man in der Vergangenheit lediglich die Band gesehen hatte, eine Gruppe, bei der der Soundcheck mitunter länger dauerte als der dann folgende Auftritt, so hätte man die Ungeschliffenheit ihrer Musik damit entschuldigen können, dass sie lange nicht mehr auf Tournee gewesen und deshalb ein wenig eingerostet waren. Doch Dylans Gesang war ein Schock, der sich nicht so leicht mit »er ist müde«, »er ist eingerostet« oder »er ist distanziert« erklären ließ. Einige Autoren haben sich voller Respekt über Dylans Experimente mit Melismen geäußert – das klingt beeindruckend, was? –, doch Melisma bedeutet, Wörter zu verbiegen, und nicht, wie Dylan es tat, sie zu zerbrechen. Er stürzte sich mit aller Macht auf das letzte Wort jeder Zeile, ohne sich, wie es schien, im Geringsten darum zu scheren, was diese Wörter bedeuteten – wie ein Revolverheld ohne ein Ziel, und ein Bob Dylan ohne ein Ziel verschießt bloß Platzpatronen. Und doch hatte er ein Ziel, oder gleich mehrere: die Musik, seine Songs, das Publikum, sich selbst.
Die Musik von heute – insbesondere der gelackte, blutleere Elektra-Asylum-Folkrock, der auf das Publikum abzielt, das gekommen war, um Dylan zu hören – verfügt über eine klar definierte, stark in den Vordergrund gerückte Melodie (beim wahren Rock ’n’ Roll lässt sich die Melodie nicht vom Rhythmus und vom Beat trennen). Eine Musik dieser Art ersetzt Inspiration durch Professionalität. Dylan heulte seine Songs heraus, wobei er die Melodie attackierte, als sei sie kein Mittel, um Gefühle auszudrücken, sondern eher etwas, was ihnen im Wege stand. Anstelle von Professionalität offerierte er eine rohe Expressivität und sprengte dabei die Grenzen von Phrasierung und Stimmtechnik. Wenn er danebenschoss, schoss er daneben. Wenn er traf, trieb er seine Songs über sie selbst hinaus. Oftmals richtete er nicht seine Worte gegen das Publikum, sondern sich selbst – nicht als eine Persona, als »Bob Dylan«, sondern als eine physische Erscheinung, als Fleisch und Blut –, und anstelle der Botschaften und der Bedeutungen seiner Songs war da etwas viel Elementareres: Engagement und Kraft.
Wenn diese Shows nicht bloß ein live präsentiertes Greatest-Hits-Package sein sollten, musste Dylan eine Möglichkeit finden, den Songs ein wirklich neues Leben zu verleihen. Dylan scheint der Ansicht zu sein, dass diese Musik sich genauso wenig abnutzt wie die von Robert Johnson, die der Carter Family oder die von Little Richard, doch das zu beweisen ist wieder eine andere Sache. Nur wenn es ihm gelänge, die Songs von seiner und unserer Vergangenheit zu befreien, allerdings ohne jene Vergangenheit zu verleugnen, wären die Songs auch weiterhin in der Lage, die Musiker und das Publikum zu befreien. Die Musik musste dem Sänger entsprechen und sie musste beim Publikum ankommen.
Dylan sang aus voller Kehle, ja, er schrie, sicherlich auch, um sich gegenüber dem Lärm behaupten zu können, um sich vernehmbar zu machen, doch wenn das tatsächlich der Grund gewesen wäre, hätte er genauso gut die Verstärker leiser stellen können. Der Lärm und das Geschrei waren eins. Die Songs einfach nur auf eine geringfügig neue Weise zu präsentieren – hier eine andere Phrasierung, da eine veränderte Betonung, transponierte Introduktionen, veränderte Tempi, das alles machten er und die Band –, hätte, für sich genommen, gekünstelt gewirkt, aus der Sicht des Sänger sogar noch mehr als aus der des Publikums. So entschloss Dylan sich auf gewisse Weise, die Songs im Grunde überhaupt nicht zu singen. Es kam mir so vor, als suchte Dylan vor allem nach etwas, was seinem ursprünglichen Sound entsprach, jedoch ohne diesen kopieren zu wollen: etwas sehr Rohes, Verstörendes, Verwirrendes, etwas, was einem nicht auf Anhieb gefiel. Das klappte nicht immer. Doch die Intention war klar und die Songs, die am besten zu diesem harten Gesangsstil passten – die mit einem Beat, der stark genug war, um Dylan dazu zu zwingen, sich mit dem Rhythmus zu befassen – haben als Songs gewonnen: »Ballad of a Thin Man«, »Highway 61 Revisited« und »Maggie’s Farm«. Bei den beiden letztgenannten war Dylan eindeutig der ultimative Rock-’n’-Roll-Sänger und die Band war die definitive Rock-’n’-Roll-Band. Jeder Vergleich zwischen dieser Kombination und einer ernsthaften, talentierten Gruppe wie der Allman Brothers Band – vergiss die Songtexte! – wäre ein Witz. Das hier war Rock ’n’ Roll, der buchstäblich bis an seine Grenzen getrieben wurde.
Andere Nummern waren nicht so sehr Songs, sondern eher Vorkommnisse in einem Kampf, den der Rock ’n’ Roll – oder der Blues oder die Countrymusik – verkörpert, jedoch selten austrägt: am Leben bleiben, sich selbst und anderen die Treue bewahren, ein Leben anstreben und für ein Leben kämpfen, in welchem Humor, Zorn und Liebe nicht die Mittel sind, sondern die Ziele. Was mich fast umwarf, wieder und wieder, war die Kraft des Mannes im Zentrum dieses Kampfes; mit einer solchen Kraft in ein und demselben Raum zu weilen, gab mir das Gefühl, viel lebendiger zu sein. Das schlug sich auch in den Songs nieder: Sie wirkten stärker, als Lebenszeichen, aber auch als Kommentare zum Leben. »Er liebt diese Songs genauso sehr wie wir«, sagte die Frau neben mir.
Als Dylan zu Anfang mit Hudson, Manuel, Danko, Robertson und Helm auf die Bühne kam, erstarb der Applaus, noch ehe sie mit »Most Likely You Go Your Way and I’ll Go Mine« loslegten (»Wir meinens ernst!«, sagte dieser rasche Einstieg ins Konzert). Das Publikum (und wer kann schon sagen, aus was für Leuten es sich zusammensetzte – ich entdeckte Professoren, die mich in meinem zweiten Collegejahr unterrichtet hatten, und ich sah Studenten, die ich in deren zweitem Collegejahr unterrichtet hatte) schien hin und her gerissen zwischen Verehrung und Begeisterung, zwischen Anbetung und Zurückhaltung.
Erst als Dylan allein auf die Bühne kam, gewannen Devotion und Nostalgie die Oberhand. Wenn die Reaktion auf Dylans erste elektrische Nummern verhalten gewesen war und der Applaus für das erste, vertraute Set der Band laut und begeistert, so stellte der Jubel beim Soloauftritt Dylans alles in den Schatten, was es bis dahin gegeben hatte und was noch folgen sollte. Ein Teil des Publikums wollte sein Idol nicht mit irgendwelchen Begleitmusikern teilen (oder nur dann, wenn diese nicht mehr als das waren, doch das waren sie); manche Leute wollten die Worte hören; eine Menge Leute können den Rock ’n’ Roll noch immer nicht ausstehen, insbesondere die ungehobelte Version, die die Band ihnen servierte. Diese Leute wollten die gute alte Mundharmonikareligion und sie bejubelten Mundharmonikasolos mit der gleichen Begeisterung, mit der das übrige Rock-’n’-Roll-Amerika Schlagzeugsolos bejubelt. Sie wollten noble Gefühle, und sie wollten Feinde, die sie hassen konnten; sie wollten, dass die Vieldeutigkeit, die unser Leben in den letzten paar Jahren zunehmend geprägt hat, weggewischt wurde, und der solo auftretende Dylan konnte ihnen all das bieten. Hier unterwarf er sich den schlimmsten Erwartungen seines Publikums und erweckte die abgedroschensten Geister seiner Vergangenheit wieder zum Leben. Mehr schien das Ganze nicht zu sein – die akustischen Nummern hatten in der Regel nichts von der an den elektrischen Sets so auffälligen aggressiven Neuartigkeit, die im Grunde ein neues Zeitverständnis war. Und das ist keine Sache des Genres: »Wedding Song« klingt, als könnte es von The Freewheelin’ Bob Dylan stammen, doch das macht diese Nummer keineswegs zu einem Rückschritt.
Dylan präsentierte »The Times They Are A-Changin’« (das diesmal noch lebloser und unpersönlicher wirkte als 1964), »The Gates of Eden« (das 1965 lächerlich gewesen war und es auch heute noch ist) und »The Lonesome Death of Hattie Carroll«.
Der Titel des letztgenannten Songs impliziert, dass sich der Sänger einer Frau ohne Freunde annehmen möchte, doch der Song ist moralisch genau dort geschlossen, wo »George Jackson« offen und ein echter Versuch ist, eine Freundschaft anzuknüpfen. Ich glaube, Dylan würde heute erkennen, dass Hattie Carrolls Tod bedeutsamer war als William Zantzingers Verurteilung zu sechs Monaten Gefängnis. Doch obwohl ich dachte, dass es viel besser gewesen wäre, wenn Dylan »George Jackson« gesungen hätte, und ich dahinterzukommen versuchte, warum dieser Song nicht nur bescheidener, sondern auch wichtiger als »Hattie Carroll« zu sein schien, ahnte ich, wieso es falsch gewesen wäre, wenn Dylan den neueren Song gesungen hätte. Es hatte etwas mit Privatsphäre zu tun, einem Thema, das im Mittelpunkt so vieler neuer Dylan-Songs steht. Jackson war für Dylan ein Mensch, kein Prinzip, und weil die Platte, die Dylan aufnahm, als Jackson getötet worden war, genau das zum Ausdruck brachte, wäre es eine schamlose Verletzung der auch einem Toten zustehenden Privatsphäre gewesen, hätte Dylan den Song vor 16 000 Leuten gesungen: ein Verstoß gegen das Recht des Menschen, nicht zu einem Symbol gemacht zu werden. Hattie Carroll war ein Symbol und sie bleibt ein Symbol, als habe sie niemals gelebt. Sie starb nicht – deshalb konnte Dylan über sie singen und deshalb konnten wir unsere eigene Ablehnung der milden Strafe ihres Mörders beklatschen, und das ist alles, was der Song für sie tun kann. Nun, fast das gesamte Publikum klatschte und viele erhoben sich sogar, für Moral und Sittlichkeit, für Gerechtigkeit, für bessere Zeiten, als die Welt noch schwarz-weiß gewesen war. Es heißt, Huey Newton und Bobby Seale hätten in Oakland die Black Panther Party for Self-Defense gegründet, nachdem sie sich wieder und wieder »Mr. Tambourine Man« angehört hatten, doch an diesem Abend hätte man, wahrscheinlich in derselben Stadt, vielleicht nur wenige Kilometer von dem Ort entfernt, wo Bob Dylan auftrat, die Symbionese Liberation Army und Patty Hearst finden können – wenn man gewusst hätte, wo man suchen musste.
Die Songs, die einen packten, hatten neue Bedeutungen – als Ereignisse. Fast ausnahmslos schienen sie zu jedem im Publikum hinausgeschickt worden zu sein, um hinauszurollen und uns zu verändern und um dann wieder zurückzuhüpfen und unsere Wahrnehmung des Sängers auf der Bühne zu verändern. »Most Likely You Go Your Way and I’ll Go Mine« wurde als Dylans Unabhängigkeitserklärung präsentiert und wir bejubelten sie auch als solche (es war erneut sehr belebend, zu hören, wie jemand ein dermaßen starkes Statement abgab), doch die Performance bot auch Raum für uns. »Ballad of a Thin Man« – ich hatte Dylan den Song schon früher singen sehen und ich wusste, wer Mr. Jones war: jeder, der nicht so cool war, sich eine Eintrittskarte für ein Bob-Dylan-Konzert zu kaufen, die Folkies, die sich die Seele aus dem Leib buhten, die anderen. An diesem Abend bezweifelte ich kein bisschen, dass ich Mr. Jones war, dass dieses Bild problemlos jeden um mich herum einbezog, dass Dylan viel von der Wut und der Verachtung des Songs auch gegen sich selbst richtete. Hier passte der neue Stil perfekt – Dylan, wie er »MISTER JO-HONES!« brüllte und Jerry-Lee-Lewis-Riffs in die Tasten hämmerte –, und wenn der Song jemanden verurteilte, dann nicht diejenigen, die nicht Bescheid wussten, sondern diejenigen, die nicht lernen wollten. Als er »Wedding Song« sang, schien das nicht bloß eine Huldigung an seine Ehefrau zu sein (wäre das alles, wieso sollte er es dann anderen zu Gehör bringen?), sondern eine Herausforderung, mit der Sorte von Extremen zu leben, die durch Wörter wie »blood«, »sacrifice«, »knife« und »kill« vermittelt werden müssen. Selbst im Kontext von Dylans Privatleben schien der Song weniger ein Sieg zu sein, den man beansprucht, als vielmehr ein Ziel, das man anstrebt, und diese Stimmung war vielleicht das, was den Kern der Show ausmachte. Als ich mir von jemandem ein Fernglas auslieh und mir Dylans Gesicht anschaute, war klar zu erkennen, dass ihm seine Arbeit nicht leichtfiel, und die Intensität in seinem Gesicht war einfach atemberaubend.
Ich habe es mehr oder weniger aufgegeben, Dylans Karriere im Sinne einer Weiterentwicklung verstehen zu wollen, nach einem Standpunkt zu suchen, der sich von Jahr zu Jahr verfeinert, der wächst oder sich verflüchtigt, oder einen Stil zu verfolgen, wie er sich mit unserer im Wandel begriffenen Welt auseinandersetzt. All das ist zweifellos vorhanden, aber irgendwie ist es nicht sehr interessant. Was mir im Gedächtnis haften bleibt, ist eine Handvoll Songs – »All Along the Watchtower«, »Down the Highway«, »Bob Dylan’s Dream«, »Highway 61 Revisited« – und der Eindruck, wie hart, wie unerbittlich sie sind. Der Rest rauscht momentan einfach an mir vorbei, so wie bei den Shows in Oakland. Auf Planet Waves befindet sich vieles, was mich nicht berührt und was mich womöglich niemals berühren wird, doch »Wedding Song« bildet dabei eine Ausnahme: Für mich klingt dieser Song wie der wahre Abschluss von John Wesley Harding, ja, im Grunde klingt er nach nichts anderem. Falls es sich lohnt, nach der Bedeutung von Dylans Performance zu fragen – und für gewöhnlich lohnt es sich bei so etwas, nach allem zu fragen –, so sollte das dazugehören.
Ein Mann zieht in die Welt hinaus; er verirrt sich in ihren Fallen und wird von ihren Vergnügungen verführt. Sofern er ein Dummkopf ist, nimmt er sich fest vor, keiner zu bleiben; er versucht, die Zeichen zu lesen, die Gott und der Teufel überall in der Welt hinterlassen haben, und er entwickelt nach und nach eine moralische Einstellung. Er fällt Entscheidungen und leidet unter ihnen und er wird stärker und zugleich wachsamer. Er versucht, das, was er gelernt hat, an die Leute weiterzureichen, merkt jedoch, dass sie nicht richtig hinhören; aber ob sie es tun oder nicht, er hat zumindest versucht, ihnen die Wahrheit zu sagen. Am Ende kehrt er nach Hause zurück und lernt seine zukünftige Frau kennen, unten an der kleinen Bucht, und die zwei ziehen los, um sich einen Drink zu genehmigen, miteinander zu schlafen, sich ein wenig auszuruhen. Er hat schwer gearbeitet und er hat sich seine Belohnung verdient. Das ist, jedenfalls für mich, die Geschichte, die das Album John Wesley Harding erzählt, die Geschichte, an der Dylan seit jener Zeit gearbeitet hat, eine Geschichte, die er nun offenbar in einem einzigen Song zusammengefasst hat.
»Wedding Song« bringt zum Ausdruck, dass all die Kämpfe, die es in der Welt gibt, auch in der Belohnung präsent sind; der Kampf verlagert sich lediglich auf eine andere Ebene. Ich denke, dass Dylan auf Planet Waves so ein Gefühl von Kampf und Belohnung rüberbringen wollte und dass ihm das nicht gelungen ist, weil er sich zu lange aus der Welt ausgeklinkt hat und die Songs zu persönlich bleiben. Eine Strophe von »Wedding Song« scheint zu behaupten, ein Mensch müsse die Welt zurückweisen, um sich seinem privaten Kampf widmen zu können (bezeichnenderweise singt Dylan die Zeile »’Cause I love you more than all of that« mit einer solchen Anmut, dass er einen glauben machen kann, man müsse der Welt ganz und gar entsagen); im Vergleich zu all den anderen Lovesongs von Planet Waves kann der letzte in diesem Kerker verharren. Doch wenn »Wedding Song« die Geschichte von John Wesley Harding tatsächlich vervollständigt und man es auf diese Weise hört, so könnte man daraus lernen, dass der Kampf in der Welt den Kampf zu Hause nur noch vertieft – dass, auf eine rätselhafte Weise, jeder dieser Kämpfe den anderen rechtfertigt.
Seit der Fertigstellung von Planet Waves ist Dylan kreuz und quer durch die USA und Kanada getourt. Es ist schwer zu glauben, dass die kraftvollen Performances, die er dabei ablieferte, nur ein Vorspiel zu einem erneuten Rückzug sein könnten; es ist unmöglich zu glauben, dass die Kraft, die ihm das Publikum gespendet hat, nicht Eingang in neue Songs finden wird, die genauso stark sein werden wie die, die er von der Bühne abgefeuert hat. Elliott Murphy, der ebenfalls unter all den anderen im Publikum war, erzählt eine Geschichte, die dem Einsatz, den Bob Dylan bei dieser Tournee bringt, meiner Ansicht nach einen Sinn verleiht: »Als ich bei Polydor untergekommen war, gingen wir rüber nach Kalifornien, um ein Album aufzunehmen, mit Leon Russell am Klavier, Jim Gordon am Schlagzeug und Dr. John an der Orgel. Ich war also da drüben und das Ganze lief überhaupt nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Eines Abends saß ich mit meinem Bruder in einem Restaurant, um einen Happen zu essen. Ich war total frustriert wegen der Art und Weise, wie sich das Album entwickelte, und ich befürchtete, am Ende würde ich mich selbst nicht mehr wiedererkennen. Plötzlich zeigt mein Bruder mit dem Finger über unseren Tisch und sein Gesicht wird käseweiß. Die Sitzbänke in diesem Restaurant waren so angeordnet, dass man mit den anderen Leuten fast Rücken an Rücken saß. Ich drehte mich um und schaute in die Richtung, in die er zeigte, und genau in diesem Moment drehte sich der Typ in meinem Rücken ebenfalls um und meine Nasenspitze berührte fast die von Bob Dylan! Das gab mir irgendwie Kraft und ich ging ins Studio und teilte dem Produzenten mit, dass er das alles vergessen könne. Ich kehrte nach New York zurück und dort machten wir es dann richtig.«
Dylan braucht, so wie Murphy oder wie wir alle, andere Menschen, von denen er Kraft beziehen kann, die ihn inspirieren können und mit denen er sich auseinandersetzen kann. Diesmal kam Dylan zu uns und das sollte uns nicht gleichgültig sein.
Planet Waves (Asylum, 1974).