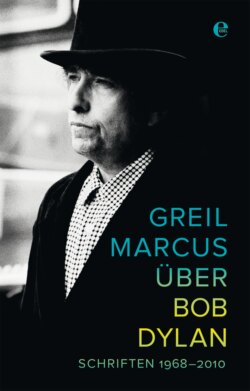Читать книгу Über Bob Dylan - Greil Marcus - Страница 19
ОглавлениеLike a Moving Stone, mehr oder weniger
New West
18. Dezember 1978
Bob Dylan ist mit seiner neuen Show auf etwas aus – mit der Big Band, den drei Backgroundsängerinnen, dem theatralischen Gesang, dem Nachtclubgebaren und den offenbar einstudierten Gesten –, und was immer dies sein mag, es scheint ihm schon lange im Kopf herumgegeistert zu sein. 1969, als Dylan bereits seit über drei Jahren nicht mehr auf Tournee gewesen war (und erst fünf Jahre später wieder damit beginnen sollte), fragte ihn Jann Wenner vom Rolling Stone nach seinen diesbezüglichen Plänen. Dylan, der dieser Frage vermutlich ausweichen wollte, versprach, er werde schon bald wieder ins Rampenlicht zurückkehren. Und anschließend kam es zu folgendem merkwürdigen Dialog:
WENNER: Schwebt dir schon eine bestimmte Art von musikalischer Begleitung vor?
DYLAN: Na ja, ich denke, wir werden das Ganze ziemlich simpel halten, verstehst du? … Schlagzeug … Bass … ’ne zweite Gitarre … Orgel … Klavier. Vielleicht ein paar Bläser. Und vielleicht ein paar Backgroundsängerinnen.
WENNER (offensichtlich perplex): Mädels? So was wie die Raylettes?
DYLAN: Ja, wir könnten ein paar Mädels einbeziehen.
Damals, unmittelbar nach der Veröffentlichung von John Wesley Harding und Nashville Skyline, zwei Alben, die den Begriff »simpel« etwas anders definierten, musste einem Dylans Vorstellung von einer angemessenen Begleitung wie ein Scherz vorkommen, als wollte er auf diese Weise sagen: Komm, geh mir nicht auf den Sack, Alter! Woher soll ich wissen, was ich auf der Bühne veranstalten werde, wenn ich nicht die leiseste Absicht habe, mich auf einer blicken zu lassen? Als Dylan 1974 schließlich wieder auf Tournee ging, ließ er sich von der Band begleiten, so wie schon 1965 und 1966 – keine Spur von irgendwelchen Mädels. Seine größten Hits über die Köpfe der Menge brüllend, hätte er kaum isolierter sein können: Die Legende bewegte sich, doch sie sprach nicht und sie lächelte auch nicht.
Als er in diesem November für zwei nicht ganz ausverkaufte Konzerte in der Oakland-Coliseum-Arena erschien, auf einer Woge von schlechter Presse, da wollte Dylan offenkundig den Beweis antreten, dass sein neuer Act kein Witz war. »In den Zeitungen steht, das hier sei ›showbizzy‹ oder ›disco‹«, grummelte er gegen Ende des zweieinhalbstündigen Konzerts, das ich mir ansah, »aber ihr wisst, dass das nicht wahr ist.« Teilweise war die Musik schauderhaft und manchmal war sie langweilig, doch es gab auch Momente von echter Kraft und Dylans Auftritt nahm mich gefangen, auch wenn sein Gesang so schlecht war wie noch nie.
Die Show ist schon gewöhnungsbedürftig. Es sind fast ein Dutzend Leute auf der Bühne und manche davon scheinen mitunter nicht zu wissen, was sie tun sollen; die Bühnenbeleuchtung verändert sich ständig. Die Musik hat keinen Körper. Dylan erwähnte einmal voller Stolz, dass sein Saxofonist, Steve Douglas, mit Phil Spector zusammengearbeitet habe; erst als ich mich zu fragen begann, warum alles, was Douglas spielte, so fürchterlich einfallslos war, fiel mir wieder ein, dass Spector Saxofonsolos ausschließlich als Füllmaterial verwendete. Während Dylan seine bekanntesten Songs radikal aufpolierte und sie dadurch erfolgreich vor jeglicher Nostalgie bewahrte – er sang viele seiner größten Hits, doch sie kamen nicht als solche rüber –, hielt sich die Begleitband fast immer sklavisch an ihre Arrangements. Der Musik fehlte der Biss – etwas, was bei Dylans Konzerten bislang selten der Fall gewesen ist; die Grenzen waren allesamt im Voraus abgesteckt.
Vielleicht war das auch der Grund dafür, dass Dylan sich auf der Bühne so zu Hause zu fühlen schien, wie ich es vorher bei ihm noch nie erlebt hatte. Lakonisch; sich ans Mikrofon klammernd auf die Art, wie Sinatra sich einst an einen Laternenpfahl lehnte; kämpferisch; ungelenk, aber dennoch ungeniert tanzend – ständig vermittelte er den Eindruck eines schwer erarbeiteten Vergnügens. Am Schluss des Konzerts strahlte er über das ganze Gesicht, wie eine Filmdiva der Vierzigerjahre bei einer Premiere, und in diesem Moment konnte man förmlich spüren, wie sich seine Anspannung legte – die Anspannung einer aufwühlenden Big-Band-Version von »It’s Alright, Ma (I’m Only Bleeding)«, die Anspannung seiner rätselhaften Karriere. Ich musste lauthals lachen.
Dylan ist einem Großteil des Drucks, der auf legendären Gestalten lastet, entkommen und im Unterschied zu Elvis, dem das nur mittels Parodie gelungen ist, hat er das geschafft, ohne seine Musik zu diskreditieren. Worauf er möglicherweise aus ist, was ihm möglicherweise all die Jahre durch den Kopf gegeistert ist, das ist ein leidenschaftliches Verlangen nach jener Art von Melodrama, die das Markenzeichen der großen Soul- und Countrystars ist: eine Show, die – da Dylan keine Show benötigt, um uns seinen Status zu demonstrieren – paradoxerweise groß genug ist, um ihn auf ein normales Maß herunterzubringen. Die verblüffendste Nummer des Konzerts war eine langsame, intime Version von »Tangled Up in Blue«, einer langen, biografischen (aber nur auf archetypische Weise autobiografischen) Erzählung, die er fast schon szenisch darstellte, wobei er den Song mit einer Lockerheit und Umgänglichkeit präsentierte, wie er sie auf der Bühne vorher noch nie gezeigt hatte. Der Song, einer der Höhepunkte von Blood on the Tracks, schien sich auszudehnen: Er schien so viel reichhaltiger, so viel interessanter, dass ich mich weiter vorbeugte, aus Angst, auch nur ein einziges Wort davon zu verpassen. Es mag sein, dass diese Art von Intimität für Dylan nur in einer Show möglich ist, in der er sich verlieren kann – in einer Show, die so unwahrscheinlich, so aufwendig ist, dass sie nicht den Erwartungen entspricht, mit denen sein vorwiegend der weißen Mittelschicht entstammendes (mit dem äußeren Drum und Dran der Auftritte von James Brown oder Tammy Wynette kaum vertrautes) Publikum zu seinen Konzerten kommt. Das Resultat, für Dylan, ist ein neuer Spielraum: ein Spielraum, der Ausgelassenheit, trashigen Glamour und Entertainment um des Entertainments willen zulässt und der das Drama von Leben und Tod aussperrt.
In so einem Kontext gibt es keine Imagespielchen und auch keine Mystifikation. Mit seinen Anleihen bei Neil Diamonds Stil (oder, vielleicht noch zutreffender, dem von Bette Midler) nimmt Dylan uns nicht einfach bloß auf den Arm. Er schielt auch nicht nach einer neuen Karriere in Las Vegas, obwohl es mich nicht wundern würde, falls er schon bald dort aufkreuzte, wenn auch nur, um herauszufinden, ob er dort mit seiner Show landen könnte. Sieht man Dylan heute auf der Bühne, so sieht man die Narreteien eines Bohemiens in Disneyland. Dylan findet Vergnügen daran, dass er Aspekte der amerikanischen Kultur genießen kann, die ihm fremd vorgekommen sein müssen, auch wenn er keinen Grund sieht, derlei Dinge mit hundertprozentiger Exaktheit in seinen Stil zu integrieren. Wie mit seinem Timing während eines Großteils seines Gesangs liegt Dylan auch mit seinen Showbizgesten um einiges daneben; es sind nach wie vor seine Gesten und, bei näherer Betrachtung, keine Imitation eines anderen. Bob Dylan ist im Laufe der Jahre vieles gewesen, doch ein wirklich guter Purist war er nie.
Bob Dylan, At Budokan (Columbia, 1979). Auf Schallplatte, als bloßes Hörerlebnis, eine Apotheose dessen, was Tom Kipp als Schlamm bezeichnet: musikalische Klischees als ihre eigene, in sich geschlossene, durch und durch selbstreferenzielle Sprache.