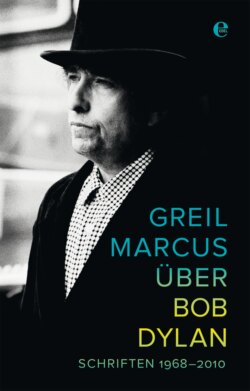Читать книгу Über Bob Dylan - Greil Marcus - Страница 18
ОглавлениеStreet Legal
Rolling Stone
24. August 1978
So sehr es mich auch betrübt, ich kann mich der Meinung meines Kollegen Dave Marsh nicht anschließen, denn im Unterschied zu ihm finde ich nicht, dass Bob Dylans neues Album ein Witz ist – oder wenn doch, dann allenfalls ein schlechter. Das meiste Zeug auf dieser Scheibe entspricht in etwa dem, was man im Rundfunk als Tonausfall bezeichnet. Das Neue an der Musik – ein Bob Marleys I-Threes nachempfundener souliger Backgroundgesang, Funkriffs von der Begleitband, jede Menge lakonischer Saxofonbeiträge – löst sich in Luft auf, sobald man bemerkt, mit welcher Gleichgültigkeit das Ganze heruntergerissen wird: »Señor (Tales of Yankee Power)«, die musikalisch auffälligste Nummer, ist im Grunde nur ein Pastiche aus den besten Momenten des Eagles-Albums Hotel California. Trotzdem nehme ich einige der Songs auf Street Legal für bare Münze: diejenigen, die zu schlecht sind, um nicht in vollem Ernst eingespielt worden zu sein. Dylan mag einmal einen Kipplader benötigt haben, um seinen Kopf leer zu kriegen, doch es bedarf eines Geigerzählers, um eine Spur von Ironie in »Is Your Love in Vain?« oder so etwas wie Zuneigung in »Baby Stop Crying« zu entdecken.
Beides sind erbärmliche Darbietungen, doch »Is Your Love in Vain?« schlägt dem Fass den Boden aus: Verglichen mit der Pose, die Dylan hier einnimmt, erkundet Mick Jagger in »Under My Thumb« die Ursprünge der Demut. Nicht dass es in dem Song eine Schärfe gäbe, wie man sie aus »On the Road Again« oder »Don’t Think Twice« kennt, zwei anderen Nummern, in denen eine Frau bekommt, was sie nach Ansicht des Sängers verdient hat. Dafür ist hier der Abstand zu groß – der Abstand zwischen einem Ich und seinem Objekt. Der Mann spricht zu der Frau wie ein Sultan, der eine vielversprechende Dienerin auf Geschlechtskrankheiten untersucht, und sein Tonfall ist dazu angetan, sie die Syph vortäuschen zu lassen, falls sie ihm dadurch unversehrt entkommen kann. Wenn der Sänger nach einer Reihe von typisch männlichen Vorwürfen (die im Grunde auf Bist du gut genug für mich? Ich bin nämlich ein heißer Typ, verstehst du? hinauslaufen) schließlich seine Konzessionsbereitschaft signalisiert (»Alright, I’ll take a chance, I will fall in love with you« – eine eigenartige Vorstellung vom Sichverlieben), dann kann man beinahe sehen, wie das arme Mädchen in Richtung Tür verschwindet. »Can you cook and sew, make flowers grow?«, artikuliert der Mann überdeutlich, wobei er offenbar auf hirnrissige Weise von einer Hausfrau zu Mutter Natur springt, doch in Wahrheit reimt er hier nur. Und dann kommt der Hammer: »Can you understand my pain?« Frauen in ganz Amerika werden sicher sagen, was eine Freundin von mir sagte: »Ja, klar, Bob. Ruf mich irgendwann an. Und wenn ich nicht zu Hause bin, hinterlass einfach eine Nachricht auf meinem AB.« Wie es sich so trifft, ist »Is Your Love in Vain?« ein Höhepunkt von Street Legal – oder zumindest der emotional überzeugendste Track des Albums, ungelogen!
Ach, aber der Gesang! Der Gesang, der auf anderen Platten Textzeilen gerettet hat, die fast genauso grässlich waren wie die gerade zitierten – was ist mit dem Gesang? Nun, Bob Dylan hat schon alberner geklungen als auf Street Legal (wer könnte »Big Yellow Taxi« vergessen?), peinlicher (»The Boxer«) und genauso desinteressiert (»Let It Be Me«), aber er hat noch nie so unecht geklungen wie hier. Obgleich das hin und wieder mit einer gewissen Verspieltheit kombiniert wird (»Changing of the Guards«), ist der Gesang bei »Baby Stop Crying« so affektiert, so unerträglich selbstgefällig, dass der einzige Bezugspunkt diese nicht enden wollenden, gesprochenen Intros sind, wie Barry White sie vor ein paar Jahren zum Besten gab: eine Imitation von Zuwendung, die vor Verlogenheit triefte. Dave Marsh hat recht, wenn er meint, auf Street Legal gebe es Anklänge an Elvis – »Is Your Love in Vain?« spielt mit der Melodie von »Can’t Help Falling in Love«, bevor es sich in »Here Comes the Bride« verwandelt –, doch selbst »(There’s) No Room to Rhumba in a Sports Car« war nicht so gruselig.
Obwohl der überwiegende Teil des Gesangs auf Street Legal – zum Beispiel die Verkündigungen (»Loyalty, unity / Epitome, rigidity«) von »No Time to Think« – keinen vergleichbaren Grusel verbreitet, kann man ihm nie länger als nur ein paar Minuten zuhören. Wie kann das sein, wo Dylan sich doch immer wieder – insbesondere in jenen Zeiten, wie etwa vor der Veröffentlichung von Blood on the Tracks, als ihn nicht nur seine Kritiker, sondern auch seine Fans abgeschrieben hatten – als der ausdrucksstärkste und einfallsreichste Sänger in der amerikanischen Musik erwiesen hat? Ich kenne die Antwort nicht; dass es ihn einfach nicht juckt, ob seine Platte gut genug für sein Publikum ist, könnte ein wesentlicher Teil des Problems sein. Aber ich glaube auch, dass der Stress der fast pausenlosen Tourneen, die Dylan seit 1974 unternommen hat (das viele raue Gebrüll in großen Hallen, das viele schroffe Geschrei, um die Band zu übertönen), nicht nur einen neuen Gesangsstil hervorgebracht hat: Er hat außerdem noch Dylans Timing zerstört und seine Fähigkeit, einem Text emotionale Präzision zu verleihen. In dem Gesangsstil, dessen Dylan sich derzeit bedient, ist Gefühl durch Manierismus ersetzt worden und Subtilität durch ein angestrengtes Bemühen, sich Gehör zu verschaffen.
Seine sich einzelne Wörter herauspickende Betonung ist offenkundig total beliebig, wenn sie nicht sogar purer Blödsinn ist, und deshalb kommen die guten Textzeilen nicht besser rüber als die schlechten. Dylan hat schon immer irgendwelche belanglosen Zeilen zu Papier gebracht, die ein Mittel zum Zweck waren, eine unerlässliche Vorbereitung für die Zeile, die ihm wirklich am Herzen lag, doch wenn er sang, dann rotzte er die Nullachtfünfzehn-Zeilen heraus und begrub sie, um dann mit aller Macht zurückzukehren. Was er mit derlei Zeilen tatsächlich aufbaute, war ein Hinterhalt für den ahnungslosen Zuhörer – »Like a Rolling Stone« ist dafür ein Paradebeispiel. Eine solche Dynamik gibt es hier nicht. Da der Gesang kein oder nur wenig Rhythmusgefühl aufweist, kann der Zuhörer keinen Bezug zu der Musik herstellen: Sie wird entweder zu einem Störfaktor oder man hört auf, sie überhaupt zur Kenntnis zu nehmen.
Es hat früher schon schlechte Dylan-Alben gegeben – doch Self Portrait entschädigte einen mit »Copper Kettle«, New Morning mit »Sign on the Window« und »Went to See the Gypsy«, Planet Waves mit »Wedding Song« und Desire mit »Sara«. Der Kollaps von Dylans Timing sorgt dafür, dass Street Legal keine vergleichbaren Perlen zu bieten hat. Timing kann einem durchschnittlichen Songtext Genialität und einem holperigen Arrangement Magie verleihen; niemand, der gehört hat, wie lässig Dylan das erste »Alright« in »Sitting on a Barbed Wire Fence« zerdehnt oder wie er die Hawks 1966 in Manchester durch »Baby Let Me Follow You Down« peitscht, wird dies bezweifeln. Auf »Get Your Rocks Off«, einer unveröffentlichten Nummer der Basement Tapes, lacht er sogar im Takt – oder er sorgt dafür, dass sich der Rhythmus um dieses Lachen herum neu aufbaut. Hier gibt es die einzige Andeutung eines guten Gesangs in den ersten vier Strophen von »New Pony« – und dabei handelt es sich um die Sorte von Blues, die Dylan im Schlaf singen kann, was er hier vermutlich auch tut.
Das Interessanteste – falls das das richtige Wort ist – an Street Legal sind die Songtexte, die oftmals an die vermeintliche Unergründlichkeit von Dylans Alben aus den Mittsechzigerjahren anzuknüpfen versuchen, jenen Alben, auf denen seine Reputation nach wie vor beruht. Doch diese Rückbesinnung ist nicht echt. Womöglich wusste man nicht, warum Dylan in »Memphis Blues Again« von einem »Panamanian moon« sang, doch man wusste, was »Your debutante just knows what you need / But I know what you want« bedeutete, und es bedeutete eine ganze Menge. In dem Street-Legal-Track »Señor (Tales of Yankee Power)« – der eingeklammerte Teil des Songtitels dürfte der inspirierendste Aspekt des gesamten Albums sein – ist »Well, the last thing I remember / Before I stripped and kneeled / Was that trainload of fools / Bogged down in a magnetic field« nichts weiter als eine Geste, nur ein Winken in Richtung der Fans. Nicht dass die Wirkung dieser Zeilen nicht wehtun kann: Es fällt schwer, die älteren Songs nun nicht im Licht der neuen, ihnen scheinbar ähnelnden Nummern zu hören und nicht zu dem Schluss zu gelangen, dass »Absolutely Sweet Marie« und »Highway 61 Revisited« im Grunde genauso hohl sind wie »Where Are You Tonight? (Journey Through Dark Heat)«, auch wenn das nicht einmal ansatzweise der Wahrheit entspricht.
Also, wenn mir nach einem Witz zumute ist, dann höre ich mir Steve Martin an, wie er »King Tut« singt. Die Zeile »He gave his life for tourism« ist echt köstlich.20
20 Jann Wenner, der damalige Chefredakteur und Herausgeber des Rolling Stone, stimmte mit meiner Besprechung nicht überein und beschloss, seine eigene zu schreiben. Als diese dann in der übernächsten Ausgabe erschien, glaubten viele Leute, ein Redakteur sei seinem Rezensenten in den Rücken gefallen, doch nichts könnte falscher sein als das: Ich ermunterte Jann dazu, seine eigene Meinung in seiner Zeitschrift (wie wir sie zu jener Zeit nannten) zu publizieren; ich war ebenso sehr sein Redakteur, wie er meiner war.
Street Legal (Columbia, 1978).
Steve Martin and the Toot Uncommons, »King Tut« (Warner Bros., 1978).