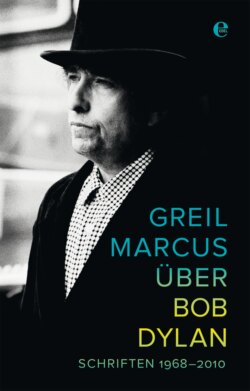Читать книгу Über Bob Dylan - Greil Marcus - Страница 17
ОглавлениеSave the Last Waltz for Me
New West
22. Mai 1978
Martin Scorsese wohnt in den Hügeln von Hollywood. Sein Haus gibt sich auf der Stelle als das Domizil eines Filmemachers zu erkennen; abgesehen von einem kleinen katholischen Triptychon sind Filmplakate die einzige Form von visueller Kunst, die es dort gibt. Sie beherrschen fast jeden Raum und berücksichtigen alle möglichen Genres: pseudokünstlerische deutsche Collagen für Mean Streets16, ein Plakat für Rebel Without a Cause17, ein urkomisches, dekadentes Tableau aus Stewart Grangers vergessenem Saraband for Dead Lovers18, eine große Anzeige, auf der Gary Cooper demonstriert, wie man zwei Pistolen gleichzeitig abfeuert, ohne Paulette Goddard fallen zu lassen. Doch an diesem Abend – unmittelbar nach der ersten richtigen Vorführung von The Last Waltz, Scorseses Film über das große Abschiedskonzert der Band am Thanksgivingabend 1976 in San Francisco – dreht sich unser Gespräch einzig und allein um Rock ’n’ Roll.
16 Hexenkessel (Regie: Martin Scorsese, USA 1973).
17 … denn sie wissen nicht, was sie tun (Regie: Nicholas Ray, USA 1955).
18 Königsliebe (Regie: Basil Dearden, Großbritannien 1948).
The Last Waltz ist der mit Abstand beste Konzertfilm, den ich jemals gesehen habe; auf gewisse Weise ist er viel besser als das Konzert selbst. Ich bin nicht restlos zufrieden; Garth Hudson bleibt, wie schon seit so vielen Jahren, fast unsichtbar und die Tonmischung schenkt seiner Musik nicht die Aufmerksamkeit, die ihr gebührt. Richard Manuel bekommt auf der Leinwand nicht den Raum, den er verdient, und sein Klavier ist oft schwer zu hören. Doch die Eindringlichkeit des Films lässt solche Einwände auf der Stelle verblassen, ja, sie brennt sie regelrecht weg.
Der Film ist zunächst einmal eine Aneinanderreihung von musikalischen Darbietungen: The Band als The Band, und The Band mit einer Reihe von Stars, bei denen es sich um Freunde, Mentoren und Weggefährten handelt. Das Ganze ist durchsetzt von kurzen Ausschnitten aus Gesprächen mit der Band, einem, wenn man so will, zwanglosen Meditieren über die sechzehn Jahre, die die fünf Männer gemeinsam als Rock ’n’ Roller unterwegs gewesen sind: Es begann 1959 in Toronto und es ging weiter als Ronnie Hawkins’ Kneipenband The Hawks, bis sie schließlich, fast zehn Jahre später, als eigenständige Gruppe auf den Plan traten, mit Music from Big Pink und The Band – ihren ersten beiden Alben, die die Band noch immer definieren, mögen sie danach auch noch so viele Alben herausgebracht ha-ben.
Es ist eine lange Geschichte und eine gute, doch in Scorseses Haus fällt kaum ein Wort über The Last Waltz. Ich will unbedingt alles darüber erfahren und Scorsese und Robbie Robertson, der den Film produziert hat, wollen ihm unbedingt entkommen. Scorsese hat Astral Weeks aufgelegt und wir hören einfach zu. Es ist ein Album der Transzendenz: der Transzendenz von Kindheitsängsten, von Erwachsenensünden. »Madame George« beginnt – »Das ist der Song«, murmelt Scorsese. Ich kann nicht umhin, ihm zu erzählen, dass er meine absolute Lieblingsplatte ausgewählt hat, doch er ist mir ein gehöriges Stück voraus. »Die ersten fünfzehn Minuten von Taxi Driver basieren auf Astral Weeks«, sagt Scorsese, »und das ist ein Film über einen Typen, der Musik hasst.« Ich versuche, mir auf die Schnelle diese oder jene Szene des Films zu vergegenwärtigen, um herauszubekommen, was Scorsese damit meint; er muss sich auf die Atmosphäre des Verhängnisvollen oder jedenfalls des Schicksalhaften beziehen, die Morrison auf diesem Album heraufbeschwört.
Scorsese zieht ein Ray-Charles-Album aus dem Plattenregal; der Song, den er uns vorspielen möchte, ist »What Would I Do Without You«, eine Aufnahme von 1957. Es handelt sich um eine langsame, tragische Bluesballade; im Text gibt es die Andeutung der Möglichkeit eines Happy Ends, oder zumindest einer gütlichen Einigung, doch in Ray Charles’ Gesang ist nichts davon zu spüren. »Mit Ausnahme einiger Nummern von Billie Holiday steckt in dieser Musik mehr Heroin als in allem, was du jemals zu hören bekommen wirst«, sagt Robertson. »Heroin wirkt sich auf deine Kehle aus. Es macht deine Stimme voller. Hört genau hin!« Wir tun es; der Titel des Songs bekommt eine neue, beißende Bedeutung. »Wir haben ›What Would I Do Without You‹ bei unseren Gigs gespielt«, sagt Robertson, »nachdem wir Ronnie verlassen hatten, als wir nur noch wir fünf waren, also vor Bob, vor Big Pink. Doch wir haben damit nicht landen können. Der Song war einfach zu depressiv. Er war tödlich. Ja, genau das ist er. Die Leute saßen reglos da, oder sie standen auf und gingen.«
Ich kannte den Song nicht, ja, hatte noch nicht einmal von ihm gehört, und fragte Scorsese, wie er auf ihn gekommen sei. »Es ist die B-Seite von ›Hallelujah, I Love Her So‹«, sagt er. »Den Song habe ich im Radio gehört, in der Sendung von Alan Freed.« 1957 wuchs Scorsese in New Yorks Little Italy auf und Alan Freed, der einzige Diskjockey, der als ein Begründer des Rock ’n’ Roll tituliert werden kann, beherrschte damals die New Yorker Ätherwellen. Der Soundtrack, den Freed zu Scorseses Leben beisteuerte, tauchte später wieder auf als der Soundtrack von Mean Streets. »Ich kaufte mir ›Hallelujah, I Love Her So‹, doch die B-Seite gefiel mir dann viel besser; ich erwarb die 78er. Ich habe sie noch immer. Hier, in meinem Haus.«
Ich erwähne American Hot Wax19, den kürzlich herausgekommenen Spielfilm über Alan Freed, doch Scorsese und Robertson wollen nichts darüber hören. Für sie war Freed eine reale Person, ein Gigant – Robertson, der in Ontario lebte, hörte Freeds ursprünglich aus Cleveland übertragene Radiosendung bis 1954, als Freed nach New York übersiedelte. Für mich, einen Kalifornier, der außerhalb des Frequenzbereichs von Freeds Sender lebte, war er, auch noch lange nach seinem Tod im Jahr 1965, nichts weiter als ein Name, der in den Zeitungen erwähnt wurde, als die Payola-Skandale landesweit für Aufsehen sorgten. Im Unterschied zu Scorsese und Robertson macht es mir nichts aus, dass Freeds Leben in einen Mythos verwandelt wurde – doch aus ihrer Sicht ist es ihr eigenes Leben, das da oben über die American-Hot-Wax-Leinwand flimmert.
19 Regie: Floyd Mutrux, USA 1978.
»Alan Freed hat mit mir gesprochen«, sagt Robertson, als könne er es noch immer nicht fassen. »Wir haben in seiner Show gespielt. Der Einzige, der nach Ronnie Hawkins and the Hawks auftreten konnte, war Jackie Wilson. Alan Freed liebte Ronnie Hawkins.« Ich bin verblüfft. Ich wusste, dass die Hawks beziehungsweise die Band schon sehr lange im Musikbusiness unterwegs waren, doch ich hätte nie gedacht, dass sie ihre ersten Schritte mitten im Zentrum der Rock-’n’-Roll-Geschichte gemacht hatten, denn genau das waren die Shows gewesen, die Freed damals veranstaltete. Ich versuche mir vorzustellen, wie Levon Helm und Robertson, die ersten Mitglieder der späteren Band, die sich Hawkins anschlossen, auf ein und derselben Bühne auftraten wie Jackie Wilson.
»He, du bist doch noch minderjährig«, sagte Freed 1959 zu Robertson. »Wie alt bist du?« »Sechzehn«, erwiderte Robertson. »Nie im Leben!«, sagte Freed – der sicherlich befürchtete, er könnte sich zusätzlich zu seinem in Boston anhängigen Verfahren wegen Anstiftung zum Aufruhr (»Die Cops wollen nicht, dass ihr euch amüsiert«, hatte Freed von der Bühne aus gesagt, nachdem die Polizei die Saalbeleuchtung eingeschaltet hatte) auch noch eine Anklage wegen der Verletzung des Kinderarbeitsschutzgesetzes einhandeln. Wenn Sie American Hot Wax gesehen haben, dann stellen Sie sich Helm und Robertson vor, in Anzügen, mit schmalen Krawatten und kurzen Haaren, wie sie, dicht zusammengedrängt mit den anderen Musikern, in den Kulissen des Brooklyn Paramount stehen und sich innerlich einstimmen auf ein Publikum aus New Yorker Kids wie Martin Scorsese – wie sie sich unbewusst darauf vorbereiten, »The Weight« zu schreiben und zu singen.
Die Prämisse des Last-Waltz-Konzerts – von Bill Graham im Winterland veranstaltet, wo dieser siebeneinhalb Jahre zuvor nach der Veröffentlichung von Big Pink auch das Debütkonzert der Band auf die Beine gestellt hatte – war zwangsläufig sentimental und Scorsese attackiert diese Sentimentalität schon mit den allerersten Einstellungen. The Last Waltz beginnt mit Rick Danko an einem Billardtisch; Scorsese präsentiert ihn in einer extremen Großaufnahme. Die plötzliche Gewalt des Bildes ist ein Schock: Danko stößt sein Queue quer über die Leinwand, mit einem so lauten Krachen, dass man unwillkürlich zusammenzuckt, und egal mit welcher Stimmung man ins Kino gekommen ist, sie ist auf der Stelle verflogen. »Du musst die Kugeln deines Mitspielers einlochen und zusehen, dass deine eigenen auf dem Tisch bleiben«, erklärt Danko, als Scorsese ihn nach den Regeln fragt. »Dieses Spiel nennt man Cutthroat.«
In emotionaler Hinsicht schneidet Scorsese dann nicht auf die Wärme des Konzerts, sondern auf den dahinterliegenden Sinn und Zweck: Die Filmaufnahmen vom Konzert beginnen mit dessen Ende, mit dem Moment, als die Band wieder auf die Bühne zurückkehrt – im Anschluss an das offizielle, vorhersehbare »I Shall Be Released«-Finale –, um »Baby Don’t You Do It« zu spielen, den Marvin-Gaye-Titel, der jahrelang als die härteste Nummer in ihrem Repertoire galt. Als sie sich hinter ihren Mikrofonen und Instrumenten aufbauen, sehen die Mitglieder der Band nicht wie erschöpfte, zufriedene Männer aus, die gerade den Vorsitz bei ihrer eigenen Totenwache geführt haben, sondern eher wie die Earp-Brüder und Doc Holliday, die ihre letzten noch lebenden Kontrahenten am O.K. Corral wegpusten wollen. Und ein paar Sekunden lang, bis der Film weitergeht, klingen sie auch so.
The Last Waltz ist eine Überraschung für das Auge: Er hat keine Ähnlichkeit mit den üblichen Rock-’n’-Roll-Filmen. Es gibt keine hektischen Handkameraaufnahmen; man bekommt ruhige Kamerafahrten zu sehen, Zoomaufnahmen, Einzelbilder und, bei den Nummern, die nach dem Konzert in einem MGM-Tonatelier gefilmt wurden, elegante Kran- und Fahraufnahmen. Statt einfach nur Leute musizieren zu sehen, bekommen wir häufig mit, wie die Musik gemacht wird. Wir kriegen die Einsatzzeichen mit, die die Musiker einander zuwerfen, die Momente der Unsicherheit und des panischen Improvisierens.
Es gibt historische Musikdarbietungen und außergewöhnliche Filmsequenzen: Ronnie Hawkins, hünenhaft und ungebrochen, ein einundvierzigjähriger Mike Fink, wie er Bo Diddleys »Who Do You Love« herausschreit; eine fast schwarze Leinwand, nur von einem einzigen, blau-weißen Spotlight erhellt (die anderen Scheinwerfer waren ausgefallen), das auf Paul Butterfield und Levon Helm gerichtet ist, während sie »Mystery Train« mit hundertdreißig Sachen um eine Klippe herum jagen und dabei beinahe Junior Parker und Elvis von den Toten auferwecken. Muddy Waters ist fast sieben Minuten lang auf der Leinwand zu sehen, in einer brutalen Großaufnahme: Er deklamiert »Mannish Boy« wie ein Voodoopriester, der Sankt Petrus einen Platz im Himmel abtrotzen oder vielleicht den Teufel aus einem Höllenschlund heraufbeschwören will. Muddy Waters machte seine ersten Plattenaufnahmen, als die meisten Mitglieder der Band noch nicht einmal geboren waren, und ihnen bleibt nichts weiter übrig, als mit ihm Schritt zu halten. Waters hat seinen Platz in der Geschichte der Band; sie haben einen Platz in seiner verdient. Im Unterschied zu dem sauberen, aber flachen Sound des The-Last-Waltz-Dreifachalbums ist der Sound des Films die gesamte Zeit über roh, knisternd, bebend; bei der ersten Aufführung des Films knallten zwei Lautsprecher des Kinos durch, als Van Morrison auf der Leinwand »Caravan« schmetterte.
Der Film macht mehr, als bloß die Präsenz der Performer aufzuzeichnen. Oft verleiht er ihnen eine stärkere Präsenz, als sie sie auf der Bühne hatten. Joni Mitchell, wie sie bei »Coyote« die Hüften schwingt, ist schlichtweg betörend; sie spielt die Rolle einer Göttin auf Männerfang, ein Bild, das nur ein wenig konterkariert – oder verstärkt? – wird durch die Zigarettenschachtel, die sie sich unter den Rockbund geklemmt hat. Neil Young erscheint, wie üblich, als ein Flüchtling aus der »Dust Bowl« des amerikanischen Südwestens, doch so, wie man ihn hier gefilmt hat, wirkt er noch eigentümlicher als sonst: tief über den Korpus seiner Gitarre gekauert, als könne er sein Gesicht nicht zwischen den Schultern verbergen, wirkt Young wie ein Kinderschänder, ein Albtraum – und dann öffnet er den Mund und singt »Helpless« mit der Stimme eines kleinen Jungen, der sich vor dem Mann fürchtet, den wir auf der Leinwand sehen.
Die Kameras bleiben sehr dicht an Bob Dylan dran: Wir sehen Aufnahmen der gleichen Szene mit verändertem Kamerawinkel, das Aufblitzen eines Gesichts, verborgen hinter einem Vorhang von wild wuchernden Locken. Scorsese montiert die Szenen so, als wolle er vor allem das Mysterium ergründen, das Dylan noch immer wie ein Umhang umhüllt; was immer Scorseses Intentionen gewesen sein mögen, das ist zumindest das Resultat. Da gibt es den Bruchteil einer Sekunde, wo Dylan die Achseln zuckt – und ich wäre beinahe aus meinem Sitz hochgefahren. Es war, als hätte er gesagt: »Los, komm, zeig, was du draufhast, ich war gestern hier und morgen werde ich immer noch hier sein« – eine banale Geste (in Wirklichkeit reagierte Dylan bloß auf Levon Helms Frage nach einem Tempowechsel), die mehr Dramatik in sich birgt als jeder andere Moment des Films. »Wer ist dieser Mensch?«, fragt man sich. »Wo kommt er her?« Er ist eine Geistererscheinung, kein Sänger.
Die Schnitte zwischen den Szenen, in denen Scorsese die Band nach deren frühen Jahren befragt, und den Aktionen auf der Bühne ergeben immer einen Sinn. Sie bringen Wurzeln zum Vorschein und akzentuieren Themen wie Erfahrung, Kameradschaft, Not und Entbehrung, Verrücktheit: Wir hören von der Verwirrung, die die Hawks befiel, als sie merkten, dass man sie für einen Nachtclub engagiert hatte, der ein einarmiges Go-go-Girl beschäftigte, und von ihrer noch größeren Verstörung, als sie erfuhren, dass dieses Etablissement einmal Jack Ruby gehört hatte. Anschließend gelangen wir ohne Umschweife zu »The Shape I’m In«, einem Song, in dem es um einen Mann geht, der mit dem Rücken zur Wand steht.
Man erfährt eine Geschichte aus der Zeit, als die Hawks, wie sie damals noch hießen, den großen Blues-Harp-Spieler Sonny Boy Williamson II. ausfindig gemacht hatten. In West Helena, Arkansas, Levon Helms Heimatort, jammten sie gemeinsam eine ganze Nacht hindurch – Sonny Boy mit einem Eimer zwischen den Knien, um das von seinen wunden Lippen herabtropfende Blut aufzufangen. Von dort aus gelangen wir zu »Mystery Train«, und Paul Butterfield bläst mit einer solchen Vehemenz in seine Mundharmonika, dass man beinahe nach seinem Eimer Ausschau hält. Levon weiß von einer Zeit zu berichten, als Rock ’n’ Roll noch nicht der Name für eine bestimmte Art von Musik war, sondern bloß das, was man im tiefen Süden der USA zu hören bekam – eine natürliche Mischung aus Blues, Country, Cajun, Gospel, Folksongs und Minstrelnummern, die Außenstehende als grotesk empfanden. Was für Helm einfach bloß eine lokale Form von Entertainment darstellte, war für den Rest des Landes etwas Bedrohliches, etwas Vulgäres, etwas Teuflisches. Der Film liefert sofort den Beweis, dass diese Fremdartigkeit noch immer gewöhnungsbedürftig sein kann: Unmittelbar auf Helms Worte folgt Van Morrison, übergewichtig, in ein geschmackloses Bühnenoutfit gezwängt, zu keinerlei Konzessionen bereit. Ja, er ist grotesk und eine Sekunde lang erinnert er mich an Rumpelstilzchen, wie es vor Zorn seinen Fuß tief in den Boden stößt, als es erfährt, die Königin werde ihm ihr Kind nicht überlassen – zur Mitte von »Caravan« befürchtet man, Morrison könnte das Gleiche tun. Wie Little Richard aus Macon, Georgia, oder wie Jerry Lee Lewis aus Ferriday, Louisiana, ist auch Van Morrison aus Belfast ein Titan. Er bricht The Last Waltz weit auf, und als er die Bühne mit hochgeworfenen Beinen verlässt, ist nicht ein Zacken seiner Kraft oder seiner Eigenartigkeit geglättet worden und jeder dieser Zacken hat zugestoßen wie ein Messer.
»Zu Anfang war es eine Art Punkding«, sagt Robertson über die Musik und die Lebensweise, die die Band in den späten Fifties und frühen Sixties »on the road« entwickelten. »Viele waren so drauf wie wir. Fast alles, was damals im Radio lief, fanden wir scheiße. Uns kümmerte nicht, was die anderen dachten. Wir begannen, gegen alles um uns herum zu rebellieren, gegen das, was wir hörten.
Und da waren wir also« – als sich die Band mit Music from Big Pink aus Bob Dylans Schatten löste – »da oben in den Bergen, in Woodstock, und machten, wonach uns der Sinn stand, was wir gelernt hatten, und wir dachten, wenns den Leuten gefällt, gut, und wenns ihnen nicht gefällt, auch gut. Wir ziehen unser Ding durch, komme, was da wolle. Wir rebellierten immer noch gegen das, was es gab, gegen das, was wir hörten.«
Was die Band damals hörte, war der San-Francisco-Sound, Sgt. Pepper, Psychedelic Rock – »Schokoladen-U-Bahnen«, wie Richard Manuel es in The Last Waltz vernichtend formuliert –, und für sie war das Ganze ein einziger Schmu. Was hatte das mit dem Charme eines Johnny Ace zu tun, mit der emotionalen Tiefe von »What Would I Do Without You« oder mit der Courage und Intelligenz der Songs, die sie mit Bob Dylan auf Tourneen rund um die Welt gespielt hatten? Die negativistische Einstellung der damals angesagten Musik schien der Band allzu bequem; die Musik schien völlig artifiziell, ohne eine Spur echten Gefühls. Und so präsentierte die Band stattdessen eine in Country, Soul und Gospel verwurzelte Musik, eine Reihe von emblematischen Songs, die sich nicht abnutzten – Bejahungen des amerikanischen Lebens, gegründet auf eine Vieldeutigkeit, die diese Songs ehrlich bleiben ließ und die Raum für jeden Zuhörer schuf.
»Als diese beiden ersten Alben dann derart einschlugen – plötzlich gab es Artikel in Zeitschriften wie Time und Look, es gab Geld, es gab Druck von allen Seiten – also«, sagt Robertson, »alles war gut bis zu dem Moment, wo wir in die Welt hinausgingen. Denn da wurden wir genau das, wogegen wir früher rebelliert hatten: Wir wurden Stars, Idole, Leute, die zu sehr auf die Ratschläge anderer hören. Das Einzige, wogegen wir noch rebellieren konnten, waren wir selbst. Und das taten wir dann auch. Das kommt in vielen der Sachen zum Ausdruck, die wir nach The Band gemacht haben. Doch auf die Dauer kann das ziemlich destruktiv sein. Das haben wir herausgefunden. Es hat auch damit zu tun, dass man ständig auf Achse ist. Diese Tourneen sind verantwortlich für jede Menge Irrsinn, für jede Menge krankes Zeug. Das ist sehr gefährlich.«
Und so lud die Band zu The Last Waltz ein, ihrem Abschiedskonzert. Das Ganze war keine Tragödie oder, wie manche behaupten, ein Ereignis vom Kaliber des ersten Auftritts der Beatles in der Ed Sullivan Show (wenn überhaupt, dann war die Veröffentlichung von Music from Big Pink ein solches Ereignis). The Last Waltz war eher eine weitere Bestätigung des Sachverhalts, dass die Band einen Sinn für Geschichte hatte, den sie als einen unentbehrlichen Bestandteil des Lebens verstand. Im Unterschied zu vielen anderen Rock-’n’-Roll-Gruppen, die sich auflösen oder unentwegt weitermachen und dabei Mitglieder austauschen, Fahnenflüchtige oder Verstorbene ersetzen und unbeirrt ihre Hits pushen, verfasste die Band ihren eigenen Kalender, weil sie Kalender respektierte. »Man kann«, sagt Robertson in dem Film über den vorzeitigen Tod von Hank Williams, Buddy Holly, Janis Joplin und Elvis, »sein Glück auch überstrapazieren.«
Und in Anbetracht von The Last Waltz stellt sich die Frage, was dieses Glück – die Karriere der Band und ihre Musik – wert ist.
Die Antwort darauf gibt es möglicherweise nach etwa einem Drittel des Films, wo wir sehen, wie die Band und die Staples – ursprünglich ein schwarzes Gospelquartett, das seit den Sechzigerjahren als weltliches Gesangsensemble auftritt und aus dem 1915 geborenen Roebuck »Pops« Staples und seinen Töchtern Mavis, Cleotha und Yvonne besteht – in dem MGM-Tonatelier ihre Plätze einnehmen, um »The Weight« zu singen. »Die Alben der Staple Singers haben wir uns öfter angehört als alles andere«, sagt Robertson. »Wir wollten herausfinden, wie ihr Gesang funktionierte, wie sie miteinander sangen.« Die Band fand es heraus; der Gesang bei »The Weight«, wie es für Big Pink aufgenommen wurde, brachte Mitgefühl, Verpflichtung und Freundschaft zum Ausdruck. Der Gesang lief dem Text des Songs zuwider, denn der handelte von einem Mann, dem kein Mitgefühl zuteilwird, als er in einer fremden Stadt auftaucht, mit einer Mission, die dem Zuhörer (und vielleicht auch dem Mann selbst) nie so richtig klar wird. Die einzigen Leute, die ihm zu helfen bereit sind, verlangen etwas dafür – sagen wir, seine Seele.
In der ursprünglichen Version der Band war der Song übermütig, aber auch beunruhigend. In The Last Waltz ist das völlig anders. Der Song beginnt wesentlich langsamer – nicht was das Tempo anbelangt, sondern hinsichtlich des Moments, in dem das Gefühl hervortritt –, mit verblüffenden Tönen von Robertsons Gibson-Doppelhalsgitarre, einem klaren Gospelklavier von Garth Hudson und einem erschöpften, zutiefst fatalistischen Leadgesang von Levon Helm. Er hat schon alles gesehen, sagt seine Stimme; nichts wird ihn überraschen. Der leicht verwirrte Tonfall seines Gesangs auf Big Pink ist verschwunden und durch etwas ersetzt worden, das nicht so ohne Weiteres einzuordnen ist.
Während sich die Nummer voranbewegt und Scorseses Kamera das Ensemble umkreist, verändert sich die gesamte Bedeutung des Songs. Die Reihe von unheimlichen, unerklärlichen und sogar erschreckenden Dingen, die dem Erzähler des Songs widerfahren, wird hier zu etwas Dauerhaftem; der Song beschreibt nun nicht mehr eine Falle, der man entkommen kann, sondern das ganz alltägliche Leben. Die religiösen Bilder des Songtextes beginnen sich auszudehnen und übernehmen die Macht; der Witz von »The Weight« wird zu einer Elegie.
Verfolgt man die Geschichte – der Mann taucht auf, um einen Job zu erledigen, und verduftet schließlich aus der Stadt, ohne zu wissen, ob er besagten Job tatsächlich erledigt hat, ohne zu wissen, ob er, was Gott verhüten möge, noch einmal dorthin zurückkehren muss –, so beginnt man, »The Weight« als ein Gleichnis über die Karriere der Band zu hören: eine Version der schieren Abenteuerlust, mit der sie als Teenager vor achtzehn Jahren angetreten waren (»Du wirst dir keine goldene Nase verdienen«, sagte Hawkins, wie Robertson sich erinnert, zu ihm, »aber du wirst mehr Weiber flachlegen als Frank Sinatra«), und der am Ende aufkommenden Angst, ihre Uhr könnte abgelaufen sein.
Beobachtet man die Band und die Staples, so sieht man »The Weight« als eine Bekräftigung jenes Pluralismus, der schon immer im Mittelpunkt der Musik der Band gestanden hat. Während zuerst Mavis und dann Roebuck für jeweils eine Strophe anstelle der Band den Leadgesang übernehmen, sehen wir eine explizite, vollkommen bewusste Bekundung der Idee der Gemeinschaft, wie sie auf Big Pink und The Band so inbrünstig beschworen wurde. Wir sehen Männer, die mit Frauen singen, Frauen, die mit Männern singen, Schwarze, die mit Weißen singen, Weiße, die mit Schwarzen singen, Nordstaatler, die mit Südstaatlern singen, Südstaatler, die mit Nordstaatlern singen, die Jungen, die mit den Alten singen, die Alten, die mit den Jungen singen. Es gibt da nicht die geringste Distanz.
Es ist die Vision einer Utopie – die Wirklichkeit sieht anders aus, und um nicht den Eindruck der Verlogenheit aufkommen zu lassen, erfordert das Ganze wenigstens einen partiellen Widerspruch. Und The Last Waltz sorgt dafür. Der Film lässt den letzten hohen Refrain von »The Weight« in der Luft schweben und schneidet dann unmittelbar auf die Bühne des Winterland zu »The Night They Drove Old Dixie Down«, der nach dem Bürgerkrieg angesiedelten Geschichte eines ehemaligen Soldaten der Konföderierten, der nun verzweifelt versucht, die Scherben des alten Südens aufzuklauben. Es war die stärkste Nummer, die die Band an jenem Abend in San Francisco spielte; noch ehe der Song vorbei war, brach das Publikum in frenetischen Beifall aus, etwas, was bei den Dutzend Malen, wo ich die Band diese Nummer spielen sehen hatte, noch nie vorgekommen war. »Da kam mehr Wut aus ihm heraus«, sagt Robertson über den Gesang Levon Helms, des Südstaatlers, für den Robertson den Song geschrieben hatte.
Und dies bedeutet für mich Folgendes: Selbst wenn man eine Utopie kennt oder persönlich erlebt hat, die alle begrenzten Erfahrungen transzendiert – ob es sich bei dieser Utopie um »The Weight« handelt, wie es uns in The Last Waltz präsentiert wird, oder um das Panorama von The Last Waltz insgesamt –, so soll man, so kann man die begrenzte Erfahrung, mit der man anderen begegnet, nicht aufgeben, selbst wenn diese Erfahrung andere in letzter Konsequenz aussperrt, selbst wenn sie nicht geteilt werden kann, jedenfalls nicht in Gänze. Oder, anders formuliert, wenn Levon Helm, als der Konföderiertenveteran Virgil Cane, sagt, er erinnere sich an die Nacht, in der der Süden besiegt war und unterging, so erinnert er – Levon Helm – sich daran. Im Süden der Vierziger- und Fünfzigerjahre, zu der Zeit, als Levon Helm dort aufwuchs, war der Sezessionskrieg nicht Geschichte, nein, er war ein Bestandteil der Gegenwart. Er war die Last, die man mit sich herumschleppte, und Leute wie Helm und der in Mississippi geborene Roebuck Staples schulterten sie tagtäglich. Die Songs der Band spiegeln das gemeinsame Terrain von Helm und Staples wider und sie umreißen den Raum, der die beiden voneinander trennt.
Die in The Last Waltz hergestellte Verbindung zwischen »The Weight« und »The Night They Drove Old Dixie Down« beweist, dass wir die Geschichte weder unbekümmert benutzen noch ignorieren können – wie bei der Karriere der Band oder wie bei einer Unterhaltung, die sich von Van Morrison über Ray Charles bis zu Alan Freed erstreckt, können wir einfach versuchen, unseren Platz darin zu finden. Dieser Platz ist nicht festgelegt: Das ist die Wahrheit der Version von »The Weight«, die die Band gemeinsam mit den Staples präsentiert. Doch dieser Platz ist genauso wenig eine Frage des Wollens oder des Wünschens: Das ist die Wahrheit von »The Night They Drove Old Dixie Down«. Man handelt, aber man tritt auch ein Erbe an.
Von Anfang an hat ein Sinn für die Möglichkeiten des Abenteuers und für die Grenzen der Freiheit zu dem gehört, was die Band uns zu vermitteln versucht hat. In The Last Waltz sprechen sie noch immer klar und deutlich; sie haben ihr Glück, so scheint es, gerade genug strapaziert.
The Last Waltz, Regie: Martin Scorsese (MGM DVD, 1978/2002).