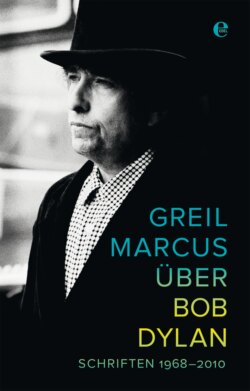Читать книгу Über Bob Dylan - Greil Marcus - Страница 7
Оглавление»Watching the River Flow«
Creem
Oktober 1971
In letzter Zeit fällt es schwer, die Werbespots von den Hits zu unterscheiden, jedoch nicht deshalb, weil die Werbespots irgendwie besser geworden wären. Die Charts dieses Sommers sind schauderhaft und fast jede Position in den Top Ten wird besetzt von irgendeiner schwülstigen Hollywoodausstattungsnummer inklusive der dort automatisch auftauchenden Revuegirls.
Doch jetzt haben Bob Dylan, The Who und Creedence neue Singles herausgebracht: »Watching the River Flow«, »Won’t Get Fooled Again« und »Sweet Hitch-Hiker«.
Dylans Single scheint von den dreien die beste zu sein.
Im Radio wird sie im Vergleich zu den anderen am wenigsten gespielt.
Ich weiß nicht, warum das so ist – vielleicht liegt es ja daran, dass sie nicht diesen gruseligen Hollywoodsound hat –, aber ich hege den Verdacht, dass Dylan sich diesmal selbst ausgetrickst hat. »Watching the River Flow« ist nichts Ausgefallenes: guter Beat, gute Laune, guter AM-Lärm. Doch wie bei den meisten Dylan-Platten gibt es hier mehr, als es zu geben scheint – und der erste Eindruck erweist sich als ein Streich, der dem Zuhörer gespielt wird.
Das klappt allerdings nur, wenn der Zuhörer gezwungen wird, sich die Platte oft genug anzuhören, um den ersten Eindruck überwinden zu können. In diesem Fall ist der erste Eindruck der, dass Dylan uns hier die übliche private Szene vorsetzt: »I’ll sit here and watch the river flow.« Also, das ist eine Idee, wie sie langweiliger nicht sein könnte. Es ist die unterschwellige Botschaft von fast allem, was James Taylor jemals geschrieben hat, ganze Bands formieren sich auf der Grundlage dieses schlichten Gedankens und die Leute fressen das auch, solange sie es billig bekommen – das heißt, auf eine unterschwellige Art –, aber vielleicht möchten sie es nicht haben, wenn sie dafür bezahlen müssen, in einer Konfrontation mit einem ausdrücklichen Bekenntnis zum Rückzug, das sich so leicht zu einem Spiegelbild ihres eigenen Rückzugs umkehren lässt.
Dann ist da noch die Möglichkeit, dass sich die Leute Dylan unter anderem deshalb anhören, weil er den anderen für gewöhnlich immer um eine Nasenlänge voraus zu sein scheint und weil man, wenn man sich seine Musik und seine Songs anhört, eine gewisse Vorstellung davon bekommt, was in der Musik und im musikalischen Diskurs vor sich geht und was dort demnächst angesagt sein wird. Und dann sind da noch die offenbar unausrottbaren Hoffnungen, er könne mit etwas Unergründlicherem und Verlockenderem herauskommen. Wenn Dylan jedoch lediglich einem Trend folgt, auch wenn er diesen selbst aus der Taufe gehoben hat, so dürfte ein Großteil seines Charismas automatisch den Bach runtergehen.
Dann sind da noch, in einem eher allgemeinen Kontext, diese sonderbaren Gerüchte über Dylans Privatleben, das, selbstverständlich, seine eigene Angelegenheit ist, aber zugleich auch eine Sache von öffentlichem Interesse – hat man von diesen Dingen Kenntnis erlangt, so kann man sich schlecht lobotomieren lassen, um sie wieder aus dem Kopf zu bekommen: die Unterstützung der Jewish Defense League, die Reisen nach Israel, die gemeinsam mit Dick Cavett errichteten Bürohäuser. Nichts davon muss stimmen, doch alle Welt spricht darüber, und wie bei den Geschichten über einen jungen Bob Dylan, der ungefähr einmal im Monat von zu Hause wegzulaufen pflegte, spielt es auch hierbei keine Rolle, ob diese Dinge wahr sind oder nicht. Wenn man eine Platte hört, dann vollzieht man keine rationale Trennung zwischen WAHR und FALSCH, man hört sie einfach und ihr Sound verschmilzt mit den Gerüchten zu dem, was man als Pop bezeichnet. Und in diesem Fall läuft das Ganze auf einen Dylan hinaus, der ein sonderbares Einmannmodell dafür abgibt, wie man seine ungestüme und verabscheuenswürdige Jugend wieder wettmachen kann. Wir alle werden eines Tages dreißig sein, doch wie Stu Cook von Creedence Clearwater so treffend formuliert, werden wir es sein, die dann dreißig sind, und nicht diejenigen, die dreißig waren, als die Leute sich zum ersten Mal wegen solcher Dinge Gedanken zu machen begannen. Oder, wie es jemand gegenüber einem Freund von mir formulierte, als dieser ein schickes Magazin übernahm: »Du gehörst jetzt zu denen!« Erinnern wir uns nicht noch daran, wie man uns prophezeite, der Rock ’n’ Roll würde uns nichts mehr geben, sobald wir achtzehn sein würden?
Wir müssen diese Dinge nicht mehr glauben; wir müssen lernen, deren Gegenteil auszuleben. Wir müssen dafür sorgen, dass sich das Dreißigsein in den Siebziger- und Achtzigerjahren von dem im vorausgegangenen Jahrzehnt ebenso sehr unterscheidet wie das Zwanzigsein in den Sixties von dem in den Fifties. Deshalb wundere ich mich über Bob Dylan, denn der scheint sich genau in die entgegengesetzte Richtung zu bewegen. Können wir diesem Typen trauen?
Der erste Eindruck, den man von »Watching the River Flow« bekommt, stellt diese Frage noch nicht einmal, denn dieser erste Eindruck ist so öde. »I’ll just sit here and watch the river flow.« Die Musik ist irgendwie ganz nett, doch sie klingt wie die Nummer, die vom ersten Leon-Russell-Album weggelassen wurde, weil sie zu glatt war. Das Gitarrenspiel ist gut, aber man hört es kommen, und wenn es kommt, klingt es genau so, wie man es erwartet hat. Als musikalische Komposition ist der Song eine Erweiterung von »One More Weekend«, das wiederum auf »Leopard-Skin Pill-Box Hat« zurückging. Alles an der Musik ist handwerklich gut gemacht, alles daran ist vertraut und nichts davon ist sehr aufregend. Sie ist so offenkundig Teil eines Trends, offenkundiger gehts nicht. Ich kann mich an keine Aufnahme von Dylan erinnern, bei der seine musikalische Persönlichkeit dermaßen durch Abwesenheit glänzt wie hier. Selbst auf Self Portrait, und dort vielleicht ganz besonders, bekam man eine besondere Spielart von Dylan-Musik zu hören, etwas Unnachahmliches und Unwiederholbares, und dies hier ist Russell-Musik, und nicht bloß deshalb, weil Russell auf dieser Platte mitwirkt. Die Fadheit dieser Nummer hängt auch damit zusammen, dass im Sound oder im Stil der Studioband von Dylans Präsenz rein gar nichts zu spüren ist – was eine Dylan-Platte unter anderem so aufregend macht, ist die Tatsache, dass es eine Dylan-Platte! ist, und in dieser Musik hier gibt es keinen Dylan. Ich glaube, dies ist ein weiterer Grund dafür, dass die Platte so wenig im Radio gespielt wird, dass es den Leuten schnurz ist, ob sie sie zu hören bekommen oder nicht.
Der guten Leon-Russell-Musik wird jedoch eine weitere neue Dylan-Stimme gegenübergestellt – diese ist humorvoll, von einer väterlichen Art, extraschlau und ungemein hip. Es verhält sich nicht bloß so, dass Dylan den Sound seiner Stimme in einen Gegensatz zu Russels Sound stellt, nein, es ist obendrein noch ein Sound, wie wir ihn noch nie gehört haben. Man hört das nicht sofort – nicht die DJs, die die Scheibe, so wie alle Neuerscheinungen, ein paarmal versuchsweise auflegen, um zu sehen, ob daraufhin jemand anruft, und sie in der Versenkung verschwinden lassen, wenn diese Anrufe ausbleiben, und auch nicht die Dylan-Fans, denen es nicht im Traum einfiele, bei einem Top-40-Sender anzurufen und mit einem dieser spießigen Plattenplauderer zu reden, die von solchen Sendern angeheuert werden.
Der Song besteht aus nervösen Wörtern, die durch die Art und Weise, wie Dylan sie singt, in einen Scherz verwandelt werden. Die Leute streiten sich in einem fort und brechen direkt auf der Straße zusammen und der Sänger eilt hin und her, um irgendwie mit der Situation zurechtzukommen. »Daylight’s sneakin’ through the window and I’m still in this all-night café« (das nenne ich Songwriting – achten Sie darauf, wie viel Text er in einer einzigen Zeile unterbringt!). Er ist zu Tode gelangweilt von diesem Flussufer, dessen unergründliche Trägheit ihn jedoch aus irgendeinem Grund anzieht.
Ihr denkt, dies sei mir nicht aufgefallen, häh? Ihr denkt, ich hätte die englische Sprache vergessen, als ich Hebräisch lernte?
People disagreein’ on just about everything, yep
Makes ya stop and, wonduh why
Oder das hier:
People disagreein’ everywhere ya look
Makes ya wanna stop and, uh, read a book!
Hey, sagt die Stimme, das reimt sich!
Hmmm. Rock ’n’ Roll macht Spaß. Das hätte ich beinahe vergessen.
Dylan arbeitet noch immer an seinem Mythos vom Rückzug aus dem Rampenlicht, der aus einem anderen Blickwinkel nichts weiter ist als das Problem des privaten Künstlers und einer Kunst, die ganz und gar öffentlich sein möchte. In seinen Songs gibt es derzeit kaum noch lose Enden; sie sind perfekt kontrollierte, kleine Statements, nicht so sehr darüber, was in Bob Dylans Kopf vor sich geht, sondern darüber, wo es seiner Ansicht nach Möglichkeiten gibt, das eigene Terrain abzustecken – wie man mit der Welt zurechtkommt, ohne sich von ihr gefangen nehmen zu lassen. Das Leitmotiv von New Morning war jener »Tenth Avenue Bus going west« und wieder und wieder widmeten sich die Songs dem Thema Flucht. Das ganze Album bewegt sich in Richtung Westen, kommt aber eigentlich nie dort an. Dies ist letztlich das, was es so amerikanisch macht. Die einzige Möglichkeit, den Westen daran zu hindern, zu dem zu werden, was man hinter sich lassen möchte, besteht darin, nicht dorthin aufzubrechen. Dann bedeutet der Traum weiterhin etwas.
Gute Laune verfliegt. Wenn es einem irgendwo nicht mehr gefällt, kann man von dort abhauen und an den Ort zurückkehren, wo man geboren wurde, um zu schauen, wie es dort aussieht – doch man kann, nein, man will nicht wieder nach Hause zurück. Und dann übernehmen die Träume das Ruder. Man kann sich immer für ein Wochenende davonmachen – falls der Babysitter Zeit hat –, doch in »Sign on the Window« geht es nicht um irgendwelche zweiten Flitterwochen, sondern um ein zweites Leben. Fährt dieser muffige Tenth Avenue Bus tatsächlich zu einem Forellenfluss in Utah? Doch die Hütte, die Frau und die Kinder, die Fische und der weite Himmel – das ist ein starker Traum. Dessen Kraft, und nicht dessen Irrelevanz, war wahrscheinlich der Grund dafür, dass so viele von uns Kritikern ihn so schnell abgetan haben, als wären wir außer uns vor Freude, dass dieser Bus New York nie wirklich verließ. Nichts wurde gelöst, doch es wurde vieles offenbart.
Nun schaut Dylan sich all dies von der anderen Seite an, wobei er etwas härter rockt und etwas lauter singt und das verblassende Bild vom Country Gentleman gegen das ältere vom City Boy setzt, die Erinnerung an die wilde Jugend gegen den verunsicherten Vater. Seine Songs, so scheint es, handeln davon, wie man erwachsen wird, ohne seinem Publikum und seiner eigenen Vergangenheit zu entwachsen – von den Möglichkeiten, sich zu ändern, ohne dabei zu betrügen. Dylan ist schlau genug, um sich schon immer bewusst gewesen zu sein, dass es sich bei den Fragen, ob diese Dinge möglich sind oder nicht, um echte Fragen handelt. Es deutet jedoch kaum etwas darauf hin, dass er die Antwort hat, und noch weniger deutet darauf hin, dass er daran interessiert ist, nach einer zu suchen.
Dylans Behandlung seiner eigenen Themen – Themen, die er besetzt und zu seinen eigenen gemacht hat – wirft jedoch merkwürdige Probleme auf, die selbst ihm entgangen sein könnten, zum Beispiel, wie man eine Hitplatte macht. Ich denke, dass Interessanteste an »Watching the River Flow« ist, dass diese Scheibe kein Hit ist und warum dies so ist. Ich vermute, es liegt daran, dass die Zeit vorbei ist, wo die Leute daran interessiert sind, Bob Dylan sagen zu hören, dass er einfach so dasitzt und zuschaut, wie der Fluss an ihm vorüberzieht, und obwohl er dies im Grunde gar nicht sagt, ist es das, was die Leute hören. Wenn sie zu ungeduldig sind, um zu hören, wie er sich selbst widerspricht, dann liegt dies womöglich daran, dass Dylan ein Opfer seiner eigenen Subtilität geworden ist. Ich denke, die Zeit ist gekommen, wo Dylan das Publikum noch einmal ganz von vorn erobern muss – wenn er eins haben möchte. Und ich hoffe, er ist daran interessiert, das zu versuchen.
Bob Dylan, »Watching the River Flow« (Columbia, 1971).