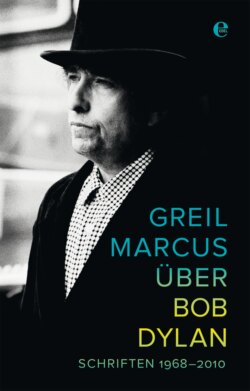Читать книгу Über Bob Dylan - Greil Marcus - Страница 14
ОглавлениеAus den Liner Notes
Bob Dylan & The Band
The Basement Tapes (Columbia)1975
… eine bestimmte Sorte von Bluesmusik kann man im Sitzen spielen … vielleicht muss man sich dabei ein bisschen nach vorn beugen.
Bob Dylan, 1966
1965 und 1966 zogen Bob Dylan und die Hawks quer durch das Land und dann um die ganze Welt. Diese stürmischen Tourneen trieben die Musik von Bob Dylan, und die der Band, an eine gewisse Grenze – und sie hatten eine herausfordernde Musik gemacht, die, wenn man so will, kein Pardon kannte und nicht um Schonung bat. Im Sommer 1967 waren Bob Dylan und die Band auf etwas anderes aus.
Weder John Wesley Harding, das gegen Ende jenes Jahres aufgenommen wurde, noch Music from Big Pink (für das alle der hier enthaltenen Band-Nummern ursprünglich gedacht waren) klingen so wie The Basement Tapes, doch es gibt zwei Elemente, die diesen drei Sessions gemeinsam sind: die Aura einer vergangenen Zeit, eine Art Klassizismus, und die absolute Hingabe, mit der sich die Sänger und die Musiker ihrem Material widmen. Unter der unbekümmert vor sich hin rollenden Oberfläche von The Basement Tapes geht etwas Ernsthaftes vonstatten. Was Gestalt angenommen hat, als Dylan und die Band mit den Songs herumspielten, war kein Stil, sondern vielmehr eine innere Einstellung – etwas, was mit einem Vergnügen an Freundschaft und Schöpfertum zu tun hatte.
Hört man sich die Musik, die sie gemacht haben, zum ersten Mal an, so wird man sie schwer einordnen können und wahrscheinlich auch nicht besonders daran interessiert sein, dies zu tun. Was zählt, ist Rick Dankos federnder Bass bei »Yazoo Street Scandal«; Garth Hudsons allgegenwärtige Jahrmarktsorgel (die noch nie so ausdrucksvoll geklungen hat wie bei »Apple Suckling Tree«); die sich ganz allmählich herausschälende Bedrohlichkeit von »This Wheel’s on Fire«; Bob Dylans Gesang, der so durchtrieben ist wie Jerry Lee Lewis und so weise wie der Alte vom Berge.
Da ist ein Lovesong von der Sorte, wie sie nur Richard Manuel zu schreiben imstande ist, das unwiderstehlich schöne »Katie’s Been Gone«; da ist die schlichte Leidenschaft der von der Band präsentierten fabelhaften Version von »Ain’t No More Cane«, einem alten Kettensträflingssong, der für jeden, der die Musik der Band schätzt, eine Offenbarung sein sollte, denn diese Darbietung scheint die Essenz all dessen einzufangen, was diese Gruppe schon immer sein wollte. Da ist die schöne Idee von »Bessie Smith«, geschrieben und gesungen von Robbie Robertson und Rick als die Wehklage eines Lovers von Bessie, der nicht herauszufinden vermag, ob er sich in die Frau selbst oder in ihre Art zu singen verliebt hat. Da ist Levon Helms spezielle Kombination aus sexueller Verunsicherung und hilflosem Entzücken in »Don’t Ya Tell Henry« (und da sind die Solos, die er und Robbie zu dieser Nummer beisteuern) – und die Geschichte, die er in »Yazoo Street Scandal« erzählt, eine amüsante Horrorstory, in der die Freundin des Sängers ihn mit der örtlichen Dark Lady bekannt macht, die ihn auf der Stelle verführt und anschließend halb zu Tode erschreckt.
The Basement Tapes klingen, mehr als alles andere, was man bisher von Bob Dylan und der Band zu hören bekommen hat, wie die Musik einer Partnerschaft. Wenn Dylan und die Mitglieder der Band einander beim Leadgesang ablösen und wenn sie sich gegenseitig Nuancen und Wendungen innerhalb der Songs zuwerfen, dann kann man die Wärme und Kameradschaft spüren, die für alle sechs Männer etwas Befreiendes gewesen sein muss. Die Sprache zum Beispiel ist völlig entfesselt. Ein Großteil der Songs wirkt so kryptisch, so sinnentleert wie ein falsch nummeriertes Kreuzworträtsel – das heißt, wenn man lediglich auf die Worte achtet und nicht auf das, was der Gesang und die Musik zu sagen haben –, doch der offene Geist der Songs ist so unkompliziert wie deren unvergleichliche Vitalität und das Feuer, das sie ausstrahlen.
In Dylans Songwriting und in seinem Gesang spürt man hin und wieder – vor allem bei »Tears of Rage« – eine pure, unverstellte Emotionalität, wie sie anderswo nirgends zu finden ist, und ich glaube, die erstaunliche Tiefe und Kraft von »Tears of Rage« und einiger anderer Nummern ist auf die musikalische Sympathie zurückzuführen, die bei diesen Sessions zwischen Dylan und der Band offenkundig geherrscht hat. Es gibt in der Musik Rhythmen, die regelrecht singen vor Komplimenten, die sich die Musiker zuwerfen – man höre sich »Lo and Behold!« an, »Crash on the Levee (Down in the Flood)« oder »Ain’t No More Cane«. Und da ist auch noch eine andere Art von Offenheit, ein Hang zu derben Späßen, der sich ebenso sehr an Levons Mandoline festmachen lässt wie an seinem oder an Dylans Gesang – ein Geist, der an allen Ecken und Enden des Albums ein breites Lächeln aufblitzen lässt.
Mehr als nur ein bisschen verrückt, mitunter völlig bizarr (ich denke da an »Million Dollar Bash«, »Yazoo Street Scandal«, »Don’t Ya Tell Henry«, »Lo and Behold!«), unbekümmert zwischen Beichtstuhl und Bordell pendelnd, vor Humor und guter Laune strotzend, klingt diese Musik für mich gleichzeitig wie eine Erprobung und wie eine Entdeckung – von musikalischer Wesensverwandtschaft, von Schneid und Chuzpe, von einigen sehr pointierten Themen; tu es oder halt den Mund, Verpflichtung, Flucht, Heimkehr, Aufrichtigkeit, die Begleichung längst fälliger Rechnungen.
Die Musik klingt aber auch wie eine Erprobung und eine Entdeckung von Erinnerungen und Wurzeln. The Basement Tapes sind ein Kaleidoskop, wie es mir bislang noch nicht untergekommen ist, in sich geschlossen und nicht veralteter als die Post von heute, doch sie scheinen einem Kaleidoskop von amerikanischer Musik zu entspringen, die trotz ihrer Ehrwürdigkeit nicht weniger unmittelbar ist. Gleich unter der Oberfläche von Songs wie »Lo and Behold!« oder »Million Dollar Bash« liegen die sonderbaren Abenteuer und die mit todernster Miene vorgetragenen Tollheiten solcher Standards wie »Froggy Went A-Courtin’« und »E-ri-e« oder von Henry Thomas’ »Fishing Blues«, »Cock Robin« oder »Five Nights Drunk«; und der Geist von Rabbit Browns sardonischem »James Alley Blues« steckt womöglich direkt hinter »Crash on the Levee (Down in the Flood)«. The Basement Tapes beschwören Shantys und Trinklieder herauf, Lügengeschichten und frühe Rock-’n’-Roll-Nummern.
Doch neben all diesen Dingen – und oftmals eng damit verknüpft – gibt es noch etwas völlig anderes.
Offenbar wird der Tod nicht allgemein akzeptiert. Doch mir kommt es so vor, als hätten die Vertreter der traditionellen Musik aus ihren Songs gefolgert, dass das Unergründliche eine Tatsache ist, eine traditionelle Tatsache.
Bob Dylan, 1966
Was Bob Dylan damit meinte, kann man in der Musik von The Basement Tapes hören, in »Goin’ to Acapulco«, »Tears of Rage«, »Too Much of Nothing« und »This Wheel’s on Fire« – man kommt kaum umhin, es zu hören. Es ist etwas Unergründliches, das in einer völlig alltäglichen Sprache daherkommt; es hat nichts zu tun mit Hokuspokus, Talismanen oder Zaubersprüchen. Die Hinnahme des Todes, die Dylan in der traditionellen Musik entdeckte – in den uralten Balladen der Musik aus den Bergtälern der Appalachen –, ist schlicht und einfach das Beharren eines Sängers auf dem Unergründlichen als etwas, was zu jedem ehrlichen Verständnis des Lebens dazugehört; es ist die stille Angst eines Menschen, der sein Seelenheil sucht und in eine Leere starrt, die seinen Blick erwidert. Es ist ein beeindruckender, unerklärbarer Fatalismus, der die zeitlosen, erstmals in den 1920er-Jahren aufgenommenen Balladen antreibt; Songs wie Buell Kazees »East Virginia«, Clarence Ashleys »Coo Coo Bird«, Dock Boggs’ »Country Blues« – oder ein Song wie »I Wish I Was a Mole in the Ground«, den Bascom Lamar Lunsford 1928 aufgenommen hat. »I wish I was a mole in the ground – like a mole in the ground I would root that mountain down – And I wish I was a mole in the ground.«
Was der Sänger möchte, ist offenkundig und zugleich fast unmöglich zu verstehen. Er möchte von seinem Leben erlöst und in eine unbedeutende, allseits verachtete Kreatur verwandelt werden; wie ein Maulwurf im Erdboden möchte er nichts sehen und von niemandem gesehen werden; er möchte die Welt zerstören und es überleben.
Im Sommer 1967 setzten sich Dylan und die Band mit solchen Gefühlen auseinander – mit der Leere, die einem entgegenstarrt. In den stärksten und verstörendsten Songs von The Basement Tapes vermitteln sie ein uraltes Gefühl des Unergründlichen, mit einer Eindringlichkeit, wie man sie schon lange nicht mehr gehört hat. Man kann es in Dylans Gesang entdecken und in seinem Text zu »This Wheel’s on Fire« – und in jedem Ton, den Garth Hudson, Richard Manuel, Robbie Robertson, Levon Helm und Rick Danko spielen.
The Basement Tapes sind vor allem auf diese Weise eine Erprobung und eine Entdeckung von Erinnerungen und Wurzeln; das könnte auch die Ursache dafür sein, dass The Basement Tapes heute womöglich noch zwingender sind als zu der Zeit, als sie aufgenommen wurden, und dass sie vermutlich genauso wenig vergehen werden wie Elvis Presleys »Mystery Train« oder Robert Johnsons »Love in Vain«. Der Geist eines Songs wie »I Wish I Was a Mole in the Ground« ist hier nicht zu verstehen als ein Einfluss von Bedeutung und auch nicht als eine Quelle. Es verhält sich einfach so, dass eine Seite von The Basement Tapes den Schatten all dieser Dinge wirft und dabei gleichzeitig in deren Schatten steht.