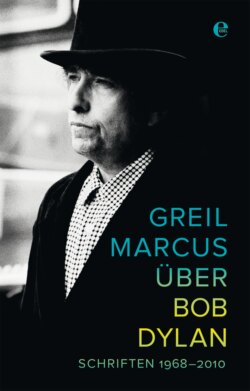Читать книгу Über Bob Dylan - Greil Marcus - Страница 16
ОглавлениеDieser Zug hält hier nicht mehr
Rolling Stone
30. Dezember 1976
Als der inzwischen verstorbene Junior Parker 1953 die Originalaufnahme von »Mystery Train« einspielte, entlehnte er die ersten Zeilen –
Train I ride
Sixteen
Coaches long
– aus dem »Worried Man Blues« der Carter Family, der aus den Zwanzigerjahren stammte, obwohl niemand genau weiß, wo die Carter Family ihn aufgeschnappt hatte. »Mystery Train« ist ein ziemlich alter Song. Als die Band ihn sich etwa eine Stunde nach Beginn ihres Abschiedskonzerts am Thanksgivingabend im Winterland vornahm, klang er neu. Ich hatte Parker den Song singen hören und Elvis und Paul Butterfield und ich hatte die mit einem neuen Text versehene Version der Band auf ihrem Oldies-Album Moondog Matinee gehört; das hier war etwas völlig anderes. Levon Helm, der den Leadgesang übernahm, und Richard Manuel spielten beide Schlagzeug, Paul Butterfield spielte Mundharmonika und gemeinsam legten sie einen swingenden Beat hin, der mit jeder Kurve, die die Nummer nahm, an Kraft gewann. Ich habe Butterfield noch nie mit einer solchen Power spielen hören: Seine Mundharmonika war ein nächtlicher Hoodooschrei, der über dem Publikum schwebte und durch das Ereignis des letzten Auftritts der Band hindurchschnitt wie eine Fanfare, die einem klarmachte, weshalb so ein Auftritt überhaupt zu einem Ereignis werden konnte. Die Band hielt nichts zurück; sie spielten mit einer Intensität, wie ich sie im Laufe der Jahre nur gelegentlich bei ihnen erlebt habe – 1965 hinter Dylan, 1969 am zweiten Abend ihrer Debütkonzerte im Winterland, 1974 gemeinsam mit Dylan bei »Highway 61 Revisited« und »All Along the Watchtower« – eine Intensität, die ich nie vergessen habe.
Come down to the station to meet my baby at the gate
Ask the stationmaster if her train’s runnin’ late
He said if you’re a-waitin’ on that 4.44
I hate to tell you son that train don’t stop here anymore
Levon sang, als flehe er um Gnade – ob bei Gott oder beim Teufel, konnte man nicht sagen.
Das Konzert wurde auf den Plakaten als The Last Waltz angekündigt; die Band präsentierte einen gleichnamigen Song, den sie praktisch erst einen Tag vor der Show geschrieben und während der einzigen Pause ihres fünfstündigen Auftritts hinter der Bühne eingeübt hatten. Als ein Ereignis war das Ganze ziemlich aufgebläht, doch die Band ließ sich von den bombastischen Dimensionen der Veranstaltung nicht beeindrucken.
Die Band ist im Laufe der Jahre in einem Ausmaß mit ihren Songs gleichgesetzt worden, das sie, im Guten wie im Schlechten, von allen anderen Rockgruppen unterscheidet: Bei ihnen assoziiert man nicht so sehr ihre Aura oder ihre Gesichter, sondern eher »The Night They Drove Old Dixie Down« und andere Nummern von Music from Big Pink und The Band. Die Band eröffnete die Show mit solchen Songs und sie spielten sie so präzise und schwungvoll, wie ich es schon lange nicht mehr erlebt hatte. Sie kamen aus sich heraus: Rick Danko hüpfte kreuz und quer über die Bühne, Robbie Robertson erlaubte sich extravagante Solos, Garth Hudson streifte über seine Orgel wie ein Spurenleser, mit wehendem Haar, und Richard Manuel und Levon Helm schienen beide mit einer besonderen inneren Überzeugung zu singen. Als sie in ihre erste Nummer einstiegen, »Up on Cripple Creek«, wurde mir schlagartig bewusst, dass ich sie diesen Song womöglich nie wieder spielen hören werde; sie hatten ihn seit acht Jahren gespielt, seit jenem ersten Abend in San Francisco, und ich hatte keinen Auftritt von ihnen gesehen, wo sie ihn nicht gespielt hatten. Ich hatte mitunter darüber genörgelt, dass die Band ihr Bühnenrepertoire nie zu variieren schien, doch plötzlich schien mir der Song unverrückbar, rechtmäßig an seinem Platz, ebenso unvergänglich wie ein Charakter. In diesem Moment ergab es für mich keinen Sinn, dass sie die Nummer nicht bis ans Ende ihrer Tage spielen würden. Der Song hatte mich gefangen genommen; ich wollte nicht wahrhaben, dass ich ihn nun zum letzten Mal hören sollte, denn ich fand, er hatte sich noch kein bisschen abgenutzt.
Sie gaben diverse Songs zum Besten, wobei sie neben Allen Toussaint, der als Dirigent einer Bläsersektion in Erscheinung trat, auch einen Fiddlespieler mitwirken ließen, und den Höhepunkt erreichten sie am Schluss von »This Wheel’s on Fire«, das stets zu den Glanznummern ihrer Auftritte gehört (Howard Johnson, der große Ähnlichkeit mit Roy Campanella hat, aber auch ein bisschen wie Louis Armstrong und ein bisschen wie Flip Wilson aussieht, sang hier mit und pustete beim Singen die Backen auf wie beim Tubaspielen). Sie sangen ihre letzte Single »Georgia on My Mind«, die sie zur Unterstützung von Jimmy Carters Wahlkampf aufgenommen hatten (man schickte ihm eine Kopie des Mastertapes und sie gefiel ihm – die B-Seite war passenderweise »The Night They Drove Old Dixie Down«). Garth brachte ein Intro direkt aus »Song of the South«, während Manuel seinen Platz am Klavier verließ, sich ein Mikrofon griff und in der Manier eines Crooners sang. Der Soloauftritt der Band kam mit »The Night They Drove Old Dixie Down« jedoch erst so richtig in Fahrt. Sie gingen bei diesem Song einfach härter zur Sache, als ich sie es jemals hatte tun sehen; es steckte jede Menge Liebe in der Darbietung, aber auch eine gewisse Verzweiflung. Ihr Set enthielt außerdem noch »The Shape I’m In« (träge, langsam, wie es auf der Bühne immer der Fall gewesen ist), »It Makes No Difference«, »Life Is a Carnival«, »Ophelia« und »Stage Fright«; ihre Schlussnummer war »Rag Mama Rag«.
Ich will verdammt sein, wenn da nicht jemand nach »Free Bird« schrie.
Dann holte die Band Ronnie Hawkins auf die Bühne, den Rockabillysänger aus Arkansas, der sie in den frühen Sixties in Toronto als seine Begleitband rekrutiert und ihnen den Namen The Hawks verpasst hatte. Hawkins bringt nicht mehr Gewicht auf die Waage als zwei x-beliebige Mitglieder der Band zusammengenommen; er ist der Inbegriff des unverbesserlichen Rock ’n’ Rollers. Er trug einen gewaltigen Strohhut mit aufgebogener Krempe, einen schwarzen Anzug und einen dichten Vollbart, hatte blitzende Augen, ein Gesicht voller Narben und ein breites Grinsen. Die Band legte einen so harten Bo-Diddley-Beat hin, wie man ihn schon immer hatte hören wollen, und Hawkins begann, auf der Bühne herumzutigern, und adressierte »Who Do You Love« direkt an die Jungs der Band (»Take it easy, Garth, dontcha gimme no lip«), die ihn 1963 bei seiner klassischen Aufnahme des Songs begleitet hatten. Hawkins heulte, er schrie und brüllte, und stürmte einmal über die Bühnenbretter, um Robbies Gitarre mit seinem Hut Luft zuzufächeln (»Cool it down, boy!«), ein Gag aus der Bühnenshow, den die sechs Männer vor dreizehn Jahren abzuliefern pflegten – und für mich der größte Moment des Abends.
Dr. John, ausstaffiert wie ein Hipster aus den Fünfzigerjahren – goldene Schuhe, Glitzerjacke, eine tief über den Kopf gezogene Baskenmütze –, war als Nächster dran und gab seinen Song »Such a Night« zum Besten. Anschließend präsentierte der ebenfalls aus New Orleans stammende Bobby Charles eine Neufassung von »Liza Jane«: Dr. John, Charles, Danko, Robertson, Manuel und Helm lieferten ein so schlichtes und perfektes Stück New-Orleans-Musik ab, wie man es im Winterland wohl noch nie zu hören bekommen hatte. Dr. Johns eigener Song hatte – so wie später fast alle von Gästen vorgetragenen Nummern, die nicht mit der Band identifiziert wurden – die Stimmung im Saal abflauen lassen, doch als er hier als ein Teil der Gruppe sang, heizte er sie wieder auf. Dann folgte »Mystery Train« und anschließend, noch immer mit Paul Butterfield auf der Bühne, hatte Muddy Waters seinen Auftritt, bei dem er sich vom Gitarristen und vom Pianisten seiner eigenen Band begleiten ließ. Er sang eine schwache Version von »Caldonia«; der Mann ist ja doch schon einundsechzig. Es war eine nette Geste der Band, ihn einzuladen; die meisten von ihnen hatten bei seinem Woodstockalbum mitgewirkt und als Levon and the Hawks hatten sie 1963 Waters’ »She’s 19« aufgenommen. Ihn auf die Bühne zu holen ergab also einen Sinn. Man dachte sich Entschuldigungen für Muddys wenig überzeugende Leistung aus, bis man zu hören bekam, wie er und die Band in »Mannish Boy« einstiegen. Als Waters diesen Song 1955 zum ersten Mal aufnahm, war er gerade vierzig, etwa so alt wie Hawkins es heute ist, und mit einem Mal wurde die Vorstellung des Alterns, die Idee, man könne seine besten Jahre hinter sich haben, lächerlich. Butterfield schien während der gesamten Darbietung einen einzigen düsteren Ton zu spielen; Waters tanzte, er hüpfte auf und ab; die Band brodelte. Es hörte nicht mehr auf: »I’m a man … I’m a rolling stone …« Sie holten aus dem Song alles heraus, was in ihm steckte, und als Waters die Bühne verließ, war nichts mehr übrig. The Last Waltz war sorgfältig vorbereitet worden; es hatte zwei Abende mit Proben in San Francisco gegeben, Wochen mit Proben in Los Angeles und jede Nummer war buchstäblich in einem Drehbuch fixiert, Zeile für Zeile, Einstellung für Einstellung; jeder Kamerawinkel und jeder Szenenaufbau waren minutiös vorausgeplant. Es mag sein, dass sie »Mannish Boy« vorher einmal kurz durchgegangen waren, doch so wie Muddy und die Band den Song spielten, konnten sie ihn unmöglich eingeübt haben. Es war eine phänomenale Darbietung.
Auf Waters folgten Eric Clapton, Neil Young, Joni Mitchell und Neil Diamond und bei deren Performances verlor die Show, wie ich fand, ihre Form. Clapton spielte schlecht, wenn auch spektakulär; weder Youngs Nummern (»Helpless« und Ian Tysons »Four Strong Winds«) noch die von Mitchell (drei Titel ihres aktuellen Albums) oder die von Diamond (»Dry Your Eyes«) schienen in musikalischer Hinsicht irgendetwas mit der Band zu tun zu haben; hier befriedigte das Konzert die Bedürfnisse jener Leute, die vor allem gekommen waren, um sich ihre Idole aus der Nähe anzusehen. An diesem Punkt kamen auch die ersten Gerüchte über zusätzliche prominente Gäste auf; ein Fan prophezeite, Buddy Holly werde genau um Mitternacht auftreten, während ein anderer behauptete, er habe den verstorbenen Murry Wilson hinter der Bühne sein Instrument stimmen sehen.
Nach Diamonds Auftritt überließ Manuel John Simon das Klavier und begann »Tura Lura«, einen Song über ein irisches Schlaflied, zu singen. Als Manuel die letzte Strophe beendet hatte, kam Van Morrison auf die Bühne und drückte der Show im Nu seinen Stempel auf. Ich hatte ihn noch ein paar Minuten zuvor oben auf den Rängen herumschleichen sehen, mit missmutiger Miene und unauffällig gekleidet, in Regenmantel und Jeans, und nun stand er mitten auf der Bühne, in einem etwas albernen purpurroten Anzug mit einem grünen Top darunter, und sang in Richtung der Saaldecke. Sie stiegen in »Caravan« ein – wobei John Simon die Lautstärke der Band dirigierte und die Bläser unheimlich effektvoll führte – und Van brannte Löcher in den Boden. Er war magisch und ich fragte mich, warum er sich nicht vor Jahren mit The Band zusammengetan hatte. Er passte zu ihnen wie kein anderer Sänger, seine und ihre Musik hätten sich ideal ergänzt. Vans Auftritt war ein Triumph, und als der Song endete, warf er aus schierem Übermut ein Bein in die Luft und verschwand in eben dieser Manier, wie eins der legendären Rockett-Revuegirls, von der Bühne. Das Publikum hatte ihm ein herzliches Willkommen bereitet und nun verabschiedete es ihn mit tosendem Applaus.
Als letztes Stück vor der Pause – in der Dichter wie Emmett Grogan, Michael McClure und Lawrence Ferlinghetti aus ihren Werken lasen – spielte die Band »Acadian Driftwood«. Neil Young und Joni Mitchell wurden dafür wieder auf die Bühne geholt, um als Kanadier den Harmoniegesang für diesen kanadischen Song beizusteuern. Das Ganze war eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Dann, nach etwa vierzig Minuten, wurde das Konzert mit Garths langem, diesmal eher feierlichem als munterem Intro zu »Chest Fever« fortgesetzt, dem der Song an sich folgte, und dann kam »The Last Waltz«, ein Stück, das von der Stimmung her ein wenig an »Long Black Veil« erinnert. Die nächste Nummer war »The Weight«. Ich habe die Band diesen Song schon ein Dutzend Mal spielen hören, doch bis zu diesem Abend hatten sie ihn nie so richtig in den Griff bekommen. Garth spielt bei »The Weight« Klavier und seine Töne hatten immer etwas Überdrehtes an sich gehabt, ein so unregelmäßiges Tempo, dass es für den Rest der Gruppe immer schwer war, ihm zu folgen. Doch diesmal schafften sie es, halbwegs koordiniert zu spielen, und der Song strahlte.
Gleich darauf kam Bob Dylan auf die Bühne, stöpselte seine Gitarre ein und schlug die ersten Töne von »Baby Let Me Follow You Down« an. Seine Rhythmusgitarre war so laut aufgedreht oder am Saalmischpult so sehr in den Vordergrund gerückt worden, dass sie alles andere übertönte; der Sound war an diesem Abend noch nie so roh, so schrill, so schnell und so hart gewesen. Dylan rockte, was das Zeug hielt. Er tanzte über die Bühne und bewegte sich nach jeder Strophe vom Mikrofon weg. Seine Gitarre schepperte. Er brüllte ins Mikrofon, als sie einen Song herunterdroschen, der zu den Höhepunkten der Shows zählte, die er und die Hawks 1965 und 1966 abgeliefert hatten; dann mäßigte er das Tempo bei »Hazel«, einer Nummer von Planet Waves, um anschließend in »I Don’t Believe You« einzusteigen, ein weiteres Glanzlicht der Dylan-Hawks-Shows von vor zehn Jahren. Damals war es ein kraftvolles, lyrisches Stück gewesen und an diesem Abend war es das ebenfalls. Dylan stolzierte auf der Bühne herum; in seiner Darbietung lag eine ungeheure Eindringlichkeit und, im Unterschied zu den Auftritten einiger anderer Sänger, keine Feierlichkeit und keine Zurückhaltung. Er war laut und er stand nie still. Nach »Forever Young« kehrte er ohne eine Pause – seine Nummern waren mehr oder weniger ineinander übergegangen – zu »Baby Let Me Follow You Down« zurück. Er war, wie manche sagten, fünfundzwanzig Minuten auf der Bühne; ich hätte gewettet, es wären nur sieben gewesen.
Das Konzert erreichte sein offizielles Ende mit »I Shall Be Released«. (»Na ja«, sagte ein Freund von mir, »wenigstens haben sie nicht ›Will the Circle Be Unbroken‹ ausgewählt.«) – und, wie vorauszusehen, kehrten alle, und zusätzlich noch Ringo Starr und Ronnie Wood, auf die Bühne zurück, um beim großen Finale mitzusingen. Als sich danach die Bühne geleert hatte, begannen Levon und Ringo ein rhythmisches Grundmuster zu trommeln, und dann gesellten sich weitere Musiker hinzu – Dr. John, Clapton, Wood, Carl Radle, Neil Young, Stephen Stills sowie diverse Mitglieder der Band –, um ein paar längere Nullachtfünfzehn-Improvisationen zum Besten zu geben. Nach dreißig Minuten kehrte die Band noch einmal allein zurück. Sie spielten »Don’t Do It«. Als sie damit fertig waren, taten sie es aber doch: Sie verschwanden.
Es war ein langer Abend und bis zum Auftauchen von Ringo-Wood-Stills (plus Jerry Brown, der keinen Anzug trug und dem Publikum zuwinkte) hatte man nicht den Eindruck gehabt, einer »Supersession« beizuwohnen. Im Großen und Ganzen machten die Leute, die zusammen spielten, eine Musik, wie nur sie sie zusammen machen konnten; sie trieben sich gegenseitig über ihre Grenzen hinaus und sie durchbrachen die Nostalgie, die der Veranstaltung zwangsläufig anhaftete.
Was genau nun vorbei ist, ist schwer zu sagen. Niemand erwartet, dass das Lebewohl der Band so etwas sein wird wie Smokey Robinsons Abschied oder wie einer der Rückzüge von David Bowie. Womöglich ist das, womit jetzt Schluss ist, lediglich eine Anzahl von Songs, jene Songs, die die Band schon so lange gespielt hat und denen sie nicht entkommen konnte. Es kann sein, dass sie ihre Zeit als eine öffentlich auftretende Gruppe unter anderem deshalb beendet haben, weil ihre eigene Musik sie in eine Ecke getrieben hatte; vielleicht mussten sie ja einen Schlusspunkt setzen, um neu anfangen zu können, als Individuen – und als Gruppe. Bestimmt wird es mehr Soloprojekte geben; offiziell wurde verlautbart, die Band werde weiterhin als The Band Platten aufnehmen, doch ich frage mich, wie lange es wohl dauern wird, bis ihr Name wieder auf einer LP erscheint, abgesehen von dem Livealbum ihres Abschiedskonzerts.
Die Band ist nie eine hochkarätige Rock-’n’-Roll-Band wie andere gewesen, weder für ihre Fans noch für ihre Kritiker: Sie ist immer etwas Besonderes gewesen und es war die Idee von einer seit Jahren gemeinsam durch dick und dünn gehenden Gruppe von Leuten, die sie, zusammen mit ihrer Musik, zu etwas Besonderem – die sie ohne Zweifel zu etwas Einzigartigem gemacht hat. Ich kann mich, ehrlich gesagt, noch nicht damit abfinden, dass die Songs, die die Band zur amerikanischen Tradition beigesteuert hat, fortan nur noch auf Schallplatte existieren sollen, und mich beschleicht der Verdacht, dass die Band, aus welchen Motiven auch immer, womöglich nicht bloß diese eine Tür zugemacht hat.
Vor ein paar Wochen fragte ich Robbie Robertson, ob ein letztes Konzert bedeute, dass die Band sich auflösen werde, und die Vorstellung schien ihn zu überraschen und gleichzeitig zu amüsieren. »Die Band wird sich niemals auflösen«, sagte er. »Dafür ist es zu spät.« Nun, das hoffe ich. Doch die eingangs zitierte Zeile aus »Mystery Train« will mir nicht mehr aus dem Kopf gehen, genauso wenig wie die von der Band und Paul Butterfield präsentierte Version des Songs und wie ein Gedanke aus Emmett Grogans Autobiografie, wo er schreibt, seine Begegnungen mit der Band hätten ihn gelehrt, dass es lange dauert, bis etwas wirklich Gutes passiert. Es dauert lange und es ist lange her.
The Band, The Last Waltz (Warner Bros./Rhino, 2002).