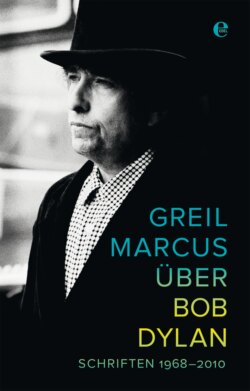Читать книгу Über Bob Dylan - Greil Marcus - Страница 5
ОглавлениеSelf Portrait No. 25
Rolling Stone
23. Juli 1970
Geschrieben und arrangiert von Greil Marcus
Chor: Charles Perry, Jenny Marcus, Jann Wenner, Erik Bernstein, Ed Ward, John Burks, Ralph J. Gleason, Langdon Winner, Bruce Miroff, Richard Vaughn und Mike Goodwin
(1) Was soll der Scheiß?
(1) Das von einem Frauenchor gesungene »All the Tired Horses« ist ein großartiges Stück Musik, der vielleicht denkwürdigste Song auf diesem Album. In einer älteren Fassung war es »All the Pretty Horses in the Yard«; jetzt könnte es als Titelsong für alle möglichen Westernklassiker dienen. Können Sie die Orgel hören, die sich zwischen die Streichinstrumente und die Stimmen schmuggelt? Shane1 kommt einem in den Sinn, oder The Magnificent Seven2: Auch Revolverhelden, die ihre besten Jahre hinter sich haben und nicht mehr zeitgemäß sind, müssen sich nach wie vor in den Sattel schwingen. Tatsächlich klingt diese Nummer so, als singe Barbara Stanwyck sie in Forty Guns3.
1 Mein großer Freund Shane (Regie: George Stevens, USA 1953).
2 Die Glorreichen Sieben (Regie: John Sturges, USA 1960).
3 Vierzig Gewehre (Regie: Samuel Fuller, USA 1957).
Die Schönheit dieses gemalten Wegweisers verheißt, was seine Worte Lügen strafen, und die Frage, die der Song stellt, wird zu der des Zuhörers: Er kann nicht reiten, wenn das Pferd auf der Wiese ein Nickerchen hält.
(2) »Ich weiß nicht, ob ichs noch mal auflegen werde«, sagte der Diskjockey, als das Album sein Radiodebüt erlebte. »Keiner ruft an und wünscht sich, etwas davon zu hören … normalerweise sagen die Leute in so einem Fall ›Hey, das neue Dylan-Album‹, aber heute Abend? Fehlanzeige!«
Später rief jemand an und wollte noch einmal »Blue Moon« hören. Am Ende lief alles darauf hinaus, ob es die Bewohner von Radioland tatsächlich kümmerte. Der DJ bat weiterhin um Entschuldigung: »Wenn es jemanden gibt, dem das komplette Album vorgespielt werden sollte, dann ist das Bob Dylan – er hats verdient.«
(2) Nach einem verpatzten Anfang beginnt »Alberta #1«, ein alter Song, für den Dylan jetzt die Urheberschaft beansprucht. Eine Zeile sticht heraus: »I’ll give you more gold than your apron can hold.« Wir befinden uns noch immer an der Grenze zum Wilden Westen. Die nostalgische Gefühle hervorrufende Mundharmonika führt einen in das Album hinein, und was zählt, ist das Versprechen des Songs, nicht der Song als solcher, denn der verklingt.
(3) »Was war das?«, sagte ein Freund von mir, nachdem wir uns zum ersten Mal dreißig Minuten von Self Portrait angehört hatten. »Sind wir 65, 66 dermaßen leicht zu beeindrucken gewesen? Kann es sein, dass das damalige Zeug gar nicht so gut war und das hier genauso gut ist? Sind diese anderen Scheiben vielleicht nur aus Versehen so stark gewesen?
Mein Leben wurde damals völlig umgekrempelt, diese Sachen beeinflussten mich wirklich. Ich weiß nicht, ob es die Platten waren oder die Worte oder der Sound oder der Lärm – oder vielleicht dieses Interview: ›Woran kann man denn noch glauben?‹ Ich bezweifle allerdings, dass er das heute auch noch sagen würde.«
Wir legten »Like a Rolling Stone« vom Album Highway 61 Revisited auf und hörten es uns gemeinsam an. »In den letzten paar Monaten habe ich mir diesen Song fünf- oder zehnmal pro Tag angehört, während ich mir den Arsch aufgerissen habe, während ich mich darauf vorbereitet habe, an der Uni zugelassen zu werden – doch was Dylan jetzt damit angestellt hat, ist einfach nicht auszuhalten …«
(3) So etwas wie eine Stimmung verpufft bei der ersten Nashville-Nummer, »I Forgot More Than You’ll Ever Know«, einer professionellen Übung in kontrolliertem Gesang, die ein bisschen Zeit ausfüllt. Nachdem er der Welthauptstadt der Countrymusik zunehmend näher gerückt ist – und mit Nashville Skyline, dem hübschesten Rock-’n’-Roll-Album aller Zeiten, noch immer eine gewisse Distanz zu ihr gewahrt hat –, kehrt der Besucher nun zurück, um der Stadt die Ehre zu erweisen, einige ihrer Songs aufzunehmen. Und wie klingt das? Es klingt okay. Er hat sich in eine Ecke gesungen. Es klingt okay. Nimm die Band unter Vertrag!
(4) GM: »Dieses Album ist so ambitionslos.«
JW: »Was wir in diesen Zeiten vielleicht am meisten brauchen, ist ein ambitionsloses Album von Bob Dylan.«
GM: »Nein, was wir am meisten brauchen, ist ein ambitionierter Dylan.«
JW: »Es ist ein so …«
GM: »… es ist aber ein wirklich …«
GM & JW: »… freundliches Album.«
(4) »Days of ’49« ist eine schöne alte Ballade. Am Anfang, als Dylan die Jahre des Songs Revue passieren lässt (man achte auf die leichte Verbitterung, mit der er die Zeile »But what cares I for praise?« singt), ist er absolut überzeugend. Doch später im Song beginnt er zu patzen und die Aufnahme fällt in sich zusammen, trotz des tiefen Brummens der Blasinstrumente und des vom Piano entfesselten Dramas. Es ist eine zaghafte Darbietung, ein Aufwärmen, kaum mehr als eine Übungsaufnahme. Von den Tiefen der Geschichte, die dieser Song heraufbeschwört – von der mit Pathos gesättigten Geschichte, wie Johnny Cash sie bei »Hardin Wouldn’t Run« (das so klingt, als sei es im Schatten eines Canyons in Arizona aufgenommen worden) oder bei »Sweet Betsy from Pike« präsentierte –, ist hier rein gar nichts zu spüren. Der Song hätte es verdient gehabt, mit mehr Mühe aufgenommen zu werden.
(5) »Es ist schwer«, sagte er. »Für Dylan ist es schwer, etwas Reales zu erschaffen, von der Welt abgeschottet, wie er ist, an der Welt nicht interessiert, vielleicht auch ohne einen Grund, warum er es sein sollte. Womöglich lastet das Gewicht dieser Zeiten zu stark auf ihm. Womöglich ist der Rückzug ins Private eine Entscheidung, die wir alle treffen würden, wenn wir es könnten …« Man wird daran erinnert, dass in Zeiten der Krise und der Zerstörung keine Kunst entsteht – vielleicht weil sie nicht gehört werden kann. Kunst entsteht in der Periode der Dekadenz, die einer Revolution vorausgeht, oder nach der Sintflut. Sie ist das Vorspiel zu einer Revolution; sie fällt nicht mit dieser zusammen, außer in der Erinnerung.
Doch inmitten solcher Zeiten machen sich Künstler hin und wieder daran, die Geschichte neu zu schreiben. Das erfordert einen gewissen Ehrgeiz.
(5) Bedenkt man, wie einfallsreich die Instrumentalbegleitung auf Dylans Platten einmal gewesen ist, so kann einen die extrem konventionelle Qualität der meisten Musik auf Self Portrait schon irritieren. Das ist alles so uninteressant. »Early Morning Rain« ist eine der kraftlosesten Darbietungen, die auf dem Album zu hören sind; ein ziemlich sentimentaler Song, ein steifer, die Vokale exakt artikulierender Gesang und eine seichte Instrumentalbegleitung, die in etwa so sexy ist wie Gelächter vom Band.
(6) Die vier Fragen. Die vier Söhne betrachteten das Gemälde an der Museumswand. »Das ist ein Gemälde«, sagte der erste Sohn. »Das ist Kunst«, sagte der zweite. »Das ist ein Rahmen«, sagte der dritte Sohn und er äußerte es ziemlich schüchtern. Der vierte Sohn galt für gewöhnlich nicht als besonders helle, doch er begriff zumindest, warum sie überhaupt den weiten Weg von zu Hause auf sich genommen hatten und gekommen waren, um sich dieses Ding anzuschauen. »Das ist eine Signatur«, sagte er.
(6) »In Search of Little Sadie« ist eine alte Nummer, auch »Badman’s Blunder« genannt (manchmal auch »Badman’s Ballad« oder auch nur »Little Sadie«), die Dylan nun als seine eigene Komposition ausgibt. Wie »Days of ’49« ist es ein hervorragender Song – es sind Songs wie diese, die das vage Vorbild für die Musik von The Band sein könnten –, und was Dylan hier mit dieser Nummer anstellt, wie er sie auf eine Art Achterbahnfahrt schickt, lässt jede Menge Möglichkeiten erahnen. Doch auch hier wurde dem Gesang leider nicht die Zeit eingeräumt, sich entwickeln zu können, und der Song verliert die Kraft, die er vielleicht hätte ausstrahlen können – mit Ausnahme des letzten Refrains, wo Bob abhebt und richtig zu singen beginnt.
Dieser Tick, alles mit ein oder zwei Takes in den Kasten bekommen zu wollen, klappt jedoch nur, wenn man tatsächlich alles in den Kasten bekommt. Sonst deutet man dabei lediglich einen Song an, ohne wirklich Musik zu machen.
(7) Man stelle sich vor, wie ein Teenager auf Self Portrait reagieren würde. Seine älteren Geschwister haben Dylan seit Jahren vergöttert. Sie kommen mit dem neuen Album nach Hause und er kann einfach nicht verstehen, was daran so toll sein soll. Für ihn klingt Self Portrait nicht wie etwas, was er sich freiwillig anhören würde, sondern eher wie das Zeug, das seine Eltern sich anhören; tatsächlich sind seine Eltern gerade in die Stadt gefahren und haben Self Portrait gekauft und es ihm zum Geburtstag geschenkt. Er erwägt, es seinem alten Herrn zum Vatertag zurückzuschenken.
Für diesen Jungen ist Dylan ein Mythos – nicht weniger, aber auch nicht mehr. Dylan ist nicht real und das Album hat mit der Realität nichts zu tun. Der Junge hat Bob Dylan noch nie gesehen und er hat es auch nicht vor. Er sieht keinen Grund, warum er es wollen sollte.
(7) Die Everly-Brothers-Version von »Let It Be Me« bringt einen zum Weinen, während Bob Dylans Version einen allenfalls zum Hinhören veranlasst. Von der Emotion, die seinen Gesang sonst kennzeichnet, ist hier buchstäblich nichts mehr vorhanden. Es ist eine überaus förmliche Darbietung.
(8) »Bob sollte Nägel mit Köpfen machen: Er sollte den Bing-Crosby-Look wiederbeleben und sich in einen bunt karierten Country-Club-Freizeitsakko mit Schulterpolstern, fünf Schließknöpfen und breitem Kragen schmeißen (Pendelton stellt diese Jacken vermutlich noch immer her). Und wie schon dem Bingle würde es auch Dylan gut zu Gesicht stehen, wenn er eine langstielige Bruyèrepfeife in seine Bühnenshow einbauen und gelegentlich innehalten würde, um diese anzustecken, ein bisschen daran zu paffen und kurz gen Horizont zu blicken, bevor er [dies stammt aus John Burks’ Plattenbesprechung in Rags, Juni 1970] in die nächste Zeile von ›Peggy Day‹ einsteigt. Und für sein Finale – die große ›Blue Moon‹-Ausstattungsnummer mit jeder Menge Showgirls und einer von Spotlights angestrahlten Gebirgskulisse – macht er noch rasch einen Kostümwechsel und schlüpft in eines dieser in den 1920er-Jahren üblichen Stehkragenhemden mit rautenförmiger Fliege und, natürlich, in einen Frack mit langen Schößen samt Hosen mit seidenen Atlasstreifen und dazu noch eine Nelke im Knopfloch, wie Dick Powell in der Verfilmung des Broadway-Musicals Gold Diggers of 19334. Und dann schreitet Dylan, mit einem Zahnpastalächeln auf dem Gesicht, den Laufsteg hinunter, in seinem Frack, in der einen Hand seine Bruyèrepfeife, in der anderen sein Megafon: ›Like a roll-ing stone … ‹«
4 Goldgräber von 1933 (Regie: Mervyn LeRoy, USA 1933).
(8) »Little Sadie« ist eine alternative Aufnahme von »In Search of …«. Ich wette, wir werden im nächsten Jahr jede Menge Alternativtakes zu hören bekommen, insbesondere von Bands, denen das Material ausgegangen ist und die auf dem Markt präsent bleiben wollen, ohne sich dabei ein Bein auszureißen. Bei der Nebeneinanderstellung von unterschiedlichen Aufnahmen ein und desselben Songs kann es um wichtige musikalische Gesichtspunkte gehen, doch normalerweise dienen Alternativtakes der schamlosen Leichenfledderei, denn mit ihnen lässt sich noch mehr Kohle aus der Kunst Verstorbener herausquetschen oder sie werden als Füllmaterial verwendet, um eine Plattenseite vollzubekommen. Genau das macht »Little Sadie«, allerdings auf eine nette Weise.
(9) »Es ist ein Highschooljahrbuch. In diesem Jahr mit Farbfotos, weil es einen Überschuss vom letzten Jahr gibt, und auch mit mehr Seiten als üblich, eine sentimentale Reise, ein ›Was wir so gemacht haben‹ – es ist nicht besonders interessant, es ist eine Erinnerung an etwas, es gibt dort Platz für Autogramme, jede Menge weiße Flächen, und nicht ein einziger Name wurde ausgelassen … Es ist ja schließlich Juni.«
(9) »Woogie Boogie« ist amüsant. Die Band klingt, als stolpere sie über sich selbst (oder als rutsche sie auf ihren Overdubs aus), aber sie gerät nicht aus dem Takt. In dieser Aufnahme steckt mehr von Dylans Musikalität als in jedem anderen Track von Self Portrait. Wäre ich ein Plattenproduzent, der die Self-Portrait-Tapes nach Stücken durchkämmt, die man veröffentlichen könnte, so würde ich »Woogie Boogie« vielleicht als Single auswählen – als Rückseite von »All the Tired Horses«.
(10) Self Portrait ähnelt in vielerlei Hinsicht dem Dylan-Album, das ihm vorausgegangen ist: Great White Wonder. Es handelt sich um ein Doppelalbum, meisterlich zusammengestellt aus einer sonderbaren Kollektion von überwiegend mittelmäßigen, im vergangenen Jahr eingespielten Songs, mitsamt Alternativtakes und Aufnahmen, die unvermittelt abbrechen oder unkonzentriert beginnen, sowie mit Studiokommentaren und allen möglichen Patzern – sozusagen direkt von der Aufnahmekonsole auf Ihren Plattenteller. Ein bisschen was aus Nashville, einige Kostproben vom Festival auf der Isle of Wight, das Sie bestimmt verpasst haben, ein paar weitgehend belanglose Sessions aus New York, aber, hey, es ist Dylan, und wenn Sie Great White Wonder, Stealin’, John Birch, Isle of White und A Thousand Miles Behind schon immer haben wollten, so wird Self Portrait dieses Bedürfnis sicher befriedigen.
Oder wird es doch nicht. Es ist richtig, dass all diese Bootlegs auf den Markt kamen, als es keine neue Musik von Dylan gab, doch ich glaube, ihre Veröffentlichung hatte nichts mit dem Ausbleiben neuer Aufnahmen zu tun, sondern mit der Abwesenheit des Mannes selbst. Wir haben es hier schließlich mit einem Mythos zu tun, und je länger Dylan das Licht der Öffentlichkeit meidet, umso mehr Gewicht wird allem beigemessen, was er früher einmal gemacht hat. Wenn König Midas seine Hand ausstreckte, verwandelte sich alles, was er berührte, in Gold; es wurde wertvoll für jedermann, und obwohl Dylan diese Midas-Gabe nach wie vor besitzt, zieht er es vor, seine Hand nicht auszustrecken. Das Sammeln von Tapes mit alten Dylan-Aufnahmen ist erst in den beiden letzten Jahren zu einem landesweiten Phänomen geworden und es sind zahllose Tapes im Umlauf, die bislang nicht als Bootleg erhältlich sind. Mitunter scheint es so, als sei jeder öffentliche Auftritt Dylans mitgeschnitten worden, und es wird alles zusammengetragen. Früher oder später wird es den Bootleggern in die Hände fallen. In juristischer Hinsicht gibt es buchstäblich nichts, was Dylan unternehmen könnte, um diesem Treiben Einhalt zu gebieten.
Er kann den Diebstahl und den Verkauf seiner Rohentwürfe, seiner Geheimnisse und seiner Erinnerungen nur mit seiner Musik abwenden. Die Vitalität der auf den Raubpressungen erhältlichen Musik ist das, was ihren Reiz ausmacht. Es ist der Lärm dieser Musik. Self Portrait mag eine gute Bootleg-Imitation sein, doch die darauf enthaltene Musik kann der auf Great White Wonder nicht das Wasser reichen. »Copper Kettle« ist ein Meisterwerk, doch gegenüber »Killing Me Alive« verblasst es zur Bedeutungslosigkeit. Nashville Skyline und John Wesley Harding sind klassische Alben, doch so gut sie auch sein mögen, ihnen fehlt die Kraft der Musik, wie Dylan sie zur Mitte der Sechzigerjahre gemacht hat. Wenn er nicht auf den Markt zurückkehrt, mit einem Gefühl des Berufenseins und dem Ehrgeiz, seinem Talent gerecht zu werden, so dürfte die Musik jener Jahre seine neuen Aufnahmen weiterhin in den Schatten stellen, ob er sie nun veröffentlicht oder nicht. Wenn die Musik, die Dylan macht, nicht die Kraft besitzt, auf das Leben seines Publikums Einfluss zu nehmen – und Self Portrait fehlt diese Kraft –, so wird Dylans Publikum sich auch in Zukunft seiner Vergangenheit bemächtigen.
(10) Hat Dylan »Belle Isle« geschrieben? Vielleicht hat er das. Dies ist das erste Mal, dass ich beim Anhören eines neuen Dylan-Albums mit Verbitterung reagiert habe.
(11) In der Plattenindustrie wird Musik als »Produkt« angesehen. »In Kürze bringen wir ein neues Beatle-Produkt auf den Markt.« Als Columbias stürmisches Liebeswerben um Johnny Winter schließlich von Erfolg gekrönt war, wollten alle wissen, wann sie das entsprechende Produkt bekämen. Sie bekamen es in null Komma nichts, doch sie mussten sich noch ein wenig gedulden, bis sie Musik bekamen. Self Portrait, das bereits jetzt eine dreifache Goldene Schallplatte ist – so wie Walt Whitmans »O Captain! My Captain!« berühmter ist als sein »When Lilacs Last in the Dooryard Bloom’d« –, dürfte in Dylans bisheriger Karriere einem reinen Produkt am nächsten kommen, sogar noch mehr als Greatest Hits, denn so ein Album versucht nicht, sich den Anschein von Bedeutung zu geben. Der Zweck von Self Portrait erschöpft sich darin, dass es in erster Linie ein Produkt ist und dass es das Bedürfnis nach einem Produkt – nach einem »Dylan-Album« – befriedigt, und lassen Sie sich gesagt sein, dass das Bedürfnis nach einem solchen Produkt bei denjenigen, die es kaufen, mich eingeschlossen, genauso stark ist wie bei denjenigen, die es verkaufen, ja vielleicht sogar noch stärker.
Als ein zusammengestoppeltes Album ähnelt es Flowers5; doch im Unterschied zu Flowers gibt es vor, mehr zu sein, als es tatsächlich ist. Allein schon mit seinem Titel erhebt Self Portrait den Anspruch, das definitive Dylan-Album zu sein – was es vielleicht auch ist, auf eine traurige Weise –, doch es ist noch immer so etwas wie ein Versuch, dem Publikum vorzugaukeln, es bekomme mehr, als es tatsächlich bekommt, oder Self Portrait sei mehr, als es tatsächlich ist.
5 Das Album, das die Rolling Stones 1967 zusammenschusterten, während des sogenannten Sommers der Liebe (»Be Sure to Wear Flowers in Your Hair«), um angesichts des Riesenerfolgs des Beatles-Albums Sgt. Pepper etwas auf dem Markt vorweisen zu können.
(11) »Living the Blues« ist eine fabelhafte Aufnahme. Alle möglichen Funken der Begeisterung blitzen darin auf: die Dovells, wie sie lauthals nach dem »Bristol Stomp« verlangen, Dylan beim Schattenboxen mit Cassius Clay, Elvis, wie er in Jailhouse Rock6 grinst und feixt. Der Gesang ist großartig – achten Sie darauf, wie Bob das »deep down insyyy-hide« ausklingen lässt, wie er einen Schritt zurück macht und dann in die letzte Silbe hineinrutscht. Zum ersten Mal auf diesem Album klingt Dylan so, als werde er von der Musik, die er macht, mitgerissen. Die Rhythmusgruppe, angeführt von der Gitarre und vom Klavier, dem die herrlichsten Rock-’n’-Roll-Akkordwechsel entfahren, ist einfach wunderbar. Die Backgroundsängerinnen ziehen ihr Ding durch und sie klingen – süß. Dylan glänzt. Das Ganze verdient 100 Punkte.
6 Rhythmus hinter Gittern (Regie: Richard Thorpe, USA 1957).
(12) » … etliche Male dachte er daran, nicht nur sein Bakkalaureat abzuschließen, damit er an der Universität unterrichten konnte, sondern auch, so merkwürdig es klingen mag [dies ist ein Auszug aus ›A Rimbaud Chronology‹7], Klavierstunden zu nehmen. Am Ende ging er nach Holland, wo er sich, um in den Orient zu gelangen, bei der niederländischen Armee verpflichtete, und im Juni 1876 wurde er nach Java verschifft. Drei Wochen nach seiner Ankunft in Batavia [Charles Perry: ›Wir wissen, Dylan war der Rimbaud seiner Generation; es scheint, jetzt hat er sein Abessinien gefunden.‹ desertierte er, mischte sich eine Zeit lang unter die Dschungelbewohner und heuerte dann auf einem britischen Frachter an, dessen Ziel Liverpool war. Nachdem er einen Winter zu Hause verbracht hatte, ging er nach Hamburg, wo er sich als Dolmetscher und Manager einem Zirkus anschloss, um mit diesem durch Skandinavien zu ziehen, doch er konnte die Kälte nicht ertragen und wurde von Schweden in die Heimat zurückgesandt, nur um gleich wieder von zu Hause aufzubrechen, diesmal in Richtung Alexandria. Seine Reise wurde jedoch wieder von einer Erkrankung unterbrochen; in Italien schickte man ihn von Bord und zur Erholung verbrachte er dann ein Jahr auf dem Bauernhof in Roche. 1878 war er wieder in Hamburg, um von dort aus nach Genua zu gelangen, wo er ein Schiff nach Fernost zu finden hoffte. Er versuchte ein weiteres Mal, die Alpen zu Fuß zu überqueren, wobei er beinahe einem Schneesturm zum Opfer fiel. Von Mönchen gerettet und in deren Hospiz wieder aufgepäppelt, schaffte er es nach Genua und erwischte dort ein Schiff nach Alexandria, wo er sich eine Zeit lang als Landarbeiter durchschlug. In Suez, wo er auf dem Weg nach Zypern aufgehalten wurde, verdingte er sich als Schiffsverschrotter und half dabei, ein Schiff abzuwracken, das an der gefährlichen Küste von Guardafui gestrandet war. Einen großen Teil der ersten Hälfte des Jahres 1879 verbrachte er als Vorarbeiter in einem Wüstensteinbruch auf Zypern und im Juni kehrte er heim, um eine Typhuserkrankung auszukurieren.«8�
7 Enthalten in Arthur Rimbaud, A Season in Hell and The Drunken Boat, New Directions Press, New York 1946, 1961, S. xvi.
8 Playboy, März 1966: »PLAYBOY: Ob es ein Fehler gewesen sein mag oder nicht, was hat Sie dazu bewogen, eine Rock ’n’ Roll-Laufbahn einzuschlagen? DYLAN: Leichtsinn. Ich verlor meine große Liebe. Ich begann zu trinken. Und ehe ich mich’s versehe, befinde ich mich mitten in einer Pokerpartie. Und als Nächstes in einem Würfelspiel. Ich wache in einem Billardsalon auf. Dann zerrt mich diese dicke mexikanische Lady vom Tisch und nimmt mich mit zu sich nach Philadelphia. Sie lässt mich in ihrem Haus allein, und es brennt nieder. Ich lande in Phoenix. Ich bekomme einen Job als Chinese. Ich beginne in einer Woolworth’s-Filiale zu arbeiten und ziehe bei einer Dreizehnjährigen ein. Dann taucht diese dicke mexikanische Lady aus Philadelphia auf und brennt das Haus nieder. Ich ziehe runter nach Dallas. Dort kriege ich einen Job als ein ›Vorher‹ in einer ›Vorher-Nachher‹-Werbung von Charles Atlas. Ich ziehe bei einem Botenjungen ein, der ein fantastisches Chili und Hotdogs zubereiten kann. Dann taucht diese Dreizehnjährige aus Phoenix auf und brennt das Haus nieder. Der Botenjunge – also, mit dem ist nicht gut Kirschen essen: Er rammt ihr ein Messer rein, und plötzlich bin ich in Omaha. Dort ist es saukalt, und dieses Mal klaue ich meine eigenen Fahrräder und brate mir meinen eigenen Fisch. Dann habe ich Glück und bekomme einen Job als Vergaser bei den Autorennen mit auffrisierten Schlitten, die donnerstagabends draußen vor der Stadt stattfinden. Ich ziehe bei einer High-School-Lehrerin ein, die nebenbei noch ein bisschen klempnert; sie ist nicht unbedingt attraktiv, hat aber einen speziellen Kühlschrank gebaut, der Zeitungspapier in Kopfsalat verwandeln kann. Alles läuft prima, doch dann taucht dieser Botenjunge auf und will mich abstechen. Natürlich brannte er das Haus nieder, und ich machte mich wieder auf den Weg. Der erste Typ, der anhielt und mich mitnahm, fragte mich, ob ich ein Star werden wolle. Was sollte ich dazu sagen? PLAYBOY: Und so wurden Sie zum Rock ’n’ Roll-Sänger? DYLAN: Nein, so bekam ich Tuberkulose.« Ich musste dies einfach zitieren!
(12) »Like a Rolling Stone« – Dylans größter Song. Er weiß es und wir wissen es auch. Nicht nur das, sondern auch der größte Song unserer Epoche, auf der damals erschienenen Single, auf Highway 61 Revisited, auf dem Tonbandmitschnitt von einer Darbietung 1966 in England mit den Hawks. Zu sagen, welche dieser Versionen die beste ist, wäre genauso schwer wie das Kunststück, das Robin Hood vollbrachte, als er den Pfeil seines Vaters spal-tete.
1965: »Hey! Wir habens getan. Zieht euch das rein, Leute! Wenn ihr könnt. Wenn ihr es aushalten könnt. ›Like a complete unknown‹ – ihr wisst, wie man sich da fühlt?«
Wir wussten es und fortan war Bob für uns der Größte. Alles, was seitdem gekommen ist, geht zurück auf diesen Griff nach der Macht, der »Like a Rolling Stone« seinerzeit gewesen ist.
»Könnt ihr mit diesem Zug Schritt halten?« Der Zug fährt nicht mehr; ich nehme an, es hängt davon ab, wo man seine Füße hingepflanzt hat.
Auf der Isle of Wight versiebt Dylan seine Zeilen, er singt in der ausdruckslosen Manier eines Countrysängers, auf und ab, schlägt sich irgendwie durch den Song, wobei ihm die Sache gegen Ende der zweiten Strophe fast vollends entgleitet. Man weiß nicht, ob er die dritte Strophe weglässt, weil er sie nicht singen will oder weil er sie schlicht und einfach vergessen hat. Angesichts dieser Leistung würde es einen nicht wundern, wenn die Lautsprecherboxen in Streik träten.
Self Portrait ist ein Album, das einen ruhigen Sound verlangt oder nahelegt. »Like a Rolling Stone« ist nicht »Blue Moon«, doch da Self Portrait im Großen und Ganzen eher »Blue Moon« als »Like a Rolling Stone« entspricht und da es ein abspielbares, wie aus einem Guss wirkendes Album ist, stellt man die Lautstärke niedrig ein. Spielt man diesen Song jedoch laut ab – sehr laut, bis alles verzerrt klingt und die Lautsprecher zu brummen beginnen –, so wird man merken, dass die Musiker der Band tatsächlich noch immer so hart rocken, wie sie können. Ihre Power wurde von dem Tontechniker, der die Nummer aufgenommen hat, halbiert, doch dreht man die Lautstärke auf, so kehrt diese Power wieder zurück.
Ein wenig von »Like a Rolling Stone« ist hier noch immer vorhanden. Ein großartiger Anfang, der eine Eroberung ankündigt: Levon Helm, wie er seine Trommeln über dem Motown-Marsch der Band ertönen lässt (Ba-Bamm, Ba-Rammm, Ba-Bamm, Ba-Rammm), wie er auf seine Becken eindrischt, dass diese klingen wie das zerschmetternde Glas beim Höhepunkt eines Autounfalls; und, das Beste von allem, Garth Hudson, wie er den Geist des Songs einfängt und bei jedem Refrain festhält. Gegen Ende der Darbietung, wenn er sein farbloses Gesinge hinter sich gebracht hat, kehrt Dylan in den Song zurück und dann entfachen er und die Band ein wildes Getöse, das mit einem metallenen Krachen und Bobs Schrei »JUST LIKE A ROLLING STONE« endet. Ja, ein wenig ist noch immer vorhanden.
1965: »BAMM! Once upon a time …« Der Song attackiert dich mit einer Flut von Erfahrungen und der Song reißt den Abgrund auf. »Und wie weit möchtest du dich ihm nähern?« »Nicht zu weit, gerade so weit, dass wir sagen können, wir sind ihm nahe gewesen.« Das reichte nicht. »Wenn du in den Abgrund blickst, dann blickt der Abgrund auch in dich hinein.« Er blickte einem aus »This Wheel’s on Fire« entgegen und aus »All Along the Watchtower«, doch es scheint, als sei Dylan nun von dessen Rand zurückgetreten.
Der Abgrund liegt nun verborgen, wie die in Vergessenheit geratene Mine eines verstorbenen Goldgräbers. »Like a Rolling Stone«, wie wir es auf Self Portrait zu hören bekommen, ähnelt dem Fragment einer vergilbten Landkarte, die zu jener vergessenen Mine zurückführt.
(13) Ich habe einmal gesagt, ich würde sogar ein Album kaufen, auf dem Dylan nichts weiter tut, als schwer zu atmen. Das würde ich immer noch. Jedoch kein Album, auf dem Dylan friedlich atmet.
(13) Wie kommt es, dass »Copper Kettle« dermaßen glänzt (ja, vielleicht sogar das Zeug zur Hitsingle hat), während so viele andere Nummern in ihrer eigenen Langeweile versacken? Warum ruft diese Darbietung alle möglichen Erfahrungen wach, während der überwiegende Teil von Self Portrait so eindimensional und beschränkt wirkt? Warum wächst einem »Copper Kettle« immer mehr ans Herz, während die anderen Songs an einem vorbeirauschen und keinen bleibenden Eindruck hinterlassen?
»Copper Kettle« ist genauso großartig wie »All the Tired Horses«. Da sind diese winzigen hohen Töne, die den Song durchsetzen, wie bei einer alten Ballade von Buddy Holly oder wie bei »The Three Bells« von den Browns, und da ist diese windschattenartige Orgel, so leise, dass man sie kaum hören kann – im Grunde hört man sie nicht, doch man spürt, dass sie da ist, auf eine unglaublich zarte Weise. Da sind die Kraft und die wahre Tiefe des Songs, die unsere Vorstellungen vom Schwarzbrennen – Klischees wie auf diesen Postkarten, die man in Fernfahrerlokalen in Tennessee bekommt – auslöschen und stattdessen eine Vision von der Natur heraufbeschwören, ein Ideal der Ruhe und der Gelassenheit – und eine rebellische Gesinnung, die zurückreicht bis in die Gründungszeit unserer Nation. »We ain’t paid no whiskey tax since 1792«, singt Bob, und das geht praktisch zurück bis zum Anfang, denn die Whiskeysteuer wurde im Jahr 1791 eingeführt. Es ist ein Song über die Revolte als eine Berufung – es geht nicht um eine Revolution, sondern bloß um Verweigerung. Alte Männer, die sich draußen in den Bergtälern verstecken und selbst für Recht und Ordnung sorgen. (In Thunder Road9 haben sich die alten Schwarzbrenner um einen Ofen versammelt, um zu beratschlagen, wie sie mit den Mobstern verfahren sollen, die in das Tal eindringen, das sie seit den Tagen des Unabhängigkeitskrieges als das ihrige betrachten. »Blaf sprat muglmmph ruuurp ffft«, sagt einer von ihnen. Im Publikum wird es unruhig, denn die Leute werden nicht schlau aus dem Appalachendialekt des Mannes. »Wenn du den Tabak aus dem Mund nimmst, Jed«, sagt ein anderer Whiskeymann, »würden wir vielleicht verstehen, was du sagst.«)
9 Kilometerstein 375 (Regie: Arthur Ripley, USA 1958).
Was hier zählt, ist Bobs Gesang. Er ist der originellste Sänger der letzten zehn Jahre gewesen. Er erfand seine eigene Art der Betonung und brachte fünf Wörter in einer Zeile unter, die Platz für zehn geboten hätte, und zehn in einer Zeile, die eigentlich nur für fünf reichte. Er schubste die Wörter herum und öffnete Räume für Lärm und Stille, die durch Überfall oder Verführung oder durch die Gabe eines guten Timings Raum für Expression und Emotion schufen. Jede gesangliche Darbietung war eine Überraschung – man konnte nie vorhersagen, wie sie klingen würde. Der Song als solcher, die Struktur des Songs, lieferte dafür kaum einen Anhaltspunkt. Die Grenzen waren da, um umgangen zu werden. In »Copper Kettle« geschieht all dies, und das ist insofern bemerkenswert, als es das einzige Mal auf Self Portrait ist, wo es geschieht.
»Große Poeten – wie zum Beispiel Wallace Stevens – sind nicht zwangsläufig große Sänger«, sagte Dylan vor einem Jahr. »Aber große Sänger sind immer große Poeten – eine Sängerin wie Billie Holiday zum Beispiel.« Diese Art von Poesie – und es ist diese Art von Poesie, die Dylan wie einen Dichter erscheinen ließ – ist überall in »Copper Kettle« vorhanden, in der Art und Weise, wie Bob sich auf die Wörter »… or ROTTEN wood …« stürzt und wie er das Ganze mit einem gedämpften »they’ll get you – by the smoke« ausklingen lässt. Dass dem Rest des Albums der Charme von »Copper Kettle« fehlt, liegt nicht daran, dass das Album anders oder neu ist. Das entscheidende Kriterium ist, ob die Musik Kraft hat oder nicht.
(14, 15, 16) »… in finanzieller Hinsicht überaus erfolgreich. In der Vergangenheit sind Dylans Konzerte von seiner eigenen Firma, Ashes and Sand, gebucht worden [dies stammt aus dem Rolling Stone vom 7. Dezember 1968] und nicht von privaten Promotern. Laut Variety sprechen Promoter derzeit von einer durch zehn Städte führenden Tournee mit der Möglichkeit zusätzlicher Termine.
Greta Garbo wird sich vielleicht ebenfalls aus dem Ruhestand zurückmelden, um eine Reihe persönlicher Auftritte zu absolvieren. Man munkelt, die schwedische Filmdiva – die ›in Ruhe gelassen‹ werden wollte, nachdem sie sich wiederholt von Reportern belästigt gefühlt hatte – fasse eine Reihe opulenter Bühnenshows ins Auge, möglicherweise gemeinsam mit Dylan …«
Und wir würden reglos dasitzen und gaffen.
(14) »Gotta Travel On«. Dylan singt »Gotta Travel On«.
(15) Wir verstehen »Blue Moon« als einen Scherz, als eine stilisierte Apotheose des Kitsches oder als einen weiteren musikalischen Beweis für Dylans Rückzug aus der Popszene. Doch auf Elvis’ Debütalbum gibt es eine andere Version von »Blue Moon«, eine tiefe und bewegende Darbietung, die die Möglichkeiten des Songs auslotet und die das Scheitern von Dylans Aufnahme zutage treten lässt.
Hufschlag, dezent unterstützt von Kontrabass und Gitarre, bildet den Background für einen Gesang, der einen Friedhofswind durch die Zeilen des Songs wehen lässt. Elvis bewegt sich vor und zurück, mit einem hohen, gespenstischen Wimmern – der Part, den Doug Kershaw bei Dylans Version auf der Fiddle spielt –, und schließlich antwortet er sich selbst, mit einem dunklen Murmeln, das unversehens verstummt. »Das ist eine Offenbarung«, sagte ein Freund von mir. »Es ist einfach unglaublich.«
An »Blue Moon« ist nichts banal. Nach formalen musikalischen Kriterien ist Dylans Darbietung buchstäblich eine Coverversion der Aufnahme von Elvis, doch während der eine bloß in die Richtung des Songs singt, singt der andere von dahinter, von der anderen Seite.
(16) »The Boxer«. Erinnern Sie sich noch an Paul Simons »How I Was Robert McNamara’d into Submission« oder wie das hieß? An die liebevolle Zeile »I forgot my harmonica, Albert«? Oder an Eric Andersens »The Hustler«? Vielleicht bedeutet diese Nummer ja: »Hey, Schwamm drüber!« Mein Gott, ist das schauderhaft!
(17) Bevor er ins Studio ging, um die Weathermen auf die Beine zu stellen, verfasste er das erste Positionspapier der Yippies, auch wenn Abbie Hoffman ein paar Jahre benötigte, um es zu finden, und Jerry Rubin Schwierigkeiten hatte, es zu enträtseln. Eine Kostprobe:
»Ich werde mir die Haare bis runter zu den Füßen wachsen lassen, sodass ich aussehe wie eine wandelnde Gebirgskette, und dann reite ich auf einem Pferd in Omaha ein, zum Countryclub und hinaus zum Golfplatz, mit einer New York Times unterm Arm, spiele ein paar Löcher und haue alle von den Socken.«
»Dylan wird kommen«, sagte Lang.10
10 Michael Lang, einer der Organisatoren des Woodstock-Festivals von 1969.
»Ach, red keinen Scheiß [sagte Abbie Hoffmann in seinem Woodstock Nation], er wird heute Abend in England sein. Also verarsch mich nicht!«
»Nein, ich verarsche dich nicht, Abby-Baby. Er hat mich angerufen und gesagt, er werde vielleicht kommen …«
»Glaubst du, er hätte Bock, für die Präsidentschaft zu kandidieren?«
»Nein, das ist nicht sein Ding. Er fährt auf andere Sachen ab.«
»Du kennst ihn persönlich, Mike? Worauf fährt er denn ab?«
»Ich weiß nicht so genau, aber nicht unbedingt auf Politik. Bist du ihm jemals begegnet?«
»Ja, ein einziges Mal, vor sieben Jahren, in Gertie’s Folk City, unten im West Village. Ich wollte ihn dazu bewegen, bei einem Benefizkonzert für die Bürgerrechte oder etwas in der Art aufzutreten … hey, Mike, kannst du mich mit ihm bekannt machen? Sonst könnte ich nur über Happy Traum an ihn rankommen …«
»Das kannst du auch einfacher haben … Abbs … ich werde dich ihm vorstellen. Er möchte dich nämlich kennenlernen.«
Würde Self Portrait Sie dazu veranlassen, Dylan kennenlernen zu wollen? Nein. Ist das Album vielleicht dazu gedacht, Sie von ihm fernzuhalten?
(17) »The Mighty Quinn« klingt, als wäre man gern dabei gewesen. Auf Platte ist das Ganze ein ziemliches Chaos und die Soundqualität ist auch nicht viel besser als die auf dem Bootleg. Der Isle-of-Wight-Auftritt sollte ursprünglich als Album veröffentlicht werden und es ist offenkundig, warum das nicht passiert ist – auf Tonband klang der Auftritt einfach mies. Die Darbietungen waren in der Regel unbeholfen oder lustlos und zusammen hätten sie eine lausige Platte ergeben. Dem Bootleg nach zu urteilen hatten zwei der Songs jedoch etwas Besonderes an sich, doch keiner davon schaffte es auf Self Portrait. Der eine war »Highway 61 Revisited«, wo Bob und die Band wie mexikanische Reiseleiter schrien, die potenzielle Kunden zu einer Tour die Straße hinunter animieren wollten: »OUT ON HIGHWAY SIXTY-ONE!« Der andere war »It Ain’t Me Babe«. Dylan sang solo, wobei er Gitarre spielte wie ein Poet und dem Song eine neue Identität verlieh, indem er in die Formulierungen und Erinnerungsspuren hinein- und hinausglitt. Er klang ein bisschen wie Billie Holiday.
(18) Es ist in der Tat ein sonderbares Selbstporträt: anderer Leute Songs und Songs, die schon etliche Jahre auf dem Buckel haben. Sollte der Titel ernst gemeint sein, so liegt Dylan offenbar nicht mehr viel daran, Musik zu machen und dabei eine eigene Identität herauszustreichen. Es gibt hier eine merkwürdige Tendenz zur Zurückhaltung: Dylan, wie er sich von einer Position zurückzieht, von der aus er Macht ausüben könnte. Er erinnert einen an den Herzog von Windsor, der auf den Thron verzichtet. Danach verschwindet er einfach, und alle Jubeljahre bekommt man ein Pressefoto zu sehen, auf dem er irgendwo in ein Flugzeug steigt.
(18) »Take Me as I Am or Let Me Go«. Die Nashville-Aufnahmen von Self Portrait hauen einen nicht unbedingt vom Hocker, doch sie sind nicht unangenehm – sie ergeben, in ihrer Gesamtheit, ein sentimentales kleines Countrymelodram. Wäre das Album so zusammengestellt worden, dass es mit »All the Tired Horses« beginnt und mit »Wigwam« endet, und mit den Nashville-Tracks zwischen diesen beiden Klammern, so hätte man eine passable Platte bekommen, über die sich niemand groß aufgeregt hätte, eine Art musikalisches Pendant zu dem Zaubertrick, bei dem sich jemand in Luft auflöst. Doch der KÜNSTLER muss ein STATEMENT von sich geben, egal ob es sich dabei um Bob Dylan, um die Beach Boys oder um Tommy James and the Shondells handelt. Er muss ins Studio gehen und es mit einem Meisterwerk wieder verlassen. Gelingt dem Künstler dies nicht oder hat er sich gar nicht erst darum bemüht, so unternimmt man hinterher zumindest den Versuch, das Ganze so aussehen zu lassen, als sei es ihm gelungen. Würde Dylan mehr Musik veröffentlichen, als er es in letzter Zeit getan hat – sagen wir mal, drei Singles pro Jahr und etwa alle sechs Monate ein Album –, so würde man dem, was er veröffentlicht, nicht dermaßen viel Gewicht beimessen. Doch für die größten Stars ist das Schema inzwischen vorgegeben – ein Album pro Jahr, wenn überhaupt. Für einen Künstler ist es ziemlich beschämend, wenn er mehr als ein Album pro Jahr herausbringt – weil das so aussieht, als habe er es nötig, verstehen Sie? Nun, ein dreifaches Hoch auf John Fogerty!
(19) Wegen der Dinge, die zur Mitte der Sechzigerjahre geschehen sind, ist unser Schicksal untrennbar mit dem von Dylan verknüpft, ob es ihm oder uns gefallen mag oder nicht. Weil Highway 61 Revisited die Welt veränderte, müssen die Alben, die ihm folgen, dies auch tun – jedoch nicht auf die gleiche Weise.
(19) »Take a Message to Mary«: Im Unterschied zu Dylan scheint dieser Song seiner Begleitband schnurz gewesen zu sein. Mein zehnjähriger Neffe hielt »It Hurts Me Too« für einen Scherz, doch er war sich sicher, dass dies hier ernst gemeint sei.
(20) Ralph J. Gleason: »In seiner Autobiografie spricht Max Kaminsky von diesem Typen, der ständig Platten stahl. Er stahl auch eine von Max. Er musste sie haben, verstehen Sie? Er musste sie einfach haben. Einmal wurde er festgenommen, weil er diese Platte in einer Jukebox hörte und mit seiner Faust die Glasscheibe des Kastens zertrümmerte, um sich die Platte zu schnappen.
Jeder von uns hat Platten, für die er stehlen würde, die er auf Teufel komm raus haben muss. Aber würden Sie dieses Album stehlen? Nein, dieses Album würden Sie nicht stehlen!«
Sie würden Self Portrait also nicht stehlen? Aber es würde auch Ihnen nichts zuleide tun. Vielleicht ist das ja die eigentliche Tragödie, denn bei den letzten beiden Alben von Dylan handelte es sich um Kunst, die einen Einbruch im Kopf des Zuhörers beging und ihn in Besitz nahm.
(20) Das Songschreiben kann nur unwesentlich älter sein als das Songstehlen. Letzteres ist ein Teil der Tradition. Es ist vielleicht sogar ehrenwerter als die unverhohlene Imitation – zumindest ist es nicht so langweilig.
Zu Beginn seiner Karriere klaute Bob Dylan, so wie jeder andere auf den Durchbruch hoffende junge Musiker, ein oder zwei alte Bluesnummern oder Folksongs und ließ sich diese, nachdem er daran ein oder zwei Wörter geändert hatte, urheberrechtlich schützen (am groteskesten war es, auf »That’s All Right« Anspruch zu erheben, denn das war immerhin Elvis’ erste Single gewesen und von Arthur Crudup geschrieben oder jedenfalls niedergeschrieben worden). Dylan verwendete auch ältere Balladen als Gerippe für seine eigenen Songs: »Bob Dylan’s Dream« ist eine Neufassung von »Lord Franklin’s Dream«; »I Dreamed I Saw St. Augustine« geht zurück auf »I dreamed I saw Joe Hill last night …«; »Pledging My Time« hat die Struktur, den Geist und auch eine Zeile von Robert Johnsons »Come on in My Kitchen«; und die Zeilen »Don’t the moon look lonesome, shining through the trees« sind ein Zitat aus einem alten Blues von Jimmy Rushing. »Subterranean Homesick Blues« machte Gebrauch von Chuck Berrys »Too Much Monkey Business«. Das ist eine nette Art, Geschichte zu schreiben und ihr einen Platz anzubieten, und es ist ein Teil der Schönheit und Zwangsläufigkeit der amerikanischen Musik. Doch auch wenn Dylan ein paar Wörter zu »It Hurts Me Too« beigesteuert haben mag, geht es nicht an, dass er nun Anspruch auf diesen alten Blues erhebt, den unter anderem Elmore James aufgenommen hat. Wenn Self Portrait durch Entlehnungen, Aneignungen und geistigen Diebstahl charakterisiert wird, so bedeutet das unter dem Strich, dass Bob etwas mehr Geld bekommt und Tausende von Leuten ein falsches Bild von ihrer eigenen Geschichte bekommen.
(21, 22) Diese herrliche Raserei, diese Kraft neuer Wertvorstellungen inmitten eines musikalischen Orkans der Zerstörung, dieser Krach, diese Vehemenz – die Totalität des Ganzen! Also sagte man, ja, genau, das ist es …
Die mythische Direktheit von allem, was Dylan tut, und der immense Einfluss, den jene Kraft nach wie vor auf unser Leben ausübt, beruhen auf den drei Alben und den zwei unvergesslichen Singles, die er 1965 und 1966 herausgebracht hat: Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited und Blonde on Blonde, »Like a Rolling Stone« und »Subterranean Homesick Blues«. Diese Platten definierten und strukturierten ein entscheidendes Jahr – bislang hat niemand an sie heranreichen können und wahrscheinlich wird das auch nie jemand schaffen. Damals passierte das, wonach wir alle Ausschau halten. Die Kraft jener Platten und die Kraft der Musik, die Dylan damals auf der Bühne präsentierte, sowie der auf dem Höhepunkt seiner Karriere vollzogene Rückzug aus der Öffentlichkeit – all dies ließ ihn zur Legende werden und machte seinen Namen buchstäblich zu einem eigenständigen Begriff. Es gewährte Dylan die Freiheit, zurückzutreten und mit allem durchzukommen, wonach ihm der Sinn stand, in kommerzieller wie in künstlerischer Hinsicht. Die Tatsache, dass nun mehr als ein Jahr zwischen zwei Alben verstreicht, erhöht deren Wirkungsgrad, auch wenn sie sehr viel weniger zu bieten haben als jene älteren Alben, die Dylans Machtposition überhaupt erst begründet haben. Tatsächlich profitiert Dylan von dem Schatz, den er 65 und 66 angehäuft hat, von dem Mythos, dem Ruhm und der Verehrung, die ihm damals zuteilwurden. Unter dem mythischen Gesichtspunkt muss er nichts Gutes tun, weil er bereits Gutes getan hat. Man fragt sich jedoch, wie lange er damit, in mythischer Hinsicht natürlich, noch durchkommen wird.
(21) »Minstrel Boy« ist die beste Nummer des Isle-of-Wight-Auftritts, eine völlig entspannte Angelegenheit.
(22) Die Band spielt hübsch bei »She Belongs to Me« und Dylan absolviert seinen Gesang auf die gleiche Weise, auf die er früher durch die erste Hälfte eines Konzerts hastete, um die vom Publikum erwarteten Evergreens hinter sich zu bringen und sich dann der Musik widmen zu können, die ihm wirklich am Herzen lag. Der beste Moment des Songs gehört Garth Hudson.
(23) Beruf als Berufung. Dylan ist, wenn er will, ein Amerikaner mit einer Berufung. Man könnte es beinahe als eine göttliche Berufung bezeichnen – die alte puritanische Vorstellung von einer Gabe, der man gerecht werden muss –, doch das ist es nicht und Berufung allein reicht vollkommen aus.
Für einen amerikanischen Künstler gibt es keinen reichhaltigeren Stoff als den Geist und die Themen seines Landes sowie dessen Geschichte. Wir haben nie herausbekommen, was genau dieser Ort ist und wozu er da ist, und der einzige Weg, diesen Fragen wenigstens ansatzweise auf den Grund zu gehen, besteht darin, uns unsere Filme anzusehen, unsere Dichter zu lesen, unsere Romanschriftsteller, und uns unsere Musik anzuhören. Robert Johnson und Melville, Hank Williams und Hawthorne, Bob Dylan und Mark Twain, Jimmie Rodgers und John Wayne. Amerika ist das Lebenswerk des amerikanischen Künstlers, weil er dazu verdammt ist, ein Amerikaner zu sein. Dylan hat ein Gefühl dafür; sein Instinkt scheint ihn in die vergessenen Bereiche unserer Geschichte zurückzuführen und sogar auf Self Portrait ist davon noch ein bisschen zu spüren – er scheint nahe daran, einen Western zu schreiben. Doch diese Berufung erfordert einen gewissen Ehrgeiz, und hier gibt es nicht genug davon, sondern lediglich den Ansatz dazu, ohne die Entschlossenheit, sich näher mit der Sache zu befassen.
Dylan hat eine Berufung, wenn er will; Dylans Publikum dürfte sich weigern, seine Verweigerung hinzunehmen, solange er nicht einfach verschwindet. Inmitten jener Berufung steckt womöglich so etwas wie ein Hamlet, der Fragen stellt, alte Fragen, denen ein Hauch von Magie anhaftet – jedoch kaum ein Prophet, sondern bloß ein Mensch mit einem wachen Blick.
(23) »Wigwam« führt das Album langsam seinem Ende entgegen. Lagerfeuermusik, oder »3 A. M., After the Bullfight«. Das Arrangement der Nummer ist großartig und sie ist die B-Seite der zweiten, sich von selbst anbietenden Single, die das Album enthält – die A-Seite wäre »Living the Blues«. »Wigwam« bringt einen zu Bett, und damit meine ich nicht, dass es einen zum Einschlafen bringt.
(24) Self Portrait, der Auteur und der Amateurfilm. »Auteur« bedeutet nichts weiter als Autor und in Amerika dient dieser Begriff neuerdings zur Charakterisierung von Kinofilmen: Filme werden (so wie Bücher) von Autoren gemacht, d. h. von Regisseuren. Das hat zu einer Maxime geführt, die in etwa Folgendes besagt: Bei Filmen geht es um die Persönlichkeit des Regisseurs. Wir sollen einen Kinofilm danach beurteilen, wie gut der Auteur seine Persönlichkeit im Vergleich zu früheren Filmen weiterentwickelt hat. Sein bester Film ist derjenige, der das Aufblühen seiner Persönlichkeit am vollständigsten widerspiegelt. Es versteht sich von selbst, dass ein solcher Ansatz eine Neigung zum Manierismus, zur Exzentrizität und zum Narzissmus fördert. Es stellt sich auch heraus, dass die größten Auteure diejenigen sind, bei denen diese Eigenheiten besonders stark ausgeprägt und am leichtesten wiederzuerkennen sind. Legt man diesen Maßstab an, dann ist Geraubte Küsse ein besserer Film als Jules und Jim, weil es in Geraubte Küsse nichts zu entdecken gibt außer Truffaut, während es in Jules und Jim diese Story gibt und diese Schauspieler, die einem ständig in die Quere kommen. Die Maxime des Auteuransatzes lässt sich auch auf andere Kunstformen übertragen und demnach ist Self Portrait ein besseres Album als Highway 61 Revisited, weil es bei Self Portrait um den Auteur, also um Dylan geht, während Highway 61 Revisited sich die Welt vornimmt, die dazu neigt, einem in die Quere zu kommen. (Auf Highway 61 Revisited könnte es natürlich auch um Dylan gehen, doch auf Self Portrait ist das offensichtlicher und deshalb ist dieses Album in puncto KUNST relevanter … aber fragen Sie mich bitte nicht nach der Musik, also ehrlich …)
Nun, man ist schon seit Jahren auf diese Weise an Dylan herangegangen, ob der Begriff »Auteur« dabei Verwendung fand oder nicht, und auch wenn es letztlich keine uninteressantere Weise geben mag, sich seine Musik anzuhören, ist dies hin und wieder ein Mordsspaß und ein Spiel, das viele von uns gespielt haben (in »Days of ’49« zum Beispiel singt Dylan die Zeile »just like a roving sign« und ich komme einfach nicht umhin, ihn »just like a rolling stone« singen zu hören und mich zu fragen, ob er das absichtlich vermieden hat). Ein Autor namens Alan Weberman verbringt sein Leben damit, Dylans Songs zu enträtseln, um daraus Rückschlüsse auf den Mann selbst zu ziehen; so wie früher jeder Künstler seinen Mäzen hatte, scheint heute jeder Auteur seinen Kritiker zu haben (Fortsetzung folgt).
(24) Self Portrait ist ein vom Fußboden des Schneideraums zusammengesammeltes Konzeptalbum, ungemein kunstvoll, jedoch als eine Vertuschung, nicht als eine Offenbarung. So markiert »Alberta #2« das Ende des Albums, nach einem falschen Schluss, so wie »Alberta #1« seinen Beginn markiert, nach einem falschen Anfang. Der Song bewegt sich zügig voran und er endet abrupt. Diese Alternativtakes füllen nicht bloß ihre jeweilige Plattenseite auf, nein, sie geben dem ganzen Album eine gewisse Struktur, denn es sind vor allem die vier an seinen beiden äußersten Enden untergebrachten Nummern, die Self Portrait zu einem abspielbaren Album machen. Bei einem Kreis sieht man eher die ihn umreißende Linie als das Loch in der Mitte.
(25) Self Portrait, der Auteur und der Amateurfilm (Fortsetzung). Wir alle spielen das Auteurspiel: Wir sind losgezogen und haben uns Self Portrait gekauft – nicht weil wir wussten, dass es sich um großartige Musik handelte (was durchaus möglich gewesen wäre, uns aber nicht an erster Stelle interessierte), sondern weil es ein Dylan-Album war. Was wir erwarten, ist freilich eine völlig andere Sache, und das unterscheidet uns in der Regel von Auteuristen: Wegen jener drei Alben von 65 und 66 erwarten wir großartige Musik – oder wir erhoffen sie uns zumindest.
Ich würde nicht so sehr auf dieser Sache herumreiten, hätte ich nicht den Verdacht, dass genau dieser Ansatz, oder eine Abart davon, als Rechtfertigung für die Veröffentlichung von Self Portrait dient, zumindest was die künstlerische Rechtfertigung betrifft (die kommerzielle Rechtfertigung ist etwas anderes: nämlich Selbstrechtfertigung). Der Auteuransatz gestattet es dem großen Künstler, seinen Ehrgeiz herunterzuschrauben und diesen nach innen zu kehren. Es scheint sich, grob gesagt, so zu verhalten, als ginge es eher um seine privaten Gewohnheiten als um seine Vision. Nähern wir uns der Kunst auf diese Weise an, so würdigen wir sie herab. Um dies zu verdeutlichen, befassen wir uns jetzt kurz mit dem zweiten Song auf John Wesley Harding, »As I Went Out One Morning«, und mit zwei unterschiedlichen Weisen, auf die man ihn hören kann.
Weberman hat dem Song eine feste Bedeutung zugewiesen: Demnach bezieht er sich auf ein festliches Diner, das das Emergency Civil Liberties Committee vor einigen Jahren abhielt und bei dem Bob Dylan der Thomas-Paine-Preis dieser Bürgerrechtsorganisation verliehen werden sollte. Dylan tauchte dort auf, äußerte in seiner Rede ein gewisses Verständnis für Lee Harvey Oswald und wurde daraufhin ausgebuht. Und laut Weberman wollte Dylan mit »As I Went Out One Morning« zum Ausdruck bringen, wie wenig ihm diese Buhrufe geschmeckt hatten.
Ich hingegen höre den Song mitunter als eine kurze Reise in die amerikanische Geschichte; der Sänger, wie er durch diesen Park schlendert, wie er sich mit einem Mal vor einer Statue von Tom Paine wiederfindet und über eine Allegorie stolpert: Tom Paine, das Symbol der Freiheit und der Revolte, von Schulbüchern und städtischen Standbildausschüssen mit der Rolle des Patrioten bedacht, wie er nun, im Einklang mit der Rolle des Patrioten, den Gesetzeshüter gegenüber einem Mädchen spielt, das in die Freiheit fliehen will – in Ketten, in den Süden, die Quelle der Vitalität in Amerika, in Amerikas Musik –, weg von Tom Paine. Wir haben unsere Geschichte auf den Kopf gestellt; wir haben unsere eigenen Mythen pervertiert.
Es wäre schon erstaunlich, hätte das, was ich gerade beschrieben habe, Dylan vorgeschwebt, als er den Song schrieb. Doch darum geht es nicht. Es geht darum, dass Dylans Songs als Metaphern dienen können, die unser Leben bereichern, die uns zufällige Einblicke in die Mythen gewähren, die wir mit uns führen, und in die Gegenwart, in der wir leben, Metaphern, die das, was wir wissen, intensivieren und die uns auf Dinge stoßen, nach denen wir nie gesucht haben, während sie diese Wahrnehmungen durch die Kraft der die Worte begleitenden Musik gleichzeitig mit einer emotionalen Intensität versehen. Webermans Art des Hörens, oder eher des Sehens, ist logischer, geradliniger und vielleicht auch richtiger, doch sie ist steril. Meine ist vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss, aber eine Möglichkeit, und ich glaube, in Dylans Musik geht es eher um Möglichkeiten als um Tatsachen, so wie eine Statue nicht bloß eine Ausgabe städtischer Haushaltsmittel ist, sondern ein Tor zu einer Vision sein kann.
Um mit Self Portrait zufrieden zu sein, müssen wir es womöglich mit den sterilen Begriffen des Auteurs erfassen, die sich in unsere Sprache übertragen ließen als »Hey, das ist total abgefahren! Dylan singt Simon and Garfunkel, Rodgers and Hart und Gordon Lightfoot …« Ja, es ist total abgefahren, auf eine traurige Weise, doch es ist auch öde, und wenn uns unsere ungelehrte Vorstellung vom Auteur dazu bringt, an diesem Album Gefallen zu finden, dann würdigen wir nicht nur unser eigenes Empfinden herab, sondern auch Dylans Fähigkeiten als amerikanischer Künstler. Dylan wurde nicht zu einer Kraft, die mit jeder ihrer Bewegungen die Kraft des Mythos ausstrahlt, indem er uns unzusammenhängende Bilder seiner eigenen Karriere präsentierte, als sei dies der einzige Film, der zähle – nein, er schaffte es, indem er sich die Welt vornahm, voller Angriffslust und mit den Mitteln der Verführung.
In ihrer Kritik an dem auf den Film bezogenen Auteuransatz zitiert die Schauspielerin Louise Brooks ein altes Wörterbuch und dieses Zitat bringt das Problem auf den Punkt: »Der Roman [der Film]« – der Song – »ist eine subjektive epische Komposition, in der es sich der Autor erlaubt, die Welt von seinem eigenen Standpunkt aus zu betrachten. Somit ist die entscheidende Frage, ob er einen Standpunkt hat. Alles Übrige wird sich von selbst ergeben.«
Bob Dylan, Self Portrait (Columbia, 1970).
––, Great White Wonder (1969). Das erste Dylan-Bootleg: ein Doppelalbum, zusammengestellt aus 1961 in Minnesota aufgenommenen Songs, Radioauftritten aus den frühen 1960er-Jahren, Basement-Tapes-Nummern und sogar einer Fernsehdarbietung von »Living the Blues«.
Elvis Presley, »Blue Moon« (1955, erstmals veröffentlicht auf Elvis Presley, RCA, 1956), enthalten auf Sunrise (RCA, 1999).
Louise Brooks in: Kevin Brownlow, The Parade’s Gone By …, Knopf, New York 1969, S. 364.