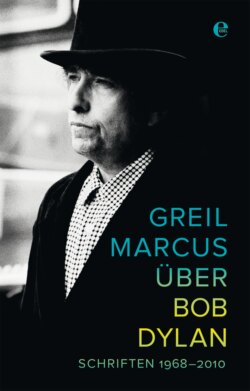Читать книгу Über Bob Dylan - Greil Marcus - Страница 8
ОглавлениеBangla Desh
Creem
März 1972
Vor einigen Tagen erlebte das komplette Bangla-Desh-Album seine Premiere im Radio, praktisch zeitgleich mit der vernichtenden Niederlage, die die indische Armee den westpakistanischen Streitkräften zufügte, und mit der Befreiung Ostpakistans, was dem Anliegen, das dieses Album überhaupt erst auf den Weg brachte, das süße Siegel der Geschichte verleiht. Zu dritt hörten wir uns die Darbietungen eine geschlagene Stunde lang an, obwohl wir zugegebenermaßen nicht so höflich waren wie das Publikum bei dem von George Harrison organisierten Benefizkonzert für Bangladesch, das im letzten August im New Yorker Madison Square Garden über die Bühne ging: Die erste halbe Stunde des Auftritts von Ravi Shankar schenkten wir uns. Dann begann der Harrison-Leon-Russell-Mad-Dogs-&-So-Weiter-Teil.
Ich fand das meiste davon langweilig und nach einer Weile begann mir die gesamte Show gehörig auf den Geist zu gehen. Die vielköpfige Band war zugegebenermaßen gut beieinander und hatte auch ausreichend geprobt. Harrison sang mit Überzeugung und Eric Clapton war spektakulär. Okay, das Ganze war gut produziert. Gut produzierte Hafergrütze. Jeder zweite Song schien um eines der drei folgenden Themen zu kreisen: 1) Gott ist unser Retter. 2) Was geschieht, entspricht Gottes Plan. 3) Preise den Namen des Herrn und du wirst frei sein. (Nick Tosches meint, diese Rezepte dürften der Bevölkerung von Bangladesch nicht allzu viel nützen; ganz schön gehässig, dieser Hinweis.)
All die frommen Rockmusiker auf der Bühne wussten offenbar nicht, was sie da von sich gaben, denn wenn dieser Stuss irgendeinen Bezug zur Wirklichkeit hatte oder auch nur eine innere Konsistenz – Gefahren des Pantheismus –, so ließ derselbe Gott, der uns dieses herrliche Konzert bescherte, auf der anderen Seite des Globus Tod und Verderben auf die Menschen herniederregnen. Vielleicht um eine Art spirituelles Gleichgewicht herzustellen.
Nun, mich erinnerte es an Joseph Hellers Gott, den gemeinen Witzbold. Die ausgewählten Songs sorgten dafür, dass der angebliche Anlass des Konzerts – Geld zu sammeln und weltweite Aufmerksamkeit für das Los der Kriegsflüchtlinge aus Ostpakistan sowie für den Freiheitskampf der Bangladescher zu erzielen – zur Farce wurde und ich glaube, das kommt auf Platte noch viel krasser rüber, als es beim Konzert selbst der Fall war, denn die rein akustische Präsenz der Stars ist nicht dazu geeignet, womöglich aufkommende Zweifel in einem blinden Begeisterungstaumel zu ersticken, ausgelöst von der leibhaftigen Präsenz Georges, Ringos und Bob Dylans. Aber das ist nichts, worüber man die Nase rümpfen sollte: Ich selbst wäre auch gern dabei gewesen. Doch ich wars nicht und so muss ich mich mit dem begnügen, was ich bekommen kann, so wie der Rest des Publikums, der auch nicht dabei war. Und was ich bekomme, ist das Gefühl, verraten und verkauft worden zu sein, erdrückt von einigen der albernsten Ideale der westlichen Zivilisation und bezirzt von einer Superstar-Aura, die es dennoch nicht vermag, die beinahe vollständige Leere dieser Produktion zu übertünchen.
In Harrisons »Beware of Darkness« gibt es eine Zeile, wo er warnt, »Beware of maya«. Maya ist das indische Wort für »Schleier der Illusion« – und ohne näher darauf einzugehen, dass die Vermeidung von Dunkelheit eine perfekte Definition von Illusion ist, muss hier gesagt werden, dass ein Schleier der Illusion genau das ist, was dieses Konzert zu bieten hat. Es gibt ein paar Ausnahmen von dem öden Sound, den fürchterlich unecht wirkenden Gospelschreien und den einfältigen Songs. Leon Russell unternimmt den tapferen Versuch, die wichtigtuerische Atmosphäre des Ereignisses zu unterlaufen, und präsentiert eine ausgelassene Version von »Jumpin’ Jack Flash«, die in ein scheinbar improvisiertes Geflunker übergeht, das in »Young Blood« von den Coasters mündet, bis das Ganze nach einer Weile wieder zu seinem Ausgangspunkt zurückstürmt. Das ist aufregend und sticht aus dem restlichen Ablauf des Konzerts ebenso stark heraus wie zwei weitere Höhepunkte, Ringos »It Don’t Come Easy« und Dylans letzte Nummer, »Just Like a Woman«. Das Genie dieses Mannes scheint derzeit in erster Linie durch Abwesenheit zu glänzen, doch zeigt es sich einmal, so verschlägt es einem den Atem und nichts und niemand kann daran heranreichen. Aaaah, Bob Dylan!
Eine der besten Sachen an der von Dylan bestrittenen Seite des Albums besteht darin, dass sie einem das Gefühl geben kann, wieder ein Fan zu sein. Ein Bob-Dylan-Fan. Es ist ergreifend, George Harrison sagen zu hören: »Ich möchte euch nun einen Freund von uns allen vorstellen, Mr. Bob Dylan«, und rückhaltlos in die Beifallsrufe des Publikums einzustimmen; bei sich selbst den Kitzel zu verspüren, den das Publikum verspürt; sich an dem Applaus zu ergötzen, der bei den Refrains aufbrandet, Refrains, die das Publikum und man selbst schon seit Jahren öffentlich bejubelt und privat genossen hat. Obwohl der Film unglaublich langweilig zu werden verspricht, werde ich ins Kino gehen, um mir anzuschauen, wie Ringo aussieht, wenn er Bob Dylan auf dem Tamburin begleitet.
Dylans Auftritt ist solide, aber der überwiegende Teil des von ihm präsentierten Materials scheint außer seiner Reichweite zu liegen, als bekäme er den emotionalen Rhythmus der Songs nicht richtig zu packen. Doch schon bei den ersten Klängen von »Just Like a Woman« wird klar, dass hier etwas anderes vor sich geht. Hier steigert er sich zu einer der großen Performances seiner Karriere. Er singt den Song so, wie Hank Williams ihn singen würde, wäre er noch am Leben, mit dem gespenstischen Kälteschauer von »Lost Highway«. Dies zählt mit zum Besten, was er jemals gemacht hat, und wenn er fünf Jahre gebraucht hat, um die Kraft wiederzuerlangen, die er einmal gehabt hat, so interessiert daran nicht, wie lange es gedauert hat, sondern dass er sie nun wieder hat. Was sich vor einigen Jahren als Änderung der Haltung einstellt, scheint sich nun zu einem geänderten Standpunkt entwickelt zu haben und zu einer echten, nicht gekünstelten Reife.
Seine Performance offenbart Nuancen von Gefühl und Engagement, die in der Aufnahme, die wir von Blonde on Blonde kennen, noch nicht einmal angedeutet zu sein scheinen. Was dem Song nun fehlt, ist das Gefühl der Verbitterung, das sich vor fünf Jahren nicht bloß als Klage, sondern auch als Verachtung manifestierte – diese Darbietung hier legt einen gewaltigen Schmerz in den schlichten Sachverhalt, dass man den Tag hinter sich bringen muss, bis sie schließlich, in der letzten Strophe, an Intensität zunimmt und Dylans Stimme einen Widerstand gegen das Elend des Lebens zum Ausdruck bringt, der sich gegen jede Form von Versöhnlichkeit sträubt.
Es gibt in diesem Song Wörter, die Dylan mit einer so gnadenlosen Intensität singt, dass sie vibrieren, wie die Zinken einer Stimmgabel. Da ist dieser Moment, wo er
I just don’t fit
singt und das erste Wort von den Deckenbalken des Saals widerhallt. Der Song hat genau die Eindringlichkeit, die Dylans Veröffentlichungen in den letzten Jahren gefehlt hat, eine Kraft, bei der einem vor Erstaunen und Wiedererkennen die Kinnlade herunterfällt. Er hat diese Kraft hin und wieder erreicht, etwa in der ersten Zeile von »All Along the Watchtower« – »There must be some way out of here« – oder in den langen, abschließenden Refrains von »George Jackson«, doch hier wird sie über die gesamte Dauer einer Performance aufrechterhalten: Man kann ihr nicht entkommen.
Dylans Eindringlichkeit bewirkt eine Erhellung und zugleich eine Vertiefung unseres Lebens, jedoch niemals in Gestalt einer oberflächlichen Glorifizierung seines oder unseres Lebens, sondern als eine Kampfansage an genau jene Einstellung, die nach so einer Glorifizierung trachtet. Und es ist nicht allzu schwer, diese Kraft zu definieren. Wenn Dylan sie hat, ist es gefährlich, ihm zuzuhören.
Der letzte Song des Albums ist »Bangla Desh«, eine Nummer, die sang- und klanglos in der Versenkung verschwunden ist, als Harrison sie als Single herausbrachte. Bei dieser Liveversion entfacht der Song ein solches Feuer, dass er zum Hit avancieren könnte, würde man ihn jetzt erneut veröffentlichen. Der Text wird zwar seinem ernsten Thema noch nicht einmal ansatzweise gerecht (»It sure seems like a mess«), doch vor allem Clapton schafft es, die Kraft hervorzuzaubern, die bis dahin in diesem Song geschlummert hatte. Der Sound, der die unvermeidlichen Bilder von Blutvergießen und unsäglichen Gräueltaten heraufbeschwört, ist fesselnd und zugleich beängstigend. Während er singt, schlägt Harrison mit den Fäusten auf jenen Schleier der Illusion ein und seine Worte schaffen es nicht, den Samtvorhang zu durchdringen, den dieses Konzert sich selbst übergeworfen hat – gewissermaßen, um die Veranstaltung vor dem Grauen ihres eigenen Themas abzuschirmen –, doch die Musik bricht diesmal durch und man bekommt so etwas wie eine Vorstellung davon, warum Harrison all diese Leute überhaupt zusammengetrommelt hat.
Für sage und schreibe drei LPs ist das nicht gerade viel. Ehrlich gesagt, kann ich niemandem empfehlen, sich dieses Album aus musikalischen Gründen zu kaufen, doch ich möchte Sie dazu ermuntern, das Radio nicht abzuschalten und sich die eine oder andere Darbietung anzuhören. Das aufgenommene Konzert ist ein ermüdendes Dokument einiger der peinlichsten Schwächen der Gegenkultur, doch tief in seinem Innern verbirgt sich auch eine Spur von der Kraft, die diese Kultur nach wie vor besitzt.
Der jämmerlichste Aspekt des Ereignisses ist jedoch dessen beinahe vollständiger Mangel an Risikobereitschaft, in künstlerischer wie in politischer Hinsicht. Bangladesch war ein unverfängliches Thema. Es ist immer leichter, sich mit den Problemen eines fernen Landes zu befassen, als sich in Situationen zu begeben, die einen selbst und, wenn man Musiker ist, sein Publikum unmittelbar betreffen. Der überwiegende Teil der bei diesem Konzert präsentierten Musik ist an Harmlosigkeit kaum noch zu unterbieten. Auch wenn viele Leute angedeutet haben, dass die Seele von Woodstock, die an jenem Tag in Altamont an den Teufel verkauft wurde, mit diesem Konzert zurückgekauft worden sei, sollten sie wissen, dass diese Seele nie mehr zurückgekauft werden kann, sondern neu erschaffen werden muss, unter Anerkennung der in dem ursprünglichen Pakt implizit enthaltenen Möglichkeit des eigenen Verderbens. Man findet keine Erlösung durch das Spektakel des Leids anderer, nein, man muss sich dem eigenen Leid stellen. Und deshalb gebührt Ringo das letzte Wort, egal was George über den süßen Herrn Jesus zu sagen weiß oder Billy Preston über die Pläne Gottes: Es ist nicht einfach!
The Concert for Bangla Desh (Apple, 1972, #2). Darbietungen von George Harrison, Ringo Starr, Bob Dylan, Eric Clapton, Billy Preston, Leon Russell, Ravi Shankar, Ustad Ali Akbar Khan, Ustad Alla Rakha und Kamala Chakavarty, begleitet von einer Band, bestehend aus Jesse Ed Davis, Tom Evans, Pete Ham, Mike Gibbins, Jim Keltner, Joey Molland, Don Preston, Carl Radle und Klaus Voorman, unter Mitwirkung der Bläser Jim Horn, Alan Beutler, Chuck Findley, Jackie Kelso, Lou McCreary und Ollie Mitchell sowie der Backgroundsängerinnen und -sänger Don Nix, Jo Green, Jeanie Greene, Marlin Greene, Dolores Hall und Claudia Linnear.