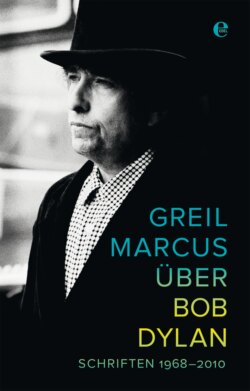Читать книгу Über Bob Dylan - Greil Marcus - Страница 12
ОглавлениеEin Moment der Panik
City
24. Juli – 6. August 1974
kombiniert mit
DYLAN/BAND
Village Voice
15. August 1974
Before the Flood (und was bedeutet das? Ein natürliches Pendant zu den im Januar veröffentlichten Planet Waves? Après moi le déluge?), das Livealbum der ausgedehnten Tournee, die Bob Dylan und die Band im letzten Winter absolviert haben, mit Aufnahmen fast ausschließlich vom letzten Abend in Los Angeles, wird sich womöglich als die am wenigsten gespielte Dylan-Platte seit Self Portrait erweisen. In der Presse heißt es, Dylans Gesang sei manieriert und seelenlos und die Musik sei schlampig und mechanisch; die Verwendung alter Songs sei nicht nur ein gescheiterter Versuch, eine glorreiche Vergangenheit wiederzubeleben, sondern auch ein Eingeständnis, dass er als Songwriter nichts mehr zu sagen habe; und er habe keine echte Beziehung mehr zu der Generation, der er einmal geholfen hat, sich selbst zu erkennen. Es heißt, über das Album lasse sich bestenfalls sagen, es ersetze die Fantasie und das Neuartige besserer Zeiten durch eine rein physische Energie.
Dylans Generation löste sich auf, als deren Mitglieder erwachsen wurden. Dylan kehrte seiner vermeintlichen Generation schon vor einiger Zeit den Rücken, genauso wie er das starre Korsett seiner alten Stile abwarf und sich einem größeren, vielschichtigeren Amerika zuwandte. Wer heute von »wir« spricht, wenn er über Dylans Publikum schreibt, der verwendet einen sehr schwammigen Begriff oder einen sehr veralteten. Dylan tritt inzwischen als ein amerikanischer Künstler auf, nicht als das Symbol einer Generation. John Wesley Harding war eine höchst intellektuelle Erkundung dessen, was es bedeutete, ein amerikanischer Künstler zu sein, ausgedrückt in Worten wie in Musik; Before the Flood bietet keine Ideen, sondern Leidenschaften, wobei seine Ziele jedoch die gleichen sind. Der alte Kontext ist zerbröckelt – Paul Nelson hat recht, wenn er meint, in Dylans neuer Musik werde das Zentrum nicht halten, doch das Zentrum liegt nicht in der Musik, sondern im Land selbst. Der Triumph von Dylans neuer Musik rührt daher, dass Dylan das Versagen des Zentrums – und, bezogen auf irgendeine Art von »Wir«-Generation, das Versagen an den Randbereichen – offenbar als etwas versteht, was ihm eine ungeheure Freiheit ermöglicht. Wenn das Versagen eine Gegebenheit ist, so ist es eine überaus belebende Gegebenheit.
Das ist es, was ich höre. Seitdem ich Dylan und die Band auf ihrer gemeinsamen Tournee gesehen habe und seitdem Before the Flood veröffentlicht worden ist, hat mich die neue Musik nicht mehr als ein Teil von Dylans Geschichte oder als ein Teil unserer Geschichte interessiert. Vielleicht ist es nicht der Kontext, der in Stücke zersprungen ist; vielleicht ist es die Musik selbst, die den Kontext zerschmettert. Diese Musik interessiert mich vielmehr als ein Ereignis – mich fasziniert die schlichte ästhetische Tatsache, dass sechs Typen auf eine Bühne kommen, ihr Ding durchziehen und die Bühne anschließend wieder verlassen.
Schalte ich heute das Radio an, so höre ich dort Paul McCartney, Elton John. Zu Hause lege ich Steely Dans Pretzel Logic auf, Roxy Musics Stranded oder These Foolish Things, dieses sonderbare Album voll neuer Oldies, das der Roxy-Sänger Bryan Ferry herausgebracht hat (er covert »A Hard Rain’s A-Gonna Fall«; er covert auch »It’s My Party«). Before the Flood entlarvt das eiskalte Kalkül dieser Platten. Sie sind dermaßen gut gemacht – sei es in rein produktionstechnischer Hinsicht (Paul und Elton) oder als umfassende Visionen der populären Kultur (Steely Dan, Roxy Music, Bryan Ferry) –, dass sie dem Zuhörer praktisch keinerlei Raum für eigene Kreativität lassen. Jede Spannung zwischen den Musikern und dem Publikum wird von vornherein unterbunden; die Reaktionen des Zuhörers sind vorausberechnet, und wenn der Künstler seinen Job versteht, landet man genau dort, wo er einen hinführen möchte. Daran gibt es im Grunde nichts auszusetzen. Man gelangt an allerlei interessante Orte. Auf einer Ebene sind solche Mittel und Zwecke die Essenz der populären Kunst. Kritiker, die sich vor Alfred Hitchcock verneigen, behaupten seit Jahren, es gehe bei dieser Art von Kunst allein um die Vollkommenheit der Manipulation. Doch große populäre Kunst, zum Beispiel großer Rock ’n’ Roll, führt ein Publikum – und, da wir hier von populärer Kunst reden, letztlich auch den Künstler – an Orte, die der Künstler, wenn überhaupt, nur flüchtig, instinktiv wahrgenommen hat.
Ich amüsiere mich, wenn ich mir Hitchcock ansehe oder mir Bryan Ferry anhöre, doch ich fühle mich dabei nie frei. Was mir fehlt, ist die Andeutung offener Möglichkeiten, das Hochgefühl, das einem Jules und Jim, Blonde on Blonde oder Weekend bescheren – das Gefühl, dass ein Künstler über seinen Horizont hinausgeht, dass dein eigener Horizont gesprengt wird, dass Barrieren zerschmettert werden. Diese Art von Freiheit macht Jules und Jim zu einem viel gefährlicheren Film als Shadow of a Doubt13, so wie Before the Flood witziger und schmerzhafter ist als Ferrys These Foolish Things, über das ich schon seit Monaten Tränen lache.
13 Im Schatten des Zweifels (Regie: Alfred Hitchcock, USA 1943).
Was mir fehlt, ist das Gefühl, dass in der Musik, in einem Künstler, in mir selbst mehr steckt, als ich angenommen hätte, dass ich nicht voraussagen kann, was ein Song, der aus dem Radio oder von meinem Plattenteller kommt, letztlich mit mir anstellen wird. Was mir fehlt, ist das Gefühl, dass die Musiker sich kopfüber in eine Darbietung stürzen, ohne eine genaue Vorstellung davon zu haben, auf welchem Weg sie sich befinden, ganz zu schweigen davon, wo sie am Ende herauskommen werden, doch mit der optimistischen, nervösen Überzeugung, dass die Ungewissheit der Reise durch die unterwegs erlebten Überraschungen allemal aufgewogen wird.
Die Musik, die Dylan und die Band auf Before the Flood präsentieren, wurde in diesem Geist gemacht – einem spezifisch amerikanischen Geist. Das Beste davon ist laut, grob, nicht gänzlich zivilisiert, eine altmodische, hinterwäldlerische, großstädtische Attacke gegen alles Vornehme und Gezierte. In dieser Musik steckt viel von Whitmans barbarischem YAWP, das der Dichter in Leaves of Grass über die Dächer der Welt ruft. »Die europäischen Modernen«, schrieb D. H. Lawrence vor fünfzig Jahren, »versuchen alle, extrem zu sein. Die großen Amerikaner, die ich hier nenne [Hawthorne, Poe, Dana, Melville, Whitman], waren einfach extrem.«
Ich hörte mir dieses Album ernsthaft, sorgfältig und Track für Track an, ohne es besonders zu genießen, denn ich störte mich an der, wie mir schien, eindimensionalen und allzu gradlinigen Art der Darbietungen, bis ich in der Mitte von »Highway 61 Revisited« registrierte, wie Robbie Robertson genau an der Stelle, wo Dylan »Do you know where I can get rid of these things?« singt, zwei kleine Geräusche ausstößt – Ähk! Ähk! – und sich dann schnell wieder in den Hauptstrom der Musik einfügt, mit einer Kombination von Tönen, wie ich sie noch nie im Leben gehört hatte. Es war einfach unglaublich: Für mich stand fest, dass jeder andere Gitarrist in Amerika zwei linke Hände hatte – oder Robertson zwölf Finger. Also rief ich ihn an, um herauszufinden, wie diese Musik entstanden war, wie er diesen Riff in das Stück eingearbeitet hatte, was dessen Zweck in der Struktur des Songs war und so weiter. »Na ja«, sagte er. »Das war ein Moment der Panik.«
Dieser Moment verschaffte mir Zugang zu dem Album, er erschloss es für mich: Panik, vielleicht, aber kein Zufall, denn mit einem Mal konnte ich Dutzende von ähnlichen Momenten feststellen. Diese wenigen Töne brachen die Strukturen der Musik auf, schlugen eine Schneise in deren Dichte. Innerhalb dieser Strukturen stößt man auf eine fabelhafte Ansammlung von Nuancen, musikalischen Phrasen und textlichen Fragmenten, von einzelnen Teilen, die bedeutsamer zu sein scheinen als vollendete Songs. Aus einem Song, den man schon hundertmal gehört hat, schießen einem Dinge entgegen, auf die man im ersten Moment nicht zu reagieren weiß. Die Musik mag an der Oberfläche vollkommen vertraut sein (alte Songs), oder auch unter der Oberfläche (Album gekauft, Album nach Hause getragen, Album abgespielt), doch bis zum Grund gelangt man nie. Der Sound der Aufnahme – roh, verschwommen, schnell, düster – verbirgt die Action zunächst, und womöglich lässt er einige der Nummern auch öde klingen. Nach einer Weile brechen jedoch merkwürdige Dinge hervor, die noch viel stärker wirken, weil man nicht mit ihnen gerechnet hat. Und mit einem Mal passt alles zusammen. Ein paar Tage später hört man wieder etwas anderes; die Darbietung fällt in sich zusammen; sie baut sich um jenen Moment herum wieder neu auf und verwandelt sich ein weiteres Mal.
Diese Art von Freiheit – sechs Typen, die alle Fesseln abwerfen, innerhalb einer Struktur, die nach wie vor ihre Form bewahrt, die nie inkohärent oder willkürlich ist – scheint das wirklich Neue an dieser Musik zu sein und auch das, was das Beste daran ist. Die Dichte der Musik erzeugt einen neuen Raum; für mich ist Garth Hudson der Star auf diesem Album, so wie Levon Helm für mich der Star bei den Konzerten war. Keiner der beiden wäre mit dem gleichen Feuer zur Sache gegangen, hätte Dylan sie nicht über sich selbst hinausgetrieben; dass Garth Hudson Dylan hier in den Schatten stellen kann, gereicht dem Album zum Vorteil, nicht zum Nachteil.
Die Band spielte nicht auf diese Weise mit Dylan zusammen, als sie 1965 und 1966 noch als die Hawks mit ihm auf Tournee waren, und sie haben seitdem auch als eigenständige Gruppe nicht so gespielt. In der Vergangenheit beschränkten sie sich darauf, Dylan zu begleiten, und dieser sang, als wollte er es genau so haben. Die Berichte über die jüngste Tournee entsprachen solchen Erwartungen. Die Autoren erwähnten die exzellenten »melodischen Einwürfe«, die Robbie, Garth und Richard Manuel beisteuerten, oder die feinen Rhythmen, für die Levon Helm und Rick Danko sorgten. Before the Flood beweist, wie grotesk derlei Kommentare sind. Garth kümmert sich um den Rhythmus und mitunter ist Levon derjenige, der die Rolle des Erzählers übernimmt. Es stecken ganze Songs in dem, was Garth bei »Highway 61 Revisited« macht, oder in Levons Schlagzeugspiel bei »Most Likely You Go Your Way and I’ll Go Mine« – komplette, unglaublich verwickelte Versionen der Dinge, um die es in diesen Songs geht.
Diese Performances sind dermaßen roh, dass sie die Livemusik der Rolling Stones zahm klingen lassen, und trotzdem ist die Musik, die Dylan und die Band gemeinsam machen, in einem emotionalen Sinn komplexer als die Texte der jeweiligen Songs. Diese Freiheit – die Art und Weise, auf die sich die Sänger und Musiker von den Songs als Kunstwerken befreit haben – hat etwas mit der Tatsache zu tun, dass Dylan und die Mitglieder der Band jetzt älter sind als zu der Zeit, als sie diese Musik zum ersten Mal spielten; sie müssen einander weniger beweisen und jeder hat nun selbst mehr zu sagen. Sie können ihre Partnerschaft als gegeben ansehen und darauf aufbauen. Sie können sich vom Publikum beflügeln lassen und es gleichzeitig vergessen.
Hören Sie sich die Originalversion von »Highway 61 Revisited« an, die sich auf dem gleichnamigen, 1965 eingespielten Album befindet; dort hört man einen sehr lakonischen Bob Dylan, einen Dandy, der auf eine beiläufige Weise die befremdlichsten Ereignisse schildert, als wollte er sagen, Hey, was sonst würde man von einem Ort wie den USA erwarten? Doch auf Before the Flood ist es eine andere Geschichte. Ihr würdet nicht glauben, was auf dem Highway 61 geschieht, sagt der Sänger – und deshalb werden wir euch dorthin mitnehmen und es euch zeigen, ob ihr dazu bereit seid oder nicht.
Einst gondelte Bob Dylan mit coolem Blick die Hauptstraße rauf und runter und hielt Abstand von den anderen. Jetzt befindet er sich direkt mittendrin, so wie wir auch. Man hört Garth Hudson, wie er einen die Straße hinunterwalzt und einem das Gefühl gibt, es könnte ein angenehmer Trip werden, eine Reise à la Tom Sawyer, und dann, plötzlich, ruft er vom Berg herab – Gabriel, wie er den Tag des Jüngsten Gerichts verkündet, und ja, man rennt lieber weg, wenn auch nur, um Schritt zu halten. Das ist die Bürde, die man auf sich nehmen muss, wenn man in ein größeres, mysteriöseres Amerika eintauchen will, wenn man dem behaglichen Nest der »Wir«-Generation den Rücken kehrt. Und sich in das Zentrum begibt, das nicht halten wird, um es zu bejahen und dort seine Arbeit zu verrichten – das ist, finde ich, keine harmlose Angelegenheit.
Dylans Tournee mit der Band war kein Ereignis, ungeachtet dessen, was Newsweek und der Rolling Stone behaupten, und ungeachtet der Tatsache, dass inzwischen ganze Bücher über die Tour in den Schaufenstern ausliegen. Als ein Ereignis verschwand die Tournee in ihrem eigenen Rauch. Elton Johns Caribou und Before the Flood kamen zur selben Zeit heraus; Caribou steht schon auf Platz eins, während Dylan und die Band es noch nicht einmal in die Top 20 geschafft haben. Die 450 000 Leute, die die Konzerte besucht haben, scheinen offenbar kein Interesse an einem Souvenir zu haben.14 Die Verantwortlichen von Asylum müssen ihrem eigenen Hype geglaubt haben, denn sie brachten das Album heraus, ohne Werbung dafür zu machen. Jetzt, wo sie es mit der Angst zu tun bekommen, legen sie in Sachen Hype noch eine Schippe drauf: »Die größte Tournee in der Geschichte des Rock ’n’ Roll …«
14 Before the Flood erreichte schließlich Platz drei der Billboard-Charts.
Unfug! Im Gegensatz zu Dylans Tourneen in den Mittsechzigerjahren oder zum Debüt der Band im Frühjahr 1969 und auch im Gegensatz zu dem triumphalen, quer über den Kontinent führenden Sturmlauf der Rolling Stones gegen Ende desselben Jahres oder zu Elvis’ legendären ersten Fernsehauftritten im Jahr 1956 gab es bei dieser Tournee nichts von den Sehnsüchten, den Ängsten und den Symbolen, die jenes öffentliche Leben prägten und intensivierten, wie wir es mit den Performern verbinden, die uns etwas bedeuten. Dylans Tournee war eine Gelegenheit zum Musikmachen, eine Chance für sechs Typen, die Grenzen zu durchbrechen, die sie um sich herum errichtet hatten. Gemeinsam zogen sie das durch und in der Musik, die sie dabei gemacht und auf Platte hinterlassen haben, steckt für jeden Fan eine Chance, diese oder jene eigene Grenze zu durchbrechen. Nach Before the Flood wird die meiste andere Musik vorsichtig, reserviert und auch ein wenig falsch klingen – das ist womöglich der Grund dafür, dass ich seit der Veröffentlichung des Albums nicht einen einzigen Track davon im Radio gehört habe.
Bob Dylan, Before the Flood (Asylum, 1974).
––, The bootleg series volume 4 – Bob Dylan Live 1966 – The »Royal Albert Hall« Concert (Columbia, 1998).
D. H. Lawrence, Studies in Classic American Literature (1923); dt. Der Untergang der Pequod – Studien zur klassischen amerikanischen Literatur, Deutsch von Werner Richter, Wien/Zürich 1992, S. 8.
TEIL ZWEI
Sieben Jahre hiervon 1975–1981