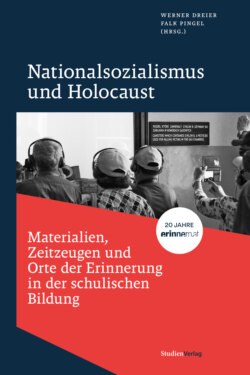Читать книгу Nationalsozialismus und Holocaust – Materialien, Zeitzeugen und Orte der Erinnerung in der schulischen Bildung - Группа авторов - Страница 28
Lernerfahrungen in Israel
ОглавлениеDie Erinnerungsorte in Israel beeindrucken die Lehrenden auf unterschiedlichste Weise. In Yad Vashem sind es Dimension, Ästhetik und natürlich auch der konsequente Blick auf die verfolgten und ermordeten Menschen, auf die Zerstörung der jüdischen Kultur in Europa. Anders als bei uns werden die Verbrechen nicht relativiert, es gibt keine Rechtfertigungen wie die wirtschaftliche Not der Menschen oder das Nichtwissen-Können. Im Kinderdenkmal werden in einer Endlosschleife die Namen der ermordeten Kinder und ihr Alter genannt, während man vielen von ihnen auf Fotos in die kindlichen Augen schaut. Die emotionale Wirkung ist enorm. Der Besuch im Tal der Gemeinden zeigt die Wucht der Zerstörung auf einer ganz anderen Ebene. So viele Orte in Europa hatten eine mehr oder weniger große jüdische Gemeinde, viele Lehrerinnen und Lehrer entdecken dort in Jerusalemer Stein gehauen ihre Heimatorte und wissen: Nichts oder kaum etwas ist davon ist geblieben. Die Anzahl der österreichischen Gerechten unter den Völkern macht sich im europäischen Vergleich bescheiden aus. Und der Gang durch das Museum, das die Geschichte des Holocaust in Form einer unausweichlichen Einbahn erzählt, nimmt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit – im doppelten Sinne. Der Gang durch die Ausstellungsbereiche als eine Art Selbsterfahrung. Alles fängt an mit dem auf Videos festgehaltenen Treiben jüdischen Lebens in Osteuropa, führt zu den verächtlichen Auswüchsen antisemitischer Propaganda, es zeigt das assimilierte jüdische Leben und zeichnet die verschiedenen Phasen des Genozids nach. Am Ende die Halle der Namen und zuletzt der Blick auf die Hügel Jerusalems. Dieses Ende der Ausstellung ist natürlich auch ein politisches Statement.
Es ist die Perspektive der Verfolgten, die hier erzählt wird. Aber die Vertriebenen und die Ermordeten begegnen den Besucherinnen und Besuchern nicht als Opfer, zu denen sie von den Nationalsozialistinnen und -sozialisten gemacht wurden, sondern als Menschen mit ihrer Geschichte, mit einem Namen, mit einem Gesicht. Durch fundierte Vorträge wird das historische Wissen über den zutiefst verwurzelten Antisemitismus, über Ideologie und Strategien des Nationalsozialismus, über die schrittweise Entwicklung von Diskriminierung hin zum industriellen Massenmord substanziell erweitert. Das Vorgehen von SS und Wehrmacht im Osten, der Umgang mit den Opfern nach Ende des Krieges und die weitgehende Schonung der Täterinnen und Täter – all das wird den Lehrpersonen zugemutet. Und viele reagieren sehr bewegt. Vieles, das mehr oder weniger bekannt war, fühlt sich aus dieser Perspektive ganz anders an. In Österreich lernt man die Zahlen der Vernichteten, weiß um die Vertriebenen, hat mit einzelnen Zeitzeuginnen und -zeugen gesprochen, Filme gesehen, Einzelschicksale kennengelernt. Aber diese unausweichliche gemeinsame Erfahrung, die die europäischen Jüdinnen und Juden machten, die systematische Zerstörung einer zur Rasse gemachten, überaus heterogenen und zahlenmäßig unfassbar großen Anzahl von Menschen und das daraus resultierende kulturelle Gedächtnis von Jüdinnen und Juden, das wird vielen Lehrpersonen erst beim Besuch dieser Erinnerungsorte bewusst. Es wird die Geschichte des gesellschaftlich tief verankerten Antisemitismus, der Zustimmung, der Begeisterung erzählt, die Vernichtung wird offengelegt, indem vor allem auch diejenigen Menschen ein Gesicht und eine Geschichte bekommen, die nicht überlebt haben. Und es sind unzählige. Die Erklärungsansätze, die aus der durchaus vorhandenen wirtschaftlichen Not und den politischen Konflikten der Zwischenkriegszeit unser Geschichtsbild prägen, gibt es dort nicht.
In Lochamej haGeta’ot machen die Teilnehmenden andere zentrale Lernerfahrungen. Sie gehen durch das Ghetto Fighters Museum. Und auch dort hören und sehen sie gesammelte Geschichten von Ermordeten und Überlebenden, sie halten Ego-Dokumente aus dem Archiv in den Händen und lesen aus diesen Originalen, in denen die Gedanken und Gefühle in den Momenten der Angst und des Schreckens, des Verlustes, des Abschieds, der Sehnsucht und der Sorge zur Sprache kommen, von Menschen aus den unterschiedlichsten österreichischen Orten. Die Archivarin hat sie extra für die Gruppe herausgesucht. Beim Lesen wird es still im Raum.
Dass man in Israel schon mit sehr jungen Kindern über den Holocaust spricht, haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereits in Yad Vashem erfahren. Hier in Lohamej lernen sie eine Ausstellung kennen, die diesen Kindern den Holocaust erzählt. Die Ausstellung des Kindermuseums Yad LaYeled spaltet häufig: Manche sind zutiefst beeindruckt, finden die anschauliche und naturalistische Darstellung als Lernerfahrung überzeugend. Andere sind aber auch irritiert, dass man Kindern eine derartig schonungslose Darstellung zumutet. Israelis leben mit dieser Geschichte, israelische Kinder wachsen mit ihr auf. Immer wieder erzählt Noa Mkayton, wie stark die Wirkung des jährlich wiederkehrenden Holocaust-Gedenktags in Israel ist, an dem plötzlich alles stillsteht, die Sirenen aufheulen und ganz Israel erstarrt. Man müsse den Kindern möglichst früh erklären, worum es hier geht, und zwar mit einem wohldurchdachten pädagogischen Konzept und möglichst professionell. Die Kinder sich selbst zu überlassen und damit Gefahr zu laufen, dass sie die omnipräsenten Geschichten ungeschützt und unbegleitet aufschnappen, sei fahrlässig.
Und dann die Begegnung mit den Überlebenden! Mit Zeitzeuginnen und -zeugen, auch mit „Alt-Österreicherinnen und Alt-Österreichern“, wie sie genannt werden: Menschen, die im hohen Alter jenseits der 90 in ihrer Muttersprache Deutsch ihre österreichische Vertreibungs- und israelische Überlebensgeschichte erzählen.
Die Seminartage in Yad Vashem fordern die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr, wirken emotional auf sie ein, indem ihnen die Geschichte von Vernichtung und Massenmord auf verschiedenen Ebenen vermittelt wird. Die musealen Darstellungen, die historischen Verträge, die Workshops und die Begegnung mit den Überlebenden sind geradezu überwältigend.
Das Center for Humanistic Education in Lochamej haGeta’ot arbeitet mit einem anderen, einem universalistischen Ansatz, den die Lehrenden dort kennenlernen. Man bezieht die Lernenden persönlich ein, lädt sie ein und ermutigt sie, ihre eigenen Geschichten zu erzählen:
„Ein jüdisches Mädchen erzählte hier von ihrer Großmutter, die als einzige Überlebende 1946 nach Palästina einwanderte und in einen Kibbuz eintrat. Dieser Kibbuz wurde während des Unabhängigkeitskrieges von Arabern angegriffen. Einige Freunde der Großmutter hätten bei diesem Angriff ihr Leben verloren. Direkt im Anschluss erzählt ein arabischer Junge vom Dorf seiner Großeltern, welches während der Nakba von der israelischen Armee zerstört worden sei. Einen alten rostigen Schlüssel hätte er von seinem Großvater als Andenken erhalten, um das Haus, das sie damals bewohnt hätten, niemals zu vergessen.“ (Kashi, 2008, S. 80f.)
Raya Kalisman, Gründerin des Center for Humanistic Education, sagt, dass
„die Beschäftigung mit dem Holocaust deutlich machen [kann], wie wichtig die Bewahrung und der Schutz pluralistischer und demokratischer Werte sind. Infolgedessen müsse sinnvolle Holocaust-Education jedoch auch bedeuten, die Augen für das gegenwärtige Leid der Menschen zu öffnen und sich mit diesem auseinanderzusetzen.[…] Im Gegensatz zum üblichen israelischen Vermittlungsansatz, der auf die Stärkung israelischer und jüdischer Identität ausgelegt sei, könne ein universalistischer Blick auf die Geschichte somit sogar der Ausgangspunkt eines gemeinsamen Dialogs zwischen Juden und Arabern sein und helfen, eine Brücke zwischen jüdischen und palästinensischen Israelis zu bauen.“ (Kashi, 2008, S. 77).
Hier sehen viele österreichische Lehrpersonen einen pädagogisch-didaktischen Schatz für ihre Arbeit. So können sie auf ihre heterogenen Klassen schauen, so können sie das Thema angehen: Empathisch und analytisch zugleich, aus einer historischen Perspektive, gleichzeitig mit einem spannenden Gegenwartsbezug.
Dass die Arbeit des Center for Humanistic Education im gegenwärtigen Israel eine Außenseiterposition darstellt, ist für die Teilnehmenden irritierend, erleben sie diese doch als zukunftsweisend in einem von Kriegs- und Terrorerfahrungen geprägten Land. Diese Irritation sowie das große Staunen über die Bruchlinien im Land Israel, die gefühlte und von vielen als solche formulierte Ausweglosigkeit im seit Jahrzehnten andauernden Nah-Ost-Konflikt – all das nehmen die Lehrerinnen und Lehrer auf der Seminarreise nur am Rande, aber doch wahr, und sie nehmen diese Eindrücke mit nach Hause. Die Interventionen des Begleitteams vor Ort und einzelne Vorträge vor, während und nach der Seminarreise bieten Hilfestellungen an, vieles allerdings bleibt als großes Fragezeichen hängen.