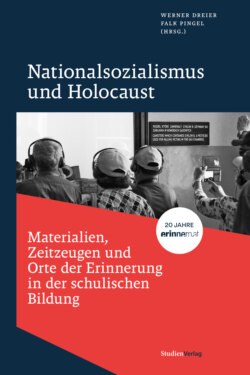Читать книгу Nationalsozialismus und Holocaust – Materialien, Zeitzeugen und Orte der Erinnerung in der schulischen Bildung - Группа авторов - Страница 38
C. „Hitler. Die Juden. Der Junge im gestreiften Pyjama“
ОглавлениеNicht nur die Voraussetzungen des Unterrichtens über den Nationalsozialismus für die Lehrenden haben sich geändert, auch die Erwartungen und Vorkenntnisse der Lernenden. Dies lässt sich anhand jener drei Schlagwörter erklären, die mir von Berufsschülerinnen und -schülern meist als erstes entgegengeworfen werden, wenn ich zum Einstieg in das Thema dazu auffordere, mir Assoziationen zu benennen: „Hitler. Die Juden. Der Junge im gestreiften Pyjama.“
Zuerst kommt – wie auch in der zuvor erwähnten Studie von Philipp Mittnik, Georg Lauss und Sabine Hofmann-Reiter festgestellt – tatsächlich fast immer die Fixierung auf die Person Adolf Hitler und der Versuch, die Verbrechen des Nationalsozialismus durch Halbwissen und Gerüchte aus dessen Biografie zu verstehen. Hitler wird zum geschickten Verführer der Massen und zum Dreh- und Angelpunkt des Nationalsozialismus erklärt. Meist werden die Ausführenden der NS-Verbrechen noch im gleichen Atemzug entschuldigt – sie hätten keine Wahl gehabt, sonst wären sie selbst ermordet worden. An dieser Sicht auf Zeitgeschichte ist bemerkenswert, dass sie sich weitgehend mit einer in der postnazistischen Mehrheitsgesellschaft weitverbreiteten Erzählung über den Nationalsozialismus deckt. Das zweite Schlagwort kommt meist als Antagonismus dazu – die Jüdinnen und Juden, die als wehrlose Opfer meist mit der Person Anne Frank identifiziert werden. Dieses Bild vermischt sich mit Vorurteilen und antisemitischen Gerüchten. Nicht selten wird hier der „Hass Hitlers auf die Juden“ mit deren vermeintlichen Eigenschaften oder Taten begründet und nachgefragt, ob es denn stimme, dass die Juden in Österreich bis heute keine Steuern zahlen. Zuweilen wird dann noch mit den einleitenden Worten „Es ist schlimm, was den Juden damals passiert ist, aber …“ der Konflikt zwischen Israel und den Palästinenserinnen und Palästinensern ins Spiel gebracht. Die Assoziation „Der Junge im gestreiften Pyjama“ wirkt dann schon oft wie eine willkommene Unterbrechung dieser Dynamik. Fast alle Jugendlichen, mit denen ich in der Berufsschule über den Nationalsozialismus rede, haben diesen kitschigen, völlig absurden und gleichzeitig in seiner Ästhetik einen hohen Realitätsgehalt vorspielenden Film in einer der davor besuchten Schulen gesehen. Die in diesem Film vermittelten Vorstellungen, dass ein neunjähriger KZ-Häftling in einem Vernichtungslager herumstreift und einen Spielkameraden sucht, während die Ehefrau des Kommandanten nicht so recht weiß, was ihr Mann dort den ganzen Tag macht, sind tief in der Vorstellung der meisten meiner Schülerinnen und Schüler verankert.
Nun ist diese kurze Schilderung anhand dreier Schlagworte natürlich eine Zuspitzung. Es gibt auch immer wieder Lehrlinge, die sehr viel Wissen über den Nationalsozialismus mitbringen, weil sie familiäre Erzählungen zu dieser Zeit haben, weil sie gute Geschichtslehrerinnen und -lehrer hatten oder weil sie sich aus eigenem Interesse mit Geschichte beschäftigen und ihre Quellen kritisch auswählen. Die im vorgehenden Absatz beschriebenen Bilder und Vorstellungen kommen dennoch in fast jeder Klasse auf die eine oder andere Art zur Sprache. Dies soll keineswegs der Fehlannahme Vorschub leisten, Lehrlinge seien dumm, geschichtsvergessen oder überwiegend antisemitisch. Vielmehr ist es ein Ausdruck des historischen Bewusstseins, das viele 15-Jährige – vor allem jene, denen höhere Schulen verschlossen bleiben – heute mitbringen. Es bleibt zu erforschen, woher diese Vorstellungen und Bilder kommen. Alle drei hier beispielhaft genannten Topoi – Hitler als das absolute Böse, die Jüdinnen und Juden als Opfer und Objekt antisemitischer Vorstellungen und der Holocaust als „KZ-Kitsch“ (Ruth Klüger) – erscheinen mir jedenfalls nicht nur unter Jugendlichen weit verbreitet.
Die vieldiskutierte Herkunft der Lernenden spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Sowohl bei den gut informierten, historisch interessierten Jugendlichen als auch bei den Unwissenden finden sich Schülerinnen und Schüler mit klassisch österreichischen Nachnamen als auch solche, deren Namen auf „Migrationshintergrund“ schließen lassen. Insgesamt lässt sich aber feststellen, dass auch angesichts der Diversität der familiären Hintergründe der Lernenden die alten, nationalen Erzählungen über Geschichte nicht mehr greifen (Borries, 2009). Die Mythen der Nachkriegszeit – der „Geist der Lagerstraße“, die „treue Pflichterfüllung der Soldaten“ oder auch die Idee von Österreich als „erstem Opfer des Nationalsozialismus“ – sind bei Jugendlichen unabhängig von deren Hintergrund nicht mehr wirkmächtig.
Ein Aspekt, in dessen Zusammenhang der familiäre oder religiöse Hintergrund der Jugendlichen immer wieder in den Fokus gerät, ist die Frage nach Antisemitismus. In einer Studie zum Umgang mit Antisemitismus und anderen Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in der Berufsschule untersuchen Georg Lauss und Stefan Schmid-Heher auch die Verbreitung antisemitischer Vorbehalte (Lauss, 2020). Der Aussage, dass Juden zu viel Einfluss in Österreich hätten, stimmen demnach 19 Prozent der Jugendlichen zu, die zuhause Deutsch sprechen und 55 Prozent jener Jugendlichen, die zuhause Türkisch, Arabisch, Farsi oder eine andere Sprache sprechen, die auf einen muslimischen Hintergrund schließen lassen. Auch andere Studien, die sich nicht ausschließlich mit Lehrlingen beschäftigen, kommen auf ähnliche Ergebnisse. Antisemitismus tritt bei Jugendlichen mit muslimischem Hintergrund meist in Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen Israel und den Palästinenserinnen und Palästinensern auf. Beide Zahlen – sowohl die Akzeptanz antisemitischer Vorurteile bei mehrheitsösterreichischen Jugendlichen also auch bei Jugendlichen mit muslimischem Hintergrund – sind besorgniserregend und ein Auftrag an Akteurinnen und Akteure der Politischen Bildung, sich verstärkt mit Ansätzen antisemitismuskritischer Bildungsarbeit auseinanderzusetzen (Peham, 2016, S. 104f.). Die Externalisierung des Problems unter dem Schlagwort „importierter Antisemitismus“ produziert hier jedoch ein mangelhaftes „Anderes“, demgegenüber man sich selbst besonders fortschrittlich fühlen kann. Vielmehr gilt es im Umgang mit Antisemitismus, der von migrantischen Jugendlichen artikuliert wird, auch deren eigene Erfahrungen mit Marginalisierung und Diskriminierung in den Blick zu nehmen. „Für den pädagogischen Umgang mit Antisemitismus bedarf es einer Aufmerksamkeit dafür, dass mit antisemitischen Äußerungen Zugehörigkeiten und Erfahrungen der Nichtzugehörigkeit verhandelt werden, allerdings oft nicht explizit, sondern vermittelt über die Abwehr bestimmter Geschichtsdiskurse“ (Messerschmidt, 2009, S. 170).
Eine offene Form der Auseinandersetzung mit Geschichte, die ohne fertige Erzählungen und Lehren auskommt, sondern Gelegenheit zu Fragen, Interaktion und das Verhandeln gesellschaftlicher Werte beinhaltet, ist herausfordernd. Ein solcher Prozess erfordert kommunikative und emotionale Intelligenz, Flexibilität und Fingerspitzengefühl. Dabei ist zentral, dass Jugendliche ihre Meinungen und Ansichten einbringen dürfen und so auch problematische Aussagen besprochen werden können. Dennoch sollte eine Unterrichtseinheit zum Thema Nationalsozialismus und Holocaust nicht zur Stunde über den Nahostkonflikt werden. Obwohl es wichtig ist, Zusammenhänge zwischen beiden Themen zu erkennen, ist es für das Gelingen einer jeden Unterrichtseinheit entscheidend, als Lehrperson einen klaren thematischen Rahmen vorzugeben. Das Thema Nationalsozialismus und Holocaust mit all seiner politischen und normativen Aufladung eignet sich aus Sicht eines Jugendlichen mit Abgrenzungsbedürfnissen sehr gut für Provokation und Profilierung in der Peergroup. Dem sollten Lehrende gelassen, deutlich, mit Respekt vor der Person, aber nicht vor der Aussage, entgegentreten. Wir müssen auch damit leben können, wenn eine Unterrichtseinheit zum Holocaust jahrelang eingeübte und lang tradierte Einstellungsmuster nicht von einem auf den anderen Tag ändert. Eine gelungene Doppelstunde in Politischer Bildung zum Thema Nationalsozialismus und Holocaust kann jedoch sicher helfen, Nachdenkprozesse in Gang zu setzen.