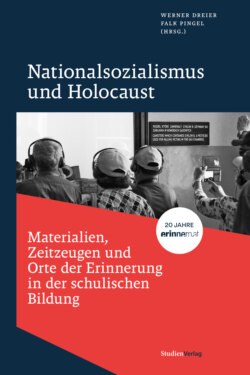Читать книгу Nationalsozialismus und Holocaust – Materialien, Zeitzeugen und Orte der Erinnerung in der schulischen Bildung - Группа авторов - Страница 29
Resümee
ОглавлениеDie österreichischen Lehrpersonen lernen im Rahmen der Seminare in Israel mehrere israelisch-jüdische Narrative kennen. Das bereichert, motiviert, befremdet, verunsichert und es muss zwangsläufig auch überfordern. So vieles muss neu gedacht, anders gewichtet und auch verändert erzählt, manches auch kritisch beäugt werden. Auf einige ihrer Fragen erhalten die Lehrpersonen in Israel Antworten, sie erhalten inhaltliche und didaktische Anregungen, die viele in ihren Unterricht integrieren. Davon zeugen die Unterrichtsbeispiele und Projektideen, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer entwickeln. Ob und wieweit es ihnen aber nachhaltig gelingt, ihre Erkenntnisse und Erfahrungen in ihren Unterricht zu integrieren und die Begegnung mit dem Thema Nationalsozialismus und Holocaust perspektivisch anders anzulegen, das bleibt oftmals verborgen. Das Aufbrechen von gewohnten Erzähl- und Denkmustern zeigt aber gewiss nachhaltige Wirkung.
Ich bin davon überzeugt, dass in einer wirksamen Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit alle drei eingangs geschilderten persönlichen Erfahrungen miteinander verbunden werden müssen. Wenn bei Gedenkfeiern, oft in Anwesenheit der letzten Überlebenden, bei Gedenkstättenbesuchen oder Gesprächen mit Zeitzeuginnen und -zeugen Emotionen geweckt werden, hat das sehr viel mit uns selbst zu tun, mit der Bereitschaft, sich einzulassen, mit der gegenwärtigen politischen Situation und der aktuellen gesellschaftlichen Verfasstheit, natürlich auch mit der Betroffenheit, die wir selbst im Zusammenhang mit dem Thema haben oder spüren. Empathie, Betroffenheit oder Emotion kann man nicht didaktisch verordnen – und man soll es auch nicht anstreben. Wenn Schülerinnen und Schüler Einzelschicksale kennenlernen, sind sie ohnehin in den meisten Fällen berührt. Wichtig ist ein inhaltlich orientierter, analytischer Zugang zu historischem Wissen, der systematische Blick auf Phänomene, die Gesellschaften an allen Orten und zu allen Zeiten bedrohen. So kann, wie Raya Kalisman sagt, „die Beschäftigung mit dem Holocaust […] zu einem Baustein der Peace Education [werden], anstatt als Projektionsfläche und Argumentationsmuster für Feindlichkeiten zwischen jüdischen und arabischen Israelis zu fungieren“ (Kashi, 2008, S. 77). Übertragen auf unsere Gesellschaft gilt es, Argumentationsmuster und Feindlichkeiten offenzulegen, die hierzulande nicht nur, aber auch mit dem Thema Holocaust bedient werden. Nur mit einem universalistischen Ansatz wird es gelingen, dem Unterricht über Nationalsozialismus und Holocaust einen Gegenwartsbezug und eine Zukunftsbedeutung zu geben.
Bei jeder Auseinandersetzung mit Geschichte ist immer wieder neu zu fragen: Mit welchem Ziel erzählen wir das, wozu soll die Beschäftigung damit dienen? Wenn in diesen Tagen in Israel und international über die umstrittene Neubesetzung der Leitungsfunktion in Yad Vashem mit einem Vertreter der äußersten Rechten diskutiert wird, so wird diese Frage ungemein brisant. Das Thema und die Inhalte sind in der Geschichtsvermittlung nur eine Seite der Medaille, die andere ist die Motivation, die dahintersteckt. Das gilt für die international bedeutendste Holocaust-Gedenkstätte genauso wie für jeden Geschichtsunterricht.