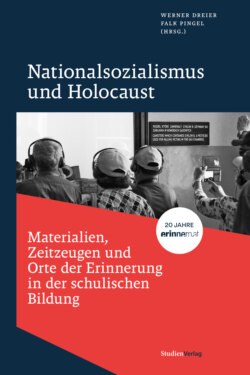Читать книгу Nationalsozialismus und Holocaust – Materialien, Zeitzeugen und Orte der Erinnerung in der schulischen Bildung - Группа авторов - Страница 39
D. „Was darf ich (nicht)?“
ОглавлениеLehrerinnen und Lehrer begeben sich vor allem in der Berufsschule in vielerlei Hinsicht auf unsicheres Terrain, wenn sie Nationalsozialismus und Holocaust unterrichten – in Bezug auf den Lehrplan, das Interesse der Jugendlichen, deren Vorwissen, Vorbehalte und Vorurteile und in Bezug auf das eigene Wissen über Zeitgeschichte. Vor allem wenn die Lehrperson weniger daten- und faktenorientierten Unterrichtszielen folgt und die Fragen, Interessen und Vergleiche der Lernenden ins Zentrum stellt, wird es oft auch mit viel historischem Wissen und Interesse für Erinnerungskulturen kompliziert und heikel. Wie sollte etwa mit dem Halbwissen und den popkulturell beeinflussten Vorstellungen der Jugendlichen umgegangen werden? Wie mit ihren Vergleichen und Gegenwartsbezügen? Wie mit ihren Provokationen und ihrer Ablehnung dem Thema gegenüber?
Zuerst ist es wichtig, einen verbindlichen Rahmen für eine Unterrichtseinheit zur Zeitgeschichte herzustellen. Im Idealfall sollte das Thema den Lernenden schon einige Zeit vor der Einheit angekündigt werden, damit Erwartungen, Befürchtungen und ablehnende Haltungen schon im Vorfeld Platz bekommen. Zu einem guten Rahmen gehört auch die Sicherheit, dass eigene Gedanken, Vorwissen, Fragen und Überlegungen willkommen sind und nicht sanktioniert werden. Gleichzeitig sollte im Fach Politische Bildung wie grundsätzlich in jeder Unterrichtssituation klar sein, dass eine inhaltliche Auseinandersetzung auf Basis von Wissenschaftlichkeit, Respekt und den Menschenrechten stattfinden muss.
Ist eine grundsätzliche Bereitschaft zur ernsthaften Auseinandersetzung im Vorfeld gemeinsam festgestellt worden, dann sind von Seiten der Lehrenden keine mahnenden Appelle notwendig und von Seiten der Schülerinnen und Schüler weniger abwehrende Provokationen und „unpassende“ Kommentare zu erwarten. Bei der Leitung einer Unterrichtseinheit zum Thema Nationalsozialismus und Holocaust soll der Beutelsbacher Konsens zur Anwendung kommen: das Verbot der Überwältigung, das Gebot der Kontroversität und das Gebot der Interessenorientierung. Die Geschichte des Holocaust ist an sich überwältigend. Es braucht hier kein Heranziehen der Bedeutung des Themas zur Disziplinierung einer Klasse, keine Überwältigung durch grauenhafte Bilder, keinen Zwang zur Trauer und letzten Endes auch keinen Zwang zur Auseinandersetzung. Wenn die Jugendlichen einer Schulklasse z. B. sagen, dass sie keine Exkursion nach Mauthausen machen wollen, dann ist das zu akzeptieren und den Schülerinnen und Schülern kein generelles Desinteresse zu unterstellen. Kontroversität bedeutet, dass kontrovers dargestellt werden soll, was in der Gesellschaft kontrovers ist. Nicht kontrovers diskutieren muss man über historische Fakten oder etwa darüber, ob es nicht auch „gute Seiten“ am Nationalsozialismus gab. Ein solcher Mythos soll zwar besprochen werden, ohne die Person zu beschämen, die ihn vorgebracht hat, doch ist die Lehrperson hier aufgefordert, den Mythos fragend zu dekonstruieren: Für wen hatte das NS-System „gute Seiten“? Wer und was muss ignoriert werden, um diese vermeintlich „guten Seiten“ betonen zu können? Ein solcher historischer Mythos muss diskutierbar sein, sollte aber nicht als „alternative Meinung“ zu diesem Thema gleichberechtigt stehen bleiben. Das Gebot der Interessenorientierung bedeutet in diesem Kontext das Anknüpfen an konkrete Biografien, an Orte, die für die Lernenden Bedeutung haben, an altersspezifische oder berufliche Erfahrungen – und damit auch eine Abkehr von der Vermittlung von Zeitgeschichte ausgehend von Zahlen, Daten und Fakten.
Diese Hinwendung zu den Fragen der Jugendlichen birgt wohl für jede Lehrperson Unsicherheiten – doch es zahlt sich aus, sich diesen gemeinsam mit den Lernenden zu stellen. Hilfreich ist dabei passendes Unterrichtsmaterial für die besonderen Herausforderungen der Berufsschule.