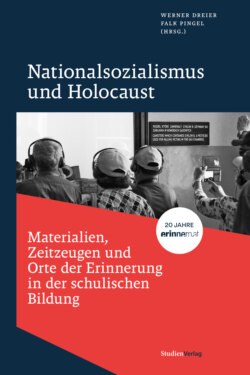Читать книгу Nationalsozialismus und Holocaust – Materialien, Zeitzeugen und Orte der Erinnerung in der schulischen Bildung - Группа авторов - Страница 36
A. „Warum sollte man über Nationalsozialismus und Holocaust überhaupt unterrichten?“
ОглавлениеDie Frage ist durchaus berechtigt: geringe Zeitressourcen, unklare Verwertbarkeit historisch-politischen Wissens, keine eindeutige Verortung im Lehrplan und die generelle Unsicherheit mit dem Thema machen eine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in der Berufsschule nicht einfach. Zudem wird oft angenommen, die Schülerinnen und Schüler hätten von dem Thema ohnehin genug. Tatsächlich ist man als Lehrperson oft mit einem unwilligen kollektiven Seufzen konfrontiert, wenn man eine Unterrichtseinheit zum Nationalsozialismus ankündigt: „Schon wieder? Das kennen wir schon!“
In einer Studie unter der Leitung von Philipp Mittnik vom Zentrum für Politische Bildung an der PH Wien wird dem klar widersprochen (vgl. Mittnik, 2021): So können unter 20 Prozent der 15-Jährigen an Berufsbildenden mittleren Schulen eine Kurzdefinition von Antisemitismus angeben. Nur 20 Prozent der Schülerinnen und Schüler an Allgemein Bildenden Höheren Schulen (AHS) und nur 4,7 Prozent an Berufsbildenden Mittleren Schulen (BMS) können erklären, was unter dem Begriff „Novemberpogrom“ zu verstehen ist. Grundsätzlich attestieren die Studienautorinnen und -autoren dem unter 15-jährigen Jugendlichen vorherrschenden Geschichtsbild eine ausgeprägte Form der Personalisierung: Die Verantwortung für die Verbrechen des Nationalsozialismus wird vor allem bei Hitler als „personifiziertem Bösen“ gesucht. Es ist also nicht das Wissen über den Nationalsozialismus, wovon die Jugendlichen genug haben. Vielmehr könnte es eine hohe moralische Erwartungshaltung der Lehrerinnen und Lehrer sein, die Jugendlichen die Auseinandersetzung erschwert. Viele wohlmeinende Kolleginnen und Kollegen vermitteln das Thema Nationalsozialismus im Unterricht in enger Verbindung mit den eigenen Wertvorstellungen, selbst gezogenen Lehren aus der Geschichte und normativen Vorstellungen einer angemessenen Haltung zu diesem Thema, die allesamt von den Jugendlichen übernommen werden sollten. Dieses Unterfangen verspricht kaum Erfolg im Sinne eines Erwerbs von historischen Kompetenzen und eines Gewinns an politischer Mündigkeit und führt meist zu Frustrationen bei Lernenden und Lehrenden.
Laut einer Handreichung der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) für Lehrende liegt die Notwendigkeit, über den Holocaust zu unterrichten, zuerst in seiner Beispiellosigkeit als Versuch, unter aktiver Mitwirkung weiter Teile der Gesellschaft eine Gruppe völlig auszulöschen. Die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus solle die Folgen des Verfalls demokratischer Werte verdeutlichen und zu einem Verständnis von Prozessen führen, die einem Völkermord vorausgehen. Die Schülerinnen und Schüler sollen dazu befähigt werden, über ihre eigene Rolle und Verantwortung beim Schutz von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten nachzudenken (IRAH, 2020, S. 14). Diese Ziele sind hoch gesteckt – der Weg dorthin sollte mehr von der Lebensrealität und den Fragen der Lernenden als von den Ansprüchen der Lehrperson geleitet sein: „Nicht vorgegebene Ziele, Inhalte und Kompetenzen, sondern das Wissen und die Einstellungen der Schüler[-innen] muss Ausgangspunkt des Lernens sein. Nicht Erziehung, sondern die Selbstbestimmung der Schüler[-innen] muss im Zentrum des Lernprozesses stehen“ (Rosa, 2010, S. 157). Ausgangspunkte in der Lebensrealität der Lernenden können in ihrer regionalen Herkunft, in der Familiengeschichte, der beruflichen Beschäftigung oder in örtlichen Bezügen gefunden werden. Vor allem aber in den historischen Vorstellungen der Lernenden und ihren Fragen zu Geschichte, Geschichtspolitik und Erinnerungskulturen.