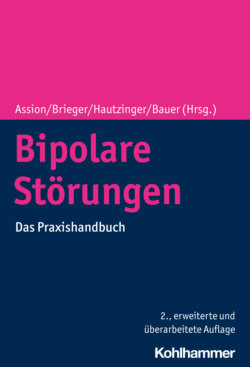Читать книгу Bipolare Störungen - Группа авторов - Страница 49
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.2.4 Pharmakogenetik
ОглавлениеEin weiterer an Bedeutung zunehmender Teilbereich der psychiatrischen Genetik ist die psychiatrische Pharmakogenetik, also die Erforschung der genetischen Grundlagen von Therapieansprechen bzw. Wirkung und Nebenwirkungen von Psychopharmaka. Der Reiz dieses Forschungszweiges liegt in seiner klinischen Relevanz: wenn man das Responseverhalten bzw. die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von unerwünschten Arzneimittelwirkungen aufgrund genetischer Informationen hervorsagen könnte, wäre man dem Ziel einer personalisierten Psychopharmakotherapie oder »Präzisionsmedizin« sehr nahe. Leider hinkt dieses Forschungsfeld in punkto Stichprobenumfängen, randomisierten Studien, finanziellen Förderungen den oben beschriebenen psychiatrisch-genetischen Forschungsansätzen deutlich hinterher. Die Studienlage wird hier noch sehr von sehr kleinen Stichprobengrößen und Kandidatengenstudien geprägt. Diesem Mangel an robustem Wissen steht aber paradoxerweise ein ständig zunehmendes Vermarkten von Tests gegenüber, die suggerieren, dass man durch die Bestimmung bestimmter genetischer Polymorphismen schon jetzt präzisionsmedizinsche Arbeiten und damit leidvolle »Versuch-und-Irrtumsansätze« vermeiden könnte. Stringenter wissenschaftlicher Betrachtung halten diese Versprechen nicht stand. Das Referat »Neurobiologie und Genetik« der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) hat 2018 eine sehr umfassende Standortbestimmung zu diesem Thema veröffentlicht (Müller et al. 2018). In dieser Studie wurde die Evidenzlage für verschiedene pharmakokinetische Kandidatengene (z. B. die schon seit langem bekannten CYP2D6- oder CYP2C19-Varianten aus der Familie der Cytochrom P450-Enzymfamilie) und pharmakodynamsche Kandidatengene im Hinblick auf verschiedene Psychopharmaka diskutiert. Die Arbeit von Müller et al. (2018) schließt mit sehr konservativen Empfehlungen zum Einsatz von pharmakogenetischen Tests und reiht sich damit in eine Argumentationslinie internationaler Expertengremien ein ( Kap. 3.3). Die Pharmakogenetik der bipolaren Störung ist letztlich die Pharmakogenetik von Lithium (Budde et al. 2017). Obwohl Lithium seit über 70 Jahren erfolgreich als Phasenprophylaktikum eingesetzt wird, liegt der genaue Wirkmechanismus weiterhin im Dunklen. Neben einer Vielzahl von kleineren Kandidatengenstudien gibt allerdings schon umfangreichere GWAS. Während eine erste Studie an amerikanischen und britischen Patienten (Perlis et al. 2009) keine signifikanten Befunde hervorbrachte, konnte das international auf allen Kontinenten operierende Konsortium Consortium on Lithium Genetics (www.ConLiGen.org) eine Stichprobe von 2.563 bipolaren Patienten etablieren, die alle auf ihre Lebenszeitresponse auf Lithium-Therapie hin untersucht wurden. Die GWAS in diesem bisher einmaligen Kollektiv konnte einen Genlokus auf Chromosom 21 identifizieren, bei dem vier eng korrelierte SNP-Marker eine genomweite Signifikanz aufzeigen (Hou et al. 2016). Die mit Response assoziierte Region beherbergt zwei Gene, die für die Bildung sogenannter langer, nicht kodierender RNS (long non-coding RNA; lncRNAs) verantwortlich sind. Da lncRNAs als mögliche bedeutsame regulatorische Elemente der Genexpression, v. a. im ZNS, in den Blickpunkt neurobiologische Forschung geraten, ist dieser Befund von hohem wissenschaftlichem Interesse. Klinische Relevanz besitzt er aber noch keine, da die Effektstärke der einzelnen identifizierten Varianten, wie für eine GWAS typisch ( Kap. 3.2.1), verschwindend gering ist. Aktuell wird die ConLiGen-Initiative stetig um neue Kooperationspartner erweitert, um in den nächsten Jahren eine Kollektivgröße von 5.000 Patienten aufweisen zu können, welche dann zu einer abermals verbesserten Robustheit von genomischen Studien zur Lithiumresponse beitragen wird. Schon jetzt stellt ConLiGen eine international beachtete Ressource dar, um verschiedene Hypothesen zu testen. So konnte mit dem Kollektiv erst kürzlich gezeigt werden, dass eine hoher polygener Risikoscore für die Schizophrenie, d. h. eine hohe genetische Belastung für Schizophrenie mit einer schlechten therapeutischen Response auf Lithium bei bipolaren Patienten einhergeht (Amare et al. 2018).