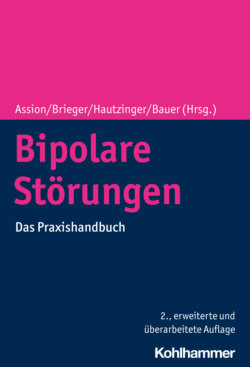Читать книгу Bipolare Störungen - Группа авторов - Страница 63
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4.2 Temperament
ОглавлениеHängt das Temperament eines Menschen mit seiner Krankheit zusammen? Diese Frage beschäftigte Gelehrte von der Antike bis zum Beginn der modernen Psychiatrie und entwickelte dazu verschiedene Konzepte (Ehrt et al. 2003). So haben über Jahrhunderte die Vier-Säfte-Lehre und die korrespondierenden melancholischen, cholerischen, sanguinischen und phlegmatischen Temperamente das medizinische Denken geprägt. In den Anfängen des 20. Jahrhunderts brachte Wundt (1903) diese vier Temperamente mit Affektanlagen in Zusammenhang und sein Schüler Kraepelin beschrieb »Grundzustände« des »manisch-depressiven Irreseins«, die eng mit Temperamentskonzepten zusammenhängen.
Diese Temperamentskonzeption, die das zyklothyme, hyperthyme, reizbare und depressive Temperament psychopathologisch als Verdünnung einer bipolaren Erkrankung ansieht, wurde Jahrzehnte später von Akiskal (1996) wieder aufgegriffen und um ein fünftes, ängstliches Temperament erweitert. Was ist aber Temperament? Es gibt zahlreiche Definitionen, gemein ist den meisten, dass Temperament als Teil der Persönlichkeit gesehen wird (Fountoulakis et al. 2016). Z. B. definiert die Encyclopaedia Britannica: Temperament ist »ein Aspekt der Persönlichkeit, der emotionale Anlagen und Reaktionen umfasst sowie deren Geschwindigkeit und Intensität«.
Ein Beweggrund für Temperamentsforschung ist, den Randbereich eines breiten bipolaren Spektrums, wie es von z. B. Angst et al. (2003) vorgeschlagen wurde, besser empirisch darstellen zu können. Dahingehend zeigte eine über drei Jahre laufende Studie, dass hypomanes Temperament viele subklinische Symptome, die nicht die vollen Diagnosekriterien erfüllten und den Rand des bipolaren Spektrums abbilden (z. B. Größenideen, Suchterkrankungen, Borderline-Persönlichkeitszüge und Impulsivität), voraussagten (Kwapil et al. 2000; Peukert und Meyer 2006; Walsh et al. 2015). In einer älteren Zusammenfassung beschreibt Angst Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen Temperament und klinischen und subklinischen affektiven Symptomen und schlussfolgert: »How to interpret the positive findings regarding the melancholic and manic subtypes of personality is an unresolved question. I would assume these subtypes to represent mild forms of the disorders itself which cannot be differentiated from personality itself« (Angst 2000, S. 190). Auch Rovai et al. (2013) finden noch viele ungelöste Fragen, gehen aber ebenfalls davon aus, dass affektive Temperamente als Spektrum anzusehen sind und erst in einer dysfunktionalen Form eine psychische Erkrankung abbilden. Genetische Studien sehen – insbesondere das zyklothyme – Temperament als leichte Form einer bipolar affektiven Störung an, finden es aber auch bei nicht erkrankten Familienangehörigen gehäuft (Evans et al. 2005; 2008; Greenwood et al. 2012; Vazquez et al. 2008).
Eine zweite Frage ist wie Temperament auf die Ätiologie, Phänomenologie und den Verlauf der bipolaren Störung wirkt. Dass ein hypomanisches Temperament mit dem Risiko an einer bipolaren Störung zu erkranken in Zusammenhang steht, konnte sowohl in Querschnitts- (Iasevoli et al. 2013; Meyer und Hautzinger 2003) als auch in Längsschnittstudien (Kwapil et al. 2000; Walsh et al. 2015) bestätigt werden. Insbesonders gibt es Hinweise, dass hypomanes Temperament eher mit Bipolar I und unipolaren Manien, und zyklothymes Temperament hingegen eher mit Bipolar II Erkrankungen zusammenhängt (Fountoulakis et al. 2016; Mehta 2014), dazu gibt es aber auch gegensätzliche Befunde (z. B. Iasevoli et al. 2013). Solmi et al. (2016) schlagen auf Grund ihrer Ergebnisse vor, die Temperamente als Kontinuum zu sehen, beispielsweise war das zyklothyme und gereizte Temperament am niedrigsten in gesunden Kontrollpersonen, etwas höher in Patienten mit unipolarer Depression und am höchsten in Patienten mit bipolarer Erkrankung zu beobachten.
Wie verhält es sich mit Temperament und akuten bipolaren Episoden? Auch hier wird ein Zusammenhang vermutet. Beispielsweise erklären sich manche Autoren bipolare Mischzustände mit dem Zusammentreffen einer akuten affektiven Symptomatik und eines Temperaments der entgegengesetzten Polarität (Perugi et al. 2012): Wenn sich z. B. auf der Grundlage eines depressiven Temperaments ein manisches oder hypomanisches Syndrom entwickelt, dann können sich nach dieser Vorstellung die beiden Zustandsbilder zu einer gemischten Episode verbinden. Diese Theorie konnte auch tatsächlich empirisch nachgewiesen werden. Patienten mit gemischten Episoden gaben hohe depressive und ängstliche sowie niedrige hypothyme Temperamentsanteile an, wenn sie mit Patienten verglichen wurde, die keine gemischten Episoden erlebt hatten (Brieger et al. 2003; Rottig et al. 2007).
Wie beeinflusst das Temperament den Verlauf der Störung? Zumindest zyklothymes Temperament scheint den Verlauf zu verschlechtern: Es mindert das Funktionsniveau (Nilsson et al. 2012), verschlechtert den Schlaf (Ottoni et al. 2011), führt zu einem früheren Ersterkrankungsalter (Maina et al. 2010; Oedegaard et al. 2009), einem höheren Risiko von Rapid Cycling (Azorin et al. 2008), mehr Suizidversuchen (Azorin et al. 2009; Fico et al. 2019), mehr depressiven Residualsymptomen (Perugi et al. 2018) und mehr psychischer Komorbidität (Hantouche et al. 2003; Perugi und Akiskal 2002; Perugi et al. 2006; 2011). Dagegen hat hyperthymes Temperament einen protektiven Effekt: Es kommt zu weniger Suizidalität (Fico et al. 2019; Vazquez et al. 2018), besseren Funktionsniveau (Perugi et al. 2018), allgemein besserem Wohlbefinden (Gamma et al. 2008) und trägt zu besseren Ansprechen auf eine Lithium-Prophylaxe bei (Rybakowski 2014). Temperamentsauffälligkeiten sind auch signifikante Prädiktoren für einen Switch von einer unipolaren Störung zu einer Bipolar II Störung (Akiskal et al. 1995).
Ein Problem in der Temperamentsforschung ist, dass man bei bereits diagnostizierten Patienten zwischen Temperament und Störung kaum differenzieren kann. Besonders schwierig ist das bei Patienten mit chronischen Verläufen oder residualen Symptomen. Ein anderes Problem ist, dass Konstrukte wie »reizbares« oder »hypomanes Temperament« keine Aussagen darüber machen, welche Prozesse, Facetten oder zugrundeliegenden Mechanismen von Relevanz sind, da sie ein Konglomerat von emotionalen, kognitiven und behavioralen Aspekten beinhalten. Selbst ein scheinbar kohärentes Konstrukt wie Impulsivität, das oft als charakteristisch im Zusammenhang mit bipolaren Störungen diskutiert wird, ist problematisch, z. B. beschreiben sich Patienten mit bipolaren Störungen in Fragebogen oftmals (aber nicht immer) als impulsiv, aber wenn man Verhaltensweisen wie Reaktionszeiten, Fehlerraten, Fähigkeit zum Belohnungsaufschub oder Inhibitionskontrolle ansieht oder die Impulsivität von Suizidversuchen untersucht, dann kann die globale Aussage, dass sie impulsiver seien, nicht aufrechterhalten werden (Muhtadie et al. 2014; Newman und Meyer 2014; Watkins und Meyer 2013).