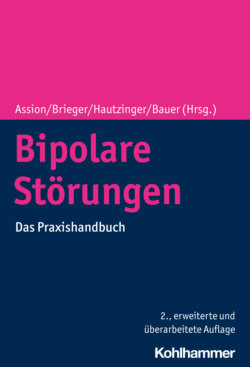Читать книгу Bipolare Störungen - Группа авторов - Страница 57
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4.1 Psychologische Theorien 4.1.1 Kognitives Modell
ОглавлениеEine der einflussreichsten Theorien zur Depression hat Beck in den späten 1960er Jahren aufgestellt. Ursprünglich für die unipolare Depression formuliert gehen Beck et al. (1967; 1979) davon aus, dass latent vorhandene negative Überzeugungen, sogenannte Schemata (z. B. »Ich bin ein Versager«), durch aktuelle Lebensereignisse (z. B. Kritik einer Bezugsperson, schlechte Schulnote) aktiviert werden können. Dieses aktivierte negative Schema kann dann negative Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen bedingen, die bei entsprechender Vulnerabilität die Dauer und Intensität einer klinisch relevanten depressiven Symptomatik annehmen können. Zusätzlich verzerrt sich oft die Wahrnehmung: Betroffene wenden sich Umweltreizen zu, die ihre negativen Überzeugungen bestätigen, und sie interpretieren ambivalente Reize in einer stimmungskongruenten negativen Weise. Das gleiche Modell lässt sich auch auf positive Schemata übertragen, die analog durch Umweltanreize und positive Lebensereignisse aktiviert werden und zu Veränderungen z. B. im Affekt, Selbstwert, Motivation und Schlafbedürfnis führen, die das Ausmaß hypomanischer oder manischer Symptome annehmen können (Meyer 2021; Newman et al. 2002).
Im Hinblick auf die bipolare Depression sind die empirischen Ergebnisse weitgehend vergleichbar mit unipolaren Depressionen, z. B. zeigen depressive bipolare Patienten vermehrt negative Grundeinstellungen und Gedanken (Pavlickova et al. 2013; Reilly-Harrington et al.1999; Scott und Pope 2003) und eine selektive Aufmerksamkeit für negative Reize (Lyon et al. 1999). Auch Personen mit zyklothymer Störung gaben in depressiver Stimmung vermehrt negative Einstellungen an (Alloy et al. 1999). Laut dem kognitiven Modell sollten Lebensereignisse für Patienten mit ausgeprägten dysfunktionalen Überzeugungen besonders relevant für das Rückfallrisiko sein, was sich für bipolare Depressionen auch bestätigen ließ (Alloy et al. 1999; Reilly-Harrington et al. 1999). Obwohl sich vermutlich die Kognitionen inhaltlich zwischen unipolarer und bipolarer Depression unterscheiden (Knowles et al. 2007; Scott und Pope 2003), sind sich diese beiden Zustände auf kognitiver Ebenen sehr ähnlich.
Hinsichtlich der Manie und Hypomanie ergibt sich ein komplexeres Bild. Wie erwartet, lassen sich in der Manie extrem positive Einstellungen (Lam et al. 2004), optimistische Erwartungen (Schönfelder et al. 2017) und Gedächtnisdefizite für negative Reize (Lex et al. 2011) beobachten. Hauptsächlich scheinen Einstellungen bezüglich sozialer Beziehungen, sich selbst, Aktivitäten und Vergnügen ins Positive verzerrt zu sein (Beck et al. 2006; Fulford et al. 2009; Goldberg et al. 2008; Shapero et al. 2015). Die Erwartung, ehrgeizige, eher unwahrscheinliche Ziele zu erreichen, z. B. ein bekannter Autor zu werden, ist in Hochrisikogruppen sowie Personen mit subklinischer und klinischer bipolarer Störung auffällig hoch und beeinflusst manische Rückfälle (Johnson und Carver 2006; Johnson et al. 2009; 2012a; Tharp et al. 2016). Ein positiver Gedächtnisbias sagt im Verlauf ebenfalls maniforme Episoden vorher (Meyer et al. 2018). Dazu im Gegensatz wurde aber auch gefunden, dass manische Patienten keinen höheren Selbstwert als gesunde Personen angeben (van der Gucht et al. 2009), und hypomane Patienten gleichzeitig negative und positive Kognitionen aufweisen (Fletcher et al. 2013; Scott und Pope 2003). Interessanterweise fanden Lyon et al. (1999), dass die Manie mit einer selektiven Aufmerksamkeit für negative Reize einhergeht, was auch bei Personen mit erhöhter Vulnerabilität gefunden wurde (Bentall und Thompson 1990; French et al. 1996). Hierzu passt auch, dass einerseits positive Ereignisse, die mit dem Erreichen persönlich wichtiger Ziele einhergehen, das Risiko für manische Symptome und Episoden erhöht (Johnson et al. 2008; Mansell und Pedley 2008; Weiss et al. 2015), aber andrerseits auch negative Lebensereignisse (z. B. Todesfall) zusammen mit einer ausgeprägten kognitiven Vulnerabilität das Risiko für eine Manie steigern. Dies gilt insbesondere, wenn diese Lebensereignisse im Alltag zu Veränderungen führen und mit der Störung des Schlaf-Wach-Rhythmus einhergehen (z. B. Arbeitsplatzverlust, Trennung) (z. B. Malkoff-Schwartz et al. 1998).
Ein integratives kognitives Modell wurde von Mansell et al. (2007) vorgeschlagen. Hier wird davon ausgegangen, dass es zu einer Fehlinterpretation von emotionalen und körperlichen Gefühlen kommt und dies dann infolge depressive oder manische Symptome auslösen kann (Mansell et al. 2007). Empirisch konnte das Modell für die depressive Symptomatik weitgehend bestätigt werden (Alatiq et al. 2010; Kelly et al. 2012; Mansell et al. 2011). Für die Manie gibt es noch zu wenige und uneinheitliche Ergebnisse, um die Validität des Modells zu beurteilen (Übersichtsarbeit: Dodd et al. 2019).
Zusammenfassend erscheint das kognitive Modell der unipolaren Depression weitgehend auch für die bipolare Depression angemessen. Die kognitive Vulnerabilität für Manie und Hypomanie umfasst allerdings nicht nur ein ausschließliches positives Selbstkonzept, vielmehr scheinen hier parallel auch depressionstypische Denkmuster präsent zu sein.