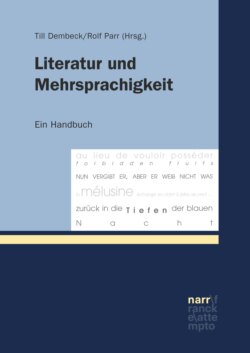Читать книгу Literatur und Mehrsprachigkeit - Группа авторов - Страница 27
b) Wertschätzung und Wertschöpfung: Sprache als kulturelles Kapital
ОглавлениеDie Vorstellung von Sprache als gesellschaftlichem ›Produktionsmittel‹, als entscheidendem ›Kapital‹ zur Erschließung sozialer und wirtschaftlicher Potentiale, geht auf Pierre BourdieuBourdieu, Pierre zurück (BohnBohn, Cornelia/HahnHahn, Alois, »Pierre BourdieuBourdieu, Pierre«). Die herkömmliche Vorstellung von Kapital als materiell-ökonomischer Größe wird damit um weitere Kapitalformen ergänzt, unter anderen um das Konzept des kulturellen Kapitals. Das kulturelle Kapital umfasst die inkorporierten Wissensbestände (inklusive der Sprachenkenntnisse), die Mehrwerte erzeugen können, und zwar entweder durch die Anreicherung weiteren Wissens (kulturellen Kapitals) oder durch die Transformation dieses Kapitals in andere Kapitalformen. Diese Modellvorstellung ist hilfreich, um die strukturelle Beschaffenheit einiger typischer Zugangsprobleme von Migranten zur gesellschaftlichen Teilhabe darzustellen. Die Transformationsmöglichkeiten für bestimmte Kapitalformen sind nicht beliebig, sondern von den vorliegenden Macht- und Herrschaftsstrukturen einer jeweiligen Gesellschaft abhängig. Typisch für die Situation von Migranten ist es daher, dass sie einen großen Anteil ihres kulturellen Kapitals für Transformationen nicht einsetzen können, obwohl das Kapitalvolumen an sich einen beträchtlichen Umfang aufweisen kann. Das liegt daran, dass die entsprechenden sprachgebundenen Bestandteile ihres kulturellen Kapitals in der Zielgesellschaft als nicht konvertierbar – also integrierbar – gelten, die Migranten aber andererseits nicht ausreichend über die integrierbaren Kapitalformen der Zielkultur verfügen.
Wohin dieses Dilemma bei Zuwanderern führt, illustriert Katharina BrizićBrizić, Katharina (»Ressource Familiensprache«) anhand einer exemplarischen Studie zur Mehrsprachigkeit von Kurden in Österreich. Dabei zeigt sich, dass die autochthonen Sprecherinnen und Sprecher des Kurdischen zwar Kurdisch als ihre Muttersprache nennen, sie aber selbst abwertend einstufen, da sie für die Sprache in ihrer neuen Umgebung (Wien) außerhalb der Familie kaum kommunikative Funktionen oder Konvertierbarkeit erkennen. Sie empfinden sie selbst als nicht integrierbar oder nicht integrationswürdig. Diese Art der Selbstexklusion in Bezug auf die eigene Sprachkompetenz oder Verwendungsabsicht, die individuelle und gesellschaftliche Ambivalenz in der Bewertung des Nutzens oder die Einschätzung der vermeintlichen Nutzlosigkeit einer Sprache sowie die negative Einschätzung des Sprachstatus erzeugen damit negative Wirkungen auf den Erwerb, den Gebrauch und die Weitergabe einer Sprache an die nächste Generation, die oft nur in (folkloristischer) Literatur und Musik und durch eine Besinnung auf das kulturelle Erbe korrigiert werden.