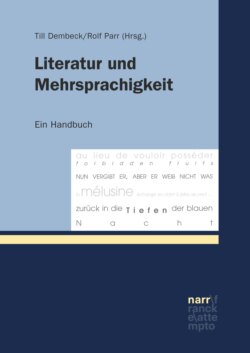Читать книгу Literatur und Mehrsprachigkeit - Группа авторов - Страница 34
b) Alterität und Sprachreflexivität
ОглавлениеRainier GrutmanGrutman, Rainier definiert literarische »Mehrsprachigkeit« als »the use of two or more languages within the same text« (Grutman, »Multilingualism«, 183). Die sprachliche Differenz in der Literatur kann auch durch eine »sprachliche Binnenfremdheit« inszeniert werden (PasewalckPasewalck, Silke, »›Als lebte ich …‹«, 389). Anknüpfend an Michail M. BachtinBachtin, Michail M.s Konzept der Polyphonie lässt sich literarische Mehrsprachigkeit auch mit gesellschaftlichen Sprachdifferenzen und Redevielfalt verbinden. Dabei handelt es sich nicht nur um Sprachmischung, sondern an erster Stelle um verschiedene Diskurse, Ideolekte, Soziolekte sowie auch Dialekte und historische Varietäten einer Sprache, deren Zusammenspiel Grutman (1997) in seiner Arbeit zum Roman in Québec im 19. Jahrhundert als »Heterolingualismus« bezeichnet hat (GrutmanGrutman, Rainier, Des langues qui résonnent). Diese heterolingualen Differenzen im Text können Sprecherdifferenzen entsprechen (Bourdieu, »Die verborgenen Mechanismen«), indem die soziale und kulturelle Verortung der jeweiligen Sprecher zum Ausdruck gebracht wird (Dembeck, »Für eine Philologie der Mehrsprachigkeit«, 28). BachtinBachtin, Michail M. bestimmt den Roman als inhärent mehrsprachige Gattung. In seiner Arbeit über DostojewskiDostojewski, Fjodor Michailowitsch unterstreicht Bachtin die »karnevalistische Ambivalenz« des Romans (Bachtin, Probleme der Poetik Dostoevskijs, 141). Die Polyphonie, die aus dieser Ambivalenz hervorgeht, stellt die Einheit des Subjekts in Frage, diskursive Einheit wird ausgeschlossen und dadurch der »ideologisch[e] Monolog« zerstört (ebd.Bachtin, Michail M., 354f.). Die Ethik der Mehrsprachigkeit in der Literatur verabschiedet dabei nicht die Einsprachigkeit, denn ausgehend von den verschiedenen Einzelsprachen kann Wesentliches über das abstrakte System der Sprache ausgesagt werden (RadaelliRadaelli, Giulia, Literarische Mehrsprachigkeit, 16). Die durch Standardisierung zustande gekommene Einheit der nationalen Einzelsprachen wird spätestens im 19. Jahrhundert als eine Form von symbolischer Reinheit aufgefasst. Sie verkörpern somit etwas, das vorher nur den Heiligen Sprachen vorbehalten war (Dembeck, »Für eine Philologie der Mehrsprachigkeit«, 23). Diesen säkularisierten Sprachen kommt damit eine kulturkonstitutive Rolle zu, die eng an die Auffassung des ›Besitzes‹ der Muttersprache geknüpft ist. Johann Gottfried HerderHerder, Johann Gottfrieds ›Muttersprachenpoetik‹ etwa setzt voraus, dass der Mensch nur eine Sprache hat und dass diese Sprache den Muttersprachlern gehört. In diesem Sinne wird davon ausgegangen, dass ein Sprecher nur durch seine Muttersprache seine wahre Identität zum Ausdruck bringen könne, während zugleich nur dank des Muttersprachlers das Wesen dieser Sprache in Erscheinung treten kann (MartynMartyn, David, »Es gab keine Mehrsprachigkeit«, 45). Gleichzeitig sind Muttersprache und Fremdsprache jedoch dadurch unlöslich miteinander verbunden, dass die Fremdsprache die zentrale Stelle der Muttersprache in der Sprachenhierarchie des 19. Jahrhunderts etabliert und ihr stets untergeordnet wird (ebd., 44). Johann Wolfgang von GoetheGoethe, Johann Wolfgang von vertritt nicht nur das traditionsreiche Argument, dass Dichten nur in der Muttersprache möglich bzw. erwünscht sei, sondern führt auch an, dass Literatur, auch in der Muttersprache, per se immer ein Medium fremder bzw. verfremdeter Sprache sei. Die Verbindung von Fremdheit und Eigenheit in der Muttersprache wird bis heute von vielen anderen Autoren hervorgehoben, wie beispielsweise auch von Herta MüllerMüller, Herta. In Heimat ist das, was gesprochen wird stellt Müller dar, wie gerade die ›eigene‹ Sprache prinzipiell von ›fremden‹ Elementen durchsetzt ist: »Es tut keiner Muttersprache weh, wenn ihre Zufälligkeiten im Geschau anderer Sprachen sichtbar werden. Im Gegenteil, die eigene Sprache vor die Augen einer anderen zu halten, führt zu einem durch und durch beglaubigten Verhältnis, zu einer unangestrengten Liebe.« (MüllerMüller, Herta, Heimat ist, 21) Auch Walter BenjaminBenjamin, Walter hebt in »Die Aufgabe des Übersetzers« hervor, dass erst im Bewusstsein der Kontraste zwischen den Sprachen ihr originäres Verwandtschaftsverhältnis zwischen einander offensichtlich wird, das sich in der Unvollständigkeit der einzelnen Sprachen und der Notwendigkeit ihrer Ergänzung durch andere artikuliert (BenjaminBenjamin, Walter, »Die Aufgabe des Übersetzers«, 19).
Die Verarbeitung sprachlicher Differenzen in der Literatur bedeutet oft zugleich auch die Demontage einer nationalstaatlichen Sprachideologie und die Hervorhebung sprachlich-kultureller Grenzüberschreitungen im Text. In Gilles DeleuzesDeleuze, Gilles und Félix GuattariGuattari, Félixs KafkaKafka, Franz. Pour une littérature mineure (1975) wird darauf hingewiesen, wie KafkaKafka, Franz, als tschechischer, deutschsprachiger Jude, in seinen literarischen Texten fremdsprachliche – tschechische, jiddische – Elemente aufnimmt (MontandonMontandon, Alain, Désirs d’hospitalité, 245–259; RadaelliRadaelli, Giulia, Literarische Mehrsprachigkeit, 34). Vor dem Hintergrund des Ersten Weltkriegs und des Nationalismus in Europa wird auch in der historischen Avantgarde die Verbindung von Nationalsprache und Kollektividentität radikal in Frage gestellt. Die internationale DADA-Bewegung führt den Nationalismus ad absurdum, indem sie ihre Performances bewusst mehrsprachig gestaltet und zugleich die vorgebliche ›Reinheit‹ der Einzelsprachen dekonstruiert, dadurch dass sie sie durch ein kindliches, prärationales Idiom ersetzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat die Rechtfertigung der ›Treue‹ zur deutschen Sprache bei Exilanten bzw. Opfern des Nationalsozialismus wie Paul CelanCelan, Paul, Thomas MannMann, Thomas und Theodor W. AdornoAdorno, Theodor W. oft Anlass für eine Auseinandersetzung mit der NS-Sprache und ihrer gewalttätigen Dimension gegeben (RadaelliRadaelli, Giulia, Literarische Mehrsprachigkeit, 35–38). In Terézia MoraMora, Terézias Roman Alle Tage wird dem Leser aus transnationaler Perspektive vor Augen geführt, welche ethischen Implikationen die Orientierung am Einsprachigkeitspostulat der ›Leitkultur‹ beinhalten kann. Im Exil verliert der Migrant Abel Nema nach einem Überfall seine Erinnerungen: »Die Amnesie hat sich bestätigt, er erinnert sich an nichts mehr, wenn man ihm sagt, was man über ihn weiß, sein Name sei Abel Nema, er sei aus dem und dem Land gekommen, und habe einst ein Dutzend Sprachen gesprochen, übersetzt, gedolmetscht, schüttelt er höflichverzeihend-ungläubig den Kopf.«1Mora, Terézia Die physische Gewalt gegen den Einwanderer führt nicht nur zur Aphasie, sondern auch zur Amnesie. Er spricht letztendlich nur noch in der Landessprache, und dies am besten in höchst verkürzter und somit vereinfachter Form. Der Preis für die gewaltsame Assimilation scheint das Vergessen der eigenen Identität, Herkunft und Mehrsprachigkeit zu sein. Die Ethik der Mehrsprachigkeit wird auf diese Weise durch die Einsprachigkeit der Assimilation zunichte gemacht (TatascioreTatasciore, Claudia, Con la lingua, contro la lingua, 137–156). Terézia MoraMora, Terézias Dekonstruktion der nationalpolitischen Ideologie der Einzelsprachen zeigt, wie die Mehrsprachigkeit sowohl mit ihrem Begegnungs- als auch mit ihrem Konfliktpotential als gezielte Einmischung in gesellschaftliche Verständigungsprozesse literarisch inszeniert wird (LeschLesch, Walter, Übersetzungen, 423). In der postkolonialen Literatur kann die übernommene Kolonialsprache paradoxerweise auch als Idiom der Emanzipation bzw. Subversion benutzt werden, wie dies nicht nur in der britischen postkolonialen Literatur beobachtet werden kann, sondern es auch des Öfteren in der frankophonen maghrebinischen Literatur der Fall ist. Der algerische Schriftsteller Kateb YacineYacine, Kateb bezeichnet das Französische vor diesem Hintergrund daher auch als eine »Kriegsbeute«, als »butin de guerre«,2Yacine, Kateb um auf Französisch dem französischen Lesepublikum zu sagen, er sei explizit nicht französisch. In einem Interview behauptet die französisch-algerische Autorin Malika MokeddemMokeddem, Malika, die arabischen Wörter in ihren französischen Texten hätten eine politische Bedeutung, da sie in und mit ihrer sprachlich hybriden Literatur »coloniser le français«3 wolle (Mokeddem in HelmHelm, Yolande Aline, Malika MokeddemMokeddem, Malika, 29). Nicht nur in der postkolonialen Literatur, sondern auch im Wissenschaftsdiskurs der postkolonialen Literaturtheorie kommt der Hybridisierung der ehemaligen Kolonialsprache eine wichtige ethische Rolle zu. So bemüht sich Gayatri Chakravorty SpivakSpivak, Gayatri Chakravorty, in ihren Werken das Englische durch das Bengalische zu bereichern. Sie fasst es, vor allem dann, wenn man in einer postkolonialen Fremdsprache schreibt, als eine ethische Verantwortung auf, aus der Muttersprache zu schöpfen, um die ›Ziel‹-Sprache durch das ethische Konzept des ›matririn‹ (Mutterschuld) zu hybridisieren (SpivakSpivak, Gayatri Chakravorty, »Translation as Culture«, 14f.).
Die ausgeprägte Sprachreflexivität in der mehrsprachigen Literatur, die mit einer Betonung der fundamentalen Polysemie sprachlicher Äußerungen einhergeht, hat insoweit eine ethische Dimension, als sie die Mehrgleisigkeit des Denkens und somit auch die Vielfältigkeit menschlichen Zusammenlebens vor Augen führen kann. In der Sprachkritik, wie man sie beispielsweise bei Autoren wie Yoko TawadaTawada, Yoko oder Philosophen wie Jacques DerridaDerrida, Jacques vorfindet, wird die Vorstellung von Sprache als ›Besitz‹ immer wieder neu ad absurdum geführt. Jenseits des ›Einsprachigkeitsparadigmas‹ spricht Yasemin YildizYildiz, Yasemin in Beyond the Mother Tongue (2012) von einer »postmonolingual condition«, in der man sich derzeit befinde. In Le monolinguisme de l’autre (1996) stellt DerridaDerrida, Jacques im Begriff ›Muttersprache‹ den Bezug zwischen Geburt und Blut auf der einen Seite und Sprache auf der anderen Seite in Frage. Auch Giorgio AgambenAgamben, Giorgio weist in Mittel ohne Zweck auf die Verquickung von ›factum loquendi‹ und ›factum pluralitatis‹ als seit der Romantik von Sprach- und Politikwissenschaft vorausgesetzte Fiktionen hin. Das Verhältnis von Sprache und Gemeinschaft, die im nationalstaatlichen Kontext unhinterfragt aufeinander bezogen werden, wird von Agamben dekonstruiert, indem die grundsätzliche und indefinite Fremdheit von »Sprache« und »Volk« in den Mittelpunkt gerückt wird: »Die Relation Zigeuner-argot stellt diese Entsprechung im gleichen Moment, da sie sie parodistisch übernimmt, radikal in Frage. Die Zigeuner verhalten sich zum Volk, wie der argot sich zur Sprache verhält; aber in dem kurzen Moment, den die Analogie andauert, lässt sie ein Schlaglicht fallen auf die Wahrheit, die zu verdecken die Entsprechung Sprache-Volk insgeheim angelegt war: Alle Völker sind Banden und ›coquilles‹, alle Sprachen sind Jargons und ›argot‹.« (AgambenAgamben, Giorgio, Mittel ohne Zweck, 68) Wenn das Fremde jeder Sprache prinzipiell eingeschrieben ist, dann ist demzufolge jede Sprache bereits eine Übersetzung, »keine ursprünglich natürliche, sondern eine ursprünglich kultivierte, überbaute Sprache« (HaverkampHaverkamp, Anselm, »Zwischen den Sprachen«, 9). Illustrieren kann das auch ein Brief von Klaus MannMann, Klaus vom 18.2.1949 aus dem amerikanischen Exil an Herbert SchlüterSchlüter, Herbert; ein Brief, in dem Mann hervorhebt, wie der deutsch-englische Bilingualismus seine ursprüngliche Idee einer lebenslänglichen Beheimatung in der ›Muttersprache‹ erschüttert habe: »Damals hatte ich eine Sprache, in der ich mich recht flink auszudrücken vermochte; jetzt stocke ich in zwei Zungen. Im Englischen werde ich wohl nie ganz so zuhause sein, wie ich es im Deutschen war – aber wohl nicht mehr bin …«4Mann, KlausGregor-Dellin, Martin Die Mehrsprachigkeit dekonstruiert somit die Auffassung der Ursprünglichkeit bzw. Natürlichkeit der Erstsprache, wie dies auch Thomas Paul BonfiglioBonfiglio, Thomas Paul in Mother Tongues and Nations (2010) beschreibt.
Auch aus pädagogischer Perspektive, in der Sprachendidaktik, kann auf die ethische Bedeutsamkeit der Vermittlung mehrsprachiger Literatur an ein studentisches Publikum hingewiesen werden. Aus einer multilingualen Einstellung als Lernattitüde soll bei der Lektüre die Berücksichtigung der spezifischen Literarizität mehrsprachiger Literatur sowie die Anerkennung transnationaler Autoren hervorgehen: »When we adopt a multilingual orientation, we view writers as making distinct choices based on their multilingual status, rather than making ›mistakes‹ because of their multilingual status.« (OlsonOlson, Bobbi, »Rethinking our Work«, 3)
Diese Wertschätzung der sprachlichen Diversität und die Betonung der multilingualen Poetik der transkulturellen Literatur wird von Feridun ZaimoglZaimoglu, Feridunu aufs Korn genommen. In der Rezeption wird die in Kanak Sprak verwendete ungrammatische, unidiomatische ›Zwischensprache‹ oft als ethisch-politische Chiffre und Aufforderung zur Toleranz und Empathie aufgefasst. Das Verlangen des Lesers nach exotischer ›Authentizität‹ und ›Wahrhaftigkeit‹ wird von ZaimogluZaimoglu, Feridun radikal abgelehnt, weil auf diese Weise seinen literarischen Texten die Autonomie aberkannt werde: »Die ›besseren Deutschen‹ sind von diesen Ergüssen ›betroffen‹, weil sie vor falscher Authentizität triefen, ihnen ›den Spiegel vorhalten‹, und feiern jeden sprachlichen Schnitzer als ›poetische Bereicherung ihrer Mutterzunge‹. Der Türke wird zum Inbegriff für Gefühl, einer schlampigen Nostalgie und eines faulen ›exotischen‹ Zaubers.«5Zaimoglu, Feridun