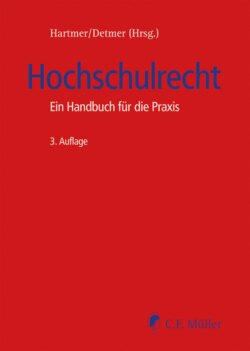Читать книгу Hochschulrecht - Группа авторов - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Gesetzgebungszuständigkeiten des Bundes und der Länder
Оглавление43
Im bilanzierenden Blick auf Art. 5 Abs. 3 GG stellt sich rasch die Erkenntnis ein, dass die weit aufgefächerten Gewährleistungsebenen des Grundrechts zwar erstaunlich viel festlegen, in vielem aber auch die ordnende Hand des Gesetzgebers nötig ist. Der Gesetzgeber besitzt dabei weite Gestaltungsspielräume. In der bundesstaatlichen Ordnung des Grundgesetzes führt dies zu der Frage, welcher Gesetzgeber aufgerufen ist, der Bundesgesetzgeber oder der Landesgesetzgeber. Das Grundgesetz hat bei seiner Entstehung im Jahr 1949 die Errichtung, Finanzierung und Organisation von Hochschulen in der ausschließlichen Gesetzgebungszuständigkeit der Länder belassen. Gewiss, der Bund besaß von Anfang an Zuständigkeiten für den Schutz des geistigen Eigentums (Art. 73 Nr. 9 GG)[60] und für die Statistik für Bundeszwecke (Art. 73 Nr. 11 GG),[61] die beide auf die Hochschulen einwirken. Außerdem besaß er von Anfang an die Verbandskompetenz für die Pflege der auswärtigen Beziehungen (Art. 32 Abs. 1 GG), die es den Bundesländern zwar nicht unmöglich macht, aber doch erheblich erschwert, auf dem Gebiet des Hochschulwesens zu rechtsförmlicher internationaler Zusammenarbeit zu gelangen.[62] Und schließlich besaß der Bund von Anfang an eine konkurrierende Gesetzgebungskompetenz für die „Förderung der wissenschaftlichen Forschung“,[63] die 1969 im Wege der Grundgesetzänderung um die Kompetenz für die „Regelung der Ausbildungsbeihilfen“[64] erweitert wurde (Art. 74 Abs. 1 Nr. 13 GG). Aber dies alles bestätigte mehr als es zu widerlegen, dass die eigentliche Zuständigkeit für die Organisation des deutschen Hochschulwesens bei den Ländern lag.
44
Die Länder besaßen eine in Art. 70 Abs. 1 GG anerkannte originäre und ausschließliche Gesetzgebungszuständigkeit für das Hochschulwesen. Bis in die Mitte der 60er Jahre hinein fühlten die Bundesländer sich kaum bemüßigt, von ihrer Gesetzgebungszuständigkeit Gebrauch zu machen. Das deutsche Hochschulrecht beruhte zum größten Teil auf ungeschriebenen, weitgehend bundeseinheitlich angewandten Grundsätzen und ständigen Übungen. Es unterschied sich darin nicht von anderen Regelungsbereichen. Bis in die Mitte der 70er Jahre war das allgemeine Verwaltungsrecht, heute für viele unvorstellbar, auch nichts anderes als ein Konglomerat ungeschriebener allgemeiner Grundsätze.[65] Die einsetzenden politischen Auseinandersetzungen um die Zukunft der deutschen Universität, die einzelne Bundesländer zur Verabschiedung ehrgeiziger Hochschulgesetze veranlassten, ließen den Plan entstehen, dem Bund zur Wahrung eines Mindestmaßes an bundeseinheitlicher Gestaltung eine Rahmengesetzgebungskompetenz für das Hochschulwesen einzuräumen.[66] Im Vermittlungsausschuss,[67] den der Bundesrat angerufen hatte,[68] um die vom Bundestag beschlossene[69] Rahmengesetzgebungszuständigkeit für „das Hochschulwesen“ im Interesse eines größeren Gestaltungsspielraums der Länder zu modifizieren, einigte man sich auf die bis zum Jahr 2006 geltende Fassung „allgemeine Grundsätze des Hochschulwesens“. Das 22. Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 12.5.1969[70] hat diese Textfassung in das Grundgesetz als neuen Art. 75 Abs. 1 S. 1 Nr. 1a eingefügt.
45
Mit der Beschränkung auf „allgemeine Grundsätze“ des Hochschulwesens statuierte das Grundgesetz nicht etwa eine neue Art von Gesetzgebungskompetenz, die aus einer Kombination von Rahmengesetzgebung und Grundsatzgesetzgebung bestünde.[71] Der systematische Zusammenhang wies die Kompetenz des Bundes eindeutig als eine Rahmengesetzgebungskompetenz aus, die allerdings hinsichtlich ihrer Regelungsdichte zusätzlich auf „allgemeine Grundsätze“ beschränkt war.[72] Das Bundesverfassungsgericht hat diese Beschränkung zwar nicht als ein Verbot der in anderen Fällen ja ausnahmsweise zulässigen Vollregelungen (Art. 75 Abs. 2 GG) gedeutet.[73] Der Bund durfte mithin in Ausübung seiner Rahmengesetzgebungszuständigkeit für die „allgemeinen Grundsätze des Hochschulwesens“ auch ins Einzelne gehende Vollregelungen treffen, solange diese nur „im Zusammenhang eines Gesetzeswerkes [stehen], das – als Ganzes gesehen – dem Landesgesetzgeber noch Spielraum läßt und darauf angelegt ist, von ihm aufgrund eigener Entschließung ausgefüllt zu werden.“[74] Die Beschränkung auf die allgemeinen Grundsätze des Hochschulwesens zwang den Bund aber insgesamt, zurückhaltender von seiner Kompetenz Gebrauch zu machen.[75] Dies bedeutet, dass er den Ländern im Vergleich zu den anderen Regelungsmaterien des Art. 75 Abs. 1 GG bereits in dieser alten Fassung ein besonders hohes Maß an eigener Gestaltung lassen musste.
46
Gemessen an diesem Maßstab war zweifelhaft, ob das Hochschulrahmengesetz, das der Bund unter Inanspruchnahme des Art. 75 Abs. 1 S. 1 Nr. 1a GG erließ, in seinen verschiedenen Entwicklungsstufen stets mit der grundgesetzlichen Kompetenzverteilung übereinstimmte. Als das Gesetz am 26.1.1976 verabschiedet wurde,[76] gab es etliche Stimmen, die seine zu hohe Regelungsdichte und damit einen verfassungswidrigen Verlust an substantieller landeseigener Gestaltungskompetenz beklagten.[77] Diese Bedenken gegen einen zu extensiven Gebrauch der Rahmengesetzgebungskompetenz wurden nie vollständig ausgeräumt.
So provozierten etwa die 5. und 6. HRG-Novelle aus dem Jahr 2002 den Widerstand verschiedener Bundesländer. Die Länder Thüringen, Bayern und Sachsen wendeten sich mit einem Normenkontrollantrag gegen das Fünfte Gesetz zur Änderung des Hochschulrahmengesetzes und anderer Vorschriften (5. HRGÄndG) vom 16.2.2002 (BGBl. I S. 693). Das Bundesverfassungsgericht entschied am 27.7.2004, dass die 5. Novelle des HRG nichtig sei. In der Entscheidung heißt es, dass gerade im Kern des Reformvorhabens – der Einführung der Juniorprofessur – so wenig Raum für landesrechtliche Entscheidungen verbleibe, dass nicht mehr von einer Regelung der allgemeinen Grundsätze des Hochschulwesens i.S.v. Art. 75 Abs. 1 S. 1 Nr. 1a GG ausgegangen werden könne.
Ebenso wurde das Verbot der Erhebung von Studiengebühren für verfassungswidrig erklärt. Das Bundesverfassungsgericht entschied am 26.1.2005 auf den Normenkontrollantrag der Länder Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, dass das Sechste Gesetz zur Änderung des Hochschulrahmengesetzes (6. HRGÄndG) vom 8.8.2002 (BGBl. I S. 3138) mit dem Grundgesetz unvereinbar und daher nichtig ist. Dem Bund sei es „gemäß Art. 75 Abs. 1 S. 1 GG in Verbindung mit Art. 72 Abs. 2 GG verwehrt, die Gesetzgebung der Länder durch Rahmenvorschriften auf den Grundsatz der Gebührenfreiheit des Studiums zu verpflichten“.[78] Damit machte das Bundesverfassungsgericht den Weg für Studiengebühren frei. Sieben westdeutsche Bundesländer führten daraufhin in unterschiedlicher Höhe Studiengebühren ein. Wegen der politischen Widerstände, die auch und gerade in Landtagswahlen sichtbar wurden, haben die gebührenerhebenden Länder sukzessive von der Gebührenerhebung wieder Abstand genommen. Seit dem Wintersemester 2013/14 werden in Deutschland von den staatlichen Hochschulen keine Studiengebühren mehr erhoben.
Die letzte inhaltliche Revision des HRG erfolgte durch das Wissenschaftszeitvertragsgesetz (Gesetz über befristete Arbeitsverträge in der Wissenschaft vom 12.4.2007, BGBl. I S. 506, zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.3.2016, BGBl. I S. 442). Dieses hat den bisher im Hochschulrahmengesetz (§§ 57a–f) geregelten Abschluss befristeter Arbeitsverhältnisse mit wissenschaftlichem und künstlerischem Personal an Hochschulen und Forschungseinrichtungen zum Gegenstand. Die Regelungen des beamten-, besoldungs- und versorgungsrechtlichen Besitzstandes etwa für emeritierungsberechtigte Professorinnen und Professoren werden aus den §§ 76 ff. HRG in das Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) verlagert.
47
Vor dem Hintergrund der Föderalismusreform 2006 und der Abschaffung der Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes hat die Bundesregierung die Aufhebung des Hochschulrahmengesetzes beschlossen. Ein erster Entwurf eines Gesetzes zur Aufhebung des Hochschulrahmengesetzes der damaligen Bundesregierung stammt vom 9.5.2007. Im Zuge der parlamentarischen Beratung im Bundestag wurde zunächst ein Außerkrafttreten zum 1.10.2007 beschlossen. Dieser Termin konnte jedoch wegen der parallel verlaufenden Gesetzgebung zum Beamtenrecht nicht eingehalten werden. Auch die neue, im September 2009 gewählte Regierung einigte sich in den Koalitionsverhandlungen darauf, das Hochschulrahmengesetz abzuschaffen. An dessen Stelle soll ein „Wissenschaftsfreiheitsgesetz“ treten. Die Aufhebung des HRG schien daher absehbar, ist allerdings bis zum heutigen Tage noch nicht erfolgt. Demnach ist auf Bundesebene nach wie vor das Hochschulrahmengesetz in seiner zuletzt verbliebenen Fassung vom 12.4.2007 geltendes Recht (Art. 125a Abs. 1 S. 1 GG). Allerdings können die bundesrechtlichen Regelungen des HRG durch Landesrecht ersetzt werden (Art. 125a Abs. 1 S. 2 GG). Von seiner in Art. 74 Abs. 1 Nr. 33 GG nach der Föderalismusreform verbliebenen Gesetzgebungszuständigkeit für „Hochschulzulassung“ und „Hochschulabschlüsse“ hat der Bund bislang keinen Gebrauch gemacht. Das mag auch daran liegen, dass die Bundesländer von entsprechenden bundesrechtlichen Regelungen per Landesgesetz abweichen könnten (Art. 72 Abs. 3 Nr. 6 GG).
1. Kapitel Grundfragen des institutionellen Hochschulrechts › I. Hochschulen im Verfassungsstaat › 3. Landeshochschulgesetze