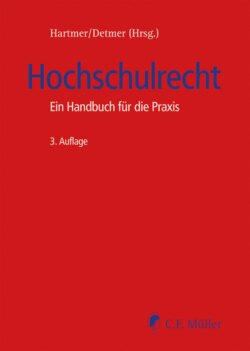Читать книгу Hochschulrecht - Группа авторов - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Verwaltungszuständigkeiten von Bund und Ländern
Оглавление52
Der Gesetzesvollzug ist in der bundesstaatlichen Ordnung des Grundgesetzes generell Sache der Länder, soweit das Grundgesetz nichts anderes vorsieht (Art. 30 GG). Demgemäß besitzen die Länder die Verbandskompetenz für den Vollzug ihrer Landeshochschulgesetze. Im Vollzug der Landeshochschulgesetze haben die staatlichen Organe der Bundesländer freilich die den Hochschulen einfach-gesetzlich eingeräumte und bis zu einem gewissen Grad auch verfassungsrechtlich gewährleistete Selbstverwaltung zu respektieren.[80] Die Länder sind andererseits dazu befähigt, auf dem Gebiet des Hochschulwesens länderübergreifend zu kooperieren. Sie dürfen sich dabei ihrer eigenen gliedstaatlichen Teilsouveränität nicht entäußern, wohl aber – meist in Form von Verwaltungsabkommen – vertraglich binden und dabei sogar gemeinsame Einrichtungen ins Leben rufen. Den wichtigsten Anwendungsfall dieser Länderkooperation auf dem Gebiet des Hochschulwesens verkörperte die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS), die auf der Grundlage eines Staatsvertrages vom 20.10.1972 errichtet wurde[81] und am 6.3.2008 per Staatsvertrag in die „Stiftung für Hochschulzulassung“ mit Sitz in Dortmund umgewandelt wurde.[82] Die 1948 vor der Entstehung des Grundgesetzes geschaffene und dann bis heute fortgeführte Kultusministerkonferenz (KMK) ist, wie der Name schon andeutet, keine rechtsfähige Einrichtung und schon gar nicht ein Verfassungsorgan, sondern ein Kooperationsgremium, in dem die Bundesländer ihre kultur- und bildungspolitischen Aktivitäten koordinieren. Den Beschlüssen der KMK kommt unmittelbar keine rechtliche Bindungswirkung zu. Rechtliche Wirkung entfalten sie nur, wenn sie von den Ländern durch eigene Rechtsetzung umgesetzt werden.[83]
53
Der Vollzug der Bundesgesetze liegt nach der Grundregel des Art. 83 GG in der Zuständigkeit der Länder. Die Länder unterliegen dabei der Rechtsaufsicht durch die Bundesregierung (Art. 84 Abs. 3 S. 1 GG). Mit Zustimmung des Bundesrates kann die Bundesregierung überdies allgemeine Verwaltungsvorschriften erlassen (Art. 84 Abs. 2). Weitaus gebräuchlicher und gerade im Zusammenhang des Hochschulrahmengesetzes bedeutend ist die dem Bundesgesetzgeber eingeräumte Möglichkeit, mit Zustimmung des Bundesrates für den Landesvollzug von Bundesgesetzen gleich die Einrichtung der Behörden und das Verwaltungsverfahren mit zu bestimmen (Art. 84 Abs. 1 GG). Dies hatte im Zusammenhang der 4. und der 5. HRG-Novelle zu der politisch und rechtlich gleichermaßen umstrittenen Frage geführt, ob Änderungen des Hochschulrahmengesetzes die Zustimmung des Bundesrates erfordern.[84]
54
Weitergehende Einflussmöglichkeiten besitzt der Bund im Bereich der Bundesauftragsverwaltung, die nur in einigen vom Grundgesetz explizit vorgesehenen Fällen statthaft ist. Im Zusammenhang des Hochschulwesens kommt die Bundesauftragsverwaltung vor, soweit das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) betroffen ist. Es ist ein Geldleistungsgesetz im Sinne des Art. 104a Abs. 3 S. 2 GG, das im Auftrag des Bundes von den Ländern vollzogen wird. Hier besitzt der Bund in Form von fachaufsichtlichen Weisungsrechten Befugnisse, die weit über die bloße Rechtsaufsicht hinaus reichen.
55
Selbst der im Grundgesetz nur sparsam eingerichtete Bereich bundeseigener Verwaltung ist für das deutsche Hochschulwesen bedeutungsvoll. So betreibt der Bund im Rahmen der in bundeseigener Verwaltung stehenden Bundeswehrverwaltung (Art. 87b Abs. 1 GG) zwei Bundeswehrhochschulen (seit 1985: Universitäten der Bundeswehr) in Hamburg und München.[85]
56
Die Verwaltungszuständigkeiten von Bund und Ländern stehen grundsätzlich selbstständig nebeneinander.[86] Formen von „Mischverwaltung“, in der die unterschiedlich verfassten Beiträge von Bund und Ländern nicht mehr unterscheidbar sind, haben vor dem Grundgesetz keinen Bestand. Demokratische Legitimation, parlamentarische Kontrolle und nicht zuletzt der gerichtliche Rechtsschutz setzen voraus, dass Verwaltung und Gesetzesvollzug eindeutig entweder dem Bund oder den Ländern zugeordnet werden können. Gleichwohl bestand und besteht ein deutliches politisches Interesse von Bund und Ländern, auf bestimmten Verwaltungsfeldern zusammen zu arbeiten. Allen verfassungsrechtlichen Bedenken zum Trotz[87] ist daher auf dem Gebiet des Hochschulwesens im Jahr 1957 das Verwaltungsabkommen von Bund und Ländern über die Errichtung des Wissenschaftsrates[88] geschlossen worden. Vorrangige Aufgabe des Wissenschaftsrates ist es, „im Rahmen von Arbeitsprogrammen Empfehlungen zur inhaltlichen und strukturellen Entwicklung von Hochschulen, der Wissenschaft und Forschung zu erarbeiten, die den Erfordernissen des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens entsprechen“ (Art. 2 Abs. 1 S. 1 des Verwaltungsabkommens).
57
In Gestalt des 1969 in das Grundgesetz eingefügten Art. 91b GG existierte eine verfassungsrechtliche Grundlage für Bund-Länder-Vereinbarungen auf dem Gebiet der Förderung von Einrichtungen und Vorhaben der wissenschaftlichen Forschung von überregionaler Bedeutung. Auf diesem Kompetenztitel, dessen verfassungspolitische Validität allerdings gelegentlich in Zweifel gezogen wurde,[89] war es 1970 zur Errichtung der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung (BLK) gekommen, die 1975 zur Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung erweitert wurde.[90] Die BLK war das ständige Gesprächsforum für alle Bund und Länder gemeinsam berührenden Fragen des Bildungswesens und der Forschungsförderung. Dem BLK-Abkommen zur Seite gestellt war u.a. eine Rahmenvereinbarung zwischen Bund und Ländern über die gemeinsame Förderung der Forschung nach Art. 91b GG,[91] das den Hintergrund bildet für Ausführungsvereinbarungen zur Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Max-Planck-Gesellschaft, der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz, der Fraunhofer-Gesellschaft, der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft, der Deutschen Forschungszentren e.V. und des Akademienprogramms.[92] Nach der durch die Föderalismusreform 2006 herbeigeführten Neufassung des Art. 91b GG wurde die BLK von der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) abgelöst. Die GWK wurde am 14.6.2007 von den Regierungschefs von Bund und Ländern per Verwaltungsabkommen[93] gegründet. In der GWK haben die Vertreter der Länder je eine Stimme, während der Bund über 16 Stimmen verfügt. Grundsätzlich ist für die Beschlussfassung eine Mehrheit von 29 Stimmen nötig. Die Aufgabenstellung der GWK ist auf Art. 91b GG ausgerichtet. In einer Anlage zum GWK-Abkommen sind die Gegenstände der gemeinsamen Wissenschaftsförderung (DFG, Helmholtz-Gemeinschaft, Max-Planck-Gesellschaft etc.) aufgelistet und ihre jeweiligen Finanzierungsschlüssel fixiert.
58
Im Rahmen der Föderalismusreform entfiel die bisherige Gemeinschaftsaufgabe „Hochschulbau“ (Art. 91a Nr. 1 GG a.F.) mit der hälftigen Finanzierung von Bund und Land. Eine kompensatorische Übergangsregelung zu Gunsten der Länder enthält Art. 143c GG. Diese Regelung ist zum Ende des Jahres 2013 ausgelaufen. Die Gemeinschaftsaufgabe der „Förderung von Forschungsbauten an Hochschulen“ wurde aus dem bisherigen Standort in Art. 91a GG gestrichen und statt dessen mit der einschränkenden Maßgabe, dass es sich um Fälle „überregionaler Bedeutung“ handeln muss, in Art. 91b Nr. 3 GG eingefügt. Im Übrigen enthielt die neue Fassung des Art. 91b GG anders als die vorherige Regelung nicht mehr eine gemeinsame Bildungsplanung. Statt dessen besteht nun die Möglichkeit einer Zusammenarbeit zur Bildungsevaluation (Abs. 2). Neu war auch die Bestimmung des Art. 91b Abs. 3 GG, wonach die Frage, nach der Kostentragung einer solchen Zusammenarbeit nunmehr in der Vereinbarung selbst zu regeln ist.[94]
Abs. 1 des Art. 91b GG wurde durch verfassungsänderndes Gesetz vom 23.12.2014 erneut geändert.[95] Dort heißt es nun:
„Bund und Länder können auf Grund von Vereinbarungen in Fällen überregionaler Bedeutung bei der Förderung von Wissenschaft, Forschung und Lehre zusammenwirken. Vereinbarungen, die im Schwerpunkt Hochschulen betreffen, bedürfen der Zustimmung aller Länder. Dies gilt nicht für Vereinbarungen über Forschungsbauten einschließlich Großgeräten.“
Ermöglicht werden sollte damit ein stärkeres Engagement des Bundes bei der Finanzierung der staatlichen Hochschulen. Ob und wie die neue verfassungsrechtliche Grundlage fruchtbar gemacht wird, ist einstweilen noch nicht klar.[96]
1. Kapitel Grundfragen des institutionellen Hochschulrechts › I. Hochschulen im Verfassungsstaat › 5. Die Hochschulen in der europäischen Rechtsentwicklung