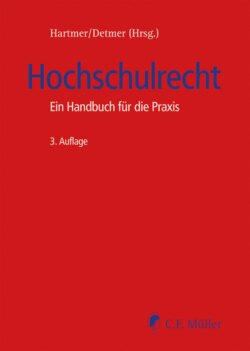Читать книгу Hochschulrecht - Группа авторов - Страница 91
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Status und Management der staatlichen Hochschulen als Körperschaften des öffentlichen Rechts (und zugleich Einrichtungen des Landes)
Оглавление42
Für die Universitäten (jedenfalls der alten Bundesrepublik Deutschland, auf die früheren DDR-Universitäten kann hier nicht eingegangen werden) sehr lang, für die anderen Hochschularten teilweise nur wenige Jahre oder Jahrzehnte, galt in Deutschland ein umfassender besonderer hochschulischer Rechtsstatus mit der „Doppelnatur“[3] als Körperschaft des öffentlichen Rechts und zugleich Einrichtung des Landes. Die Doppelnatur äußerte sich vor allem darin, dass die akademischen Angelegenheiten dem Selbstverwaltungsbereich der Hochschulen als rechtsfähigen Körperschaften zugerechnet worden sind, denen die staatlichen Angelegenheiten der Hochschulen als rechtlich unselbstständigen Landeseinrichtungen gegenüberstanden. Das Erste bezog sich vor allem auf die Erledigung der Primäraufgaben in Lehre und Studium (einschließlich der Erstellung von Prüfungs- und Studienordnungen) sowie der Forschung und den künstlerischen Aufgaben und schloss auch das Recht der eigenen untergesetzlichen Normgebung ein (Satzungen, beginnend mit der Grundordnung). Das Zweite bezog sich vor allem auf die Haushalts- (bzw. Wirtschafts-), Personal- und Liegenschaftsangelegenheiten. Dabei gab es zwei wesentliche hochschulrechtliche Besonderheiten: den Topos der Einheitsverwaltung[4] und den Mischbereich des Zusammenwirkens[5] (Kondominiums) zwischen Staat (Ministerium) und Hochschule (Leitung, Gremien und Verwaltung). Dieses System ist heute auch bei den Hochschulen in Bewegung, die den „Doppelstatus“ dem Grundsatz nach behalten haben.
43
Einheitsverwaltung bedeutete in diesem Zusammenhang zunächst, dass es innerhalb der Hochschule nicht zwei Verwaltungsstränge, getrennt nach staatlichen und akademischen Angelegenheiten, geben sollte, sondern dass diese Angelegenheiten inhaltlich und organisatorisch miteinander zu verbinden waren. Besonderen Ausdruck hat dies in zwei verschiedenen Leitungsmodellen des deutschen Hochschulrechts gefunden, der monokratischen Präsidialverfassung mit einem direktoralen Leiter (meist[6] mit der Amtsbezeichnung Präsident) und der kollegialen Rektoratsverfassung mit einem mehrköpfigen Vorstand („Rektorat“, meist mit den Amtsbezeichnungen der einzelnen Mitglieder als Rektor, Prorektoren, Kanzler[7]) bei vorgesehener Arbeitsteilung mit gemeinsamen Zielen und Kooperationspflichten. Hinzu kam das hochschulspezifische und nach den Regeln der Gruppenhochschule[8] hochschulrechtlich verankerte Zusammenspiel zwischen akademischer Selbstverwaltung (vor allem durch Gremien) und der allgemeinen – regelmäßig dem Kanzler unterstellten – Hochschulverwaltung. Wenn man von Hochschulverwaltung spricht, muss man diese beiden Teile der Hochschulselbstverwaltung einerseits und der administrativen Hochschulverwaltung anderseits zwar gemeinsam in den Blick nehmen, dabei aber die unterschiedlichen Aufgaben, Zuständigkeiten und Verfahren dieser beiden Teilbereiche bedenken und prüfen. Die Hochschulselbstverwaltung war dabei geprägt durch ihren korporativen Status im Gefüge der Gruppenhochschule mit gewissen – auch hochschulpolitischen – Interessenbindungen, die administrative Hochschulverwaltung hatte ihrerseits eine professionelle Doppelaufgabe als Dienstleistungsbetrieb und Behörde (was z.B. bei den Personalangelegenheiten deutlich wird).[9]
44
Das Zusammenwirken bzw. Kondominium zwischen Hochschule und Staat (Ministerium) resultierte aus der darüber hinausgehenden Einsicht, dass es lebensfremd und nicht hochschulgerecht sei, akademische und staatliche Angelegenheiten völlig voneinander zu trennen. So ist die Berufung und Einstellung eines Professors nicht nur eine Personalangelegenheit, mit welcher der Staat weitreichende (und kostenträchtige) Pflichten eingeht und Rechte (z.B. durch das Beamtenverhältnis) begründet, sondern auch und wesentlich ein bedeutsamer Bestandteil der personellen Selbstergänzung und Gestaltung des akademischen Profils einer Hochschule. Haushalts- und Liegenschaftsangelegenheiten sind ebenfalls unlöslich mit der Aufgabenerfüllung einer Hochschule verbunden, vor allem dann, wenn man dabei den Dienstleistungscharakter der damit verbundenen Maßnahmen betont. Dies verlangte gemeinsame Verfahren zwischen dem Träger der Hochschulen (Land, vertreten vor allem durch das jeweilige Wissenschaftsministerium) und den Hochschulen selber (vertreten durch ihre Organe, Funktionsträger und Mitglieder) mit gemeinsamer Verantwortung.
45
Das damit verbundene, entstandene und in kontinuierlicher Entwicklung sich befindende hochschulrechtliche System ist kompliziert, kann schwerfällig gehandhabt werden[10] und ist nicht einfach zu verstehen, für das außenstehende Publikum sowieso nicht, aber häufig auch nicht für die „Insider“ in den Hochschulen, der Politik und den Verwaltungen.[11] Es sinnvoll zu praktizieren, verlangt Sachverstand, Arbeitsteilung und Einsicht in die Zusammenhänge und Details sowie ein gemeinsames Grundverständnis der Handelnden. Das System war und ist auch nicht konfliktfrei, wobei Konfliktpotentiale zwischen Hochschule und Staat einerseits und solche innerhalb der Hochschulen anderseits bestehen. Zum erstgenannten Bereich beanstandeten die Hochschulen über einen langen Zeitraum Autonomiedefizite in den Materien der staatlichen Angelegenheiten und reklamierten eine Stärkung der körperschaftlichen Anteile und Rechte innerhalb des Doppelstatus.[12] Sie wollten stärker und unmittelbarer ihre Angelegenheiten in Bezug auf Personal, Wirtschaft und Haushalt sowie Liegenschaften und Einrichtungen selber regeln und verantworten. Als „nachgeordnete Dienststellen“ unterhalb der Ministerialverwaltung wollten die Hochschulen und ihre Verwaltungen sich nicht eingeordnet sehen, wobei diese Begrifflichkeit durchaus auftauchte und auch gelegentlich in den Köpfen der Beteiligten verankert war.
46
Diese Autonomiebestrebungen in Bezug auf die sog. staatlichen Angelegenheiten zeitigten in den vergangenen etwa drei Jahrzehnten erkennbare Erfolge. Die Länderhochschulgesetze und darauf beruhend die Verwaltungspraxis führten zu deutlichen Veränderungen im Sinne von Kompetenzverlagerungen und zunehmenden Delegationen (vom Ministerium an die Hochschulen, aber auch weiterführend innerhalb der Hochschulen) sowie zu einer gewissen[13] Deregulierung. Sie standen auch unter der Forderung einer Reform der Steuerungsinstrumente und der Verwaltung schlechthin (Paradigmenwechsel von öffentlicher Verwaltung zum New Public Management).[14] Im Haushaltsbereich hat man – in den Ländern unterschiedlich – erhebliche Flexibilisierungen des – an sich meist immer noch zu beachtenden – öffentlichen Haushaltsrechts zugelassen, die zu globalisierten Haushalten oder sogar echten Globalhaushalten[15] geführt haben. Diese Budgetierungsansätze können innerhalb der Hochschule weitergegeben werden (z.B. auf Fachbereiche und Institute). Im Personalbereich sind inzwischen die meisten Entscheidungen – sogar einschließlich der Berufung von Professoren[16] – auf die Hochschulen sowie ihre Organe und Verwaltungen delegiert.
47
Den aus der Sicht der Hochschulen gewollten und deutlich positiven Verlagerungen des Doppelstatus mit Stärkung der körperschaftlichen Seite (Autonomiezuwachs) bei den staatlichen Angelegenheiten stehen aber einige nicht unbedenkliche Motive und Entwicklungen gegenüber.
Erstens geschah der lange geforderte Autonomiezuwachs im Personal-, Haushalts- und Wirtschaftsbereich erst, als die Finanzprobleme immer stärker wurden. Wohltaten verteilt der Staat gern selber, restriktivere Entscheidungen werden lieber verlagert; die „Gießkanne“ kommt von oben, der „Rasenmäher“ wird unten angesetzt. Damit müssen die Hochschulen aber „leben“; wer Verantwortung will, muss sie auch ausüben wollen und können, wenn es unangenehm wird. Insofern ist dieser Nachteil systemimmanent und sollte nur beklagt werden, um bessere Bedingungen im Einzelfall zu erreichen.
Zweitens – und dies ist gravierender – steht dem Autonomiezuwachs in den staatlichen Angelegenheiten die Tendenz gegenüber, auch die Karten in Bezug auf die akademischen Angelegenheiten und deren Planung neu zu mischen. Autonomieverluste in diesem Bereich hatten in nicht unerheblichem Maße stattgefunden, insbesondere im Zusammenhang mit dem Bologna-Prozess und seinen Akkreditierungsverfahren. Nach dem herkömmlichen hochschulrechtlichen Modell bestand hier im Wesentlichen nur Rechtsaufsicht, die sich weder auf die Zweckmäßigkeit der Übernahme einer Aufgabe noch deren Durchführung erstreckte.[17] Die neuen Steuerungsinstrumente, vor allem der Zielvereinbarungen, der Evaluation und Qualitätssicherung, der leistungsbezogenen Mittelverteilung[18] und der Akkreditierung von Studiengängen, sehen diese Trennschärfe nicht vor, weil sie nicht unter die herkömmliche Systematik der Aufsichtsinstrumente subsumiert werden (zum Hochschulrat als mitwirkungs- und entscheidungsbefugter Institution sogleich in Rn. 49). Es kommt hier stark auf die Praxis und das Verständnis der handelnden Personen an und rechtliche Konflikte sind nicht ausgeschlossen.[19] Eine verkappte – und sogar hochschulferne – Fachaufsicht kann auf leisen Sohlen mit diesen „Steuerungen“ die Rechtsaufsicht überlagern und Freiräume aushöhlen.
Drittens kann es Beharrungsvermögen der staatlichen Instanzen und Personen sowie deutliche Gegenläufigkeiten im Zuge der Kompetenzverlagerungen bei den staatlichen Angelegenheiten geben; so kann insbesondere die Bau- und Liegenschaftsverwaltung staatlichen Zentralisierungsbestrebungen unterworfen sein und in Bezug auf die Hochschulen eine andere Entwicklung nehmen als die damit eng verbundene Haushalts- und Wirtschaftsverwaltung.[20]
Viertens werden hinsichtlich des alten hochschulinternen Systems der Einheitsverwaltung im Zusammenspiel von Selbstverwaltung und Administration Nachteile und Vorteile nicht immer hinreichend gewürdigt. Sicher waren in einigen Landesgesetzen und der Praxis den einzelnen Hochschulgremien (vom Senat und den Fachbereichsräten bis hin zu Kommissionen und Ausschüssen) Angelegenheiten zugewiesen (z.B. der Haushaltsverteilung), die solche Organe und Gremien nicht effizient erfüllen konnten. Gelegentlich handelte es sich um ein System „organisierter Unverantwortlichkeit“, welches den Hang zur ungeprüften „Selbstbedienung“ oder einer unangemessenen „Besitzstandswahrung“ fördern konnte. Dies machte die Stärkung hauptamtlicher Organe und Funktionsträger (z.B. Rektorate und Verwaltung) zu Lasten der Selbstverwaltungsgremien erforderlich, was durch landesgesetzliche Regelungen auch berücksichtigt worden ist.[21] Anderseits besteht an sensiblen Einrichtungen, wie sie Hochschulen darstellen, die Notwendigkeit, Professionalität und Arbeitsteilung zu verbinden mit Akzeptanz, Kollegialität und Kontinuität. Hochschulpolitische Ansätze, die teilweise auf hochschulfremden und ausländischen Managementmodellen basieren, tragen dem nicht immer hinreichend Rechnung.
48
Die bisher skizzierten Entwicklungen sind insoweit systemimmanent, als sie das innere Gefüge des Doppelstatus zwar verschieben, diesen Status aber als solchen erhalten. Die Hochschulen sind insoweit Körperschaften des öffentlichen Rechts und zugleich Einrichtungen des Landes geblieben. Insbesondere handelt es sich trotz der zugenommenen hochschulischen Entscheidungsbefugnisse in den staatlichen Angelegenheiten (v.a. Haushalt und Personal) weiterhin um Landesverwaltung, und alle (hauptamtlichen) Hochschulbeschäftigten sind Landesbedienstete (Beamte, Angestellte und Arbeiter im Landesdienst).
49
Auch die – in den Ländern unterschiedlich eingeführten[22] – Hochschulräte oder Kuratorien mit Entscheidungsbefugnissen, die sich als dritte Verwaltungs- und Leitungsebene mit Aufgaben der Planung, Steuerung und Aufsicht zwischen Staat (Ministerium) und Hochschule (Hochschulleitung) etabliert haben,[23] vermögen den Doppelstatus und sein bisheriges Zuständigkeitsgefüge zwar – auch mit erheblichen praktischen Folgen – zu verändern, lösen ihn aber nicht automatisch auf. Insbesondere bei reinen Körperschaftsmodellen (dazu sogleich in Rn. 50) können sie allerdings als Äquivalent zur geringer werdenden staatlichen Einflussnahme gesehen und implementiert werden. Dann gehören sie zur Körperschaft, nehmen aber in ihr Aufsichts- und Steuerungsfunktionen wahr, bei (teilweiser) externer und u.U. wissenschaftsferner Besetzung entsprechend den jeweils durch Landesgesetz festgelegten Kompetenzen und Entscheidungsbefugnissen.
50
Der nächste – inzwischen auch in einem Bundesland (NRW) vollzogene – Schritt ist die Etablierung der Hochschulen als reine (landesunmittelbare) Körperschaften des öffentlichen Rechts mit Personalhoheit und Dienstherreneigenschaft sowie Finanzautonomie, wie es in NRW mit dem Hochschulfreiheitsgesetz[24] für die Universitäten und Fachhochschulen 2006 geschehen ist. Damit wird die „Doppelnatur“ verlassen und die Hochschulen sind ausschließlich rechtsfähige Körperschaften, die allerdings immer noch den Staat als Träger und Finanzgeber (im Form von Zuschüssen) vorfinden und vorfinden müssen (vgl. § 2 Abs. 1 S. 1 und § 5 Abs. 2 S. 1 HG NRW). Daher ist der Abschied von der „Einrichtung des Landes“ zwar in einem solchen Fall rechtlich vollzogen, kann aber in der Praxis nicht vollkommen verwirklicht werden, weil sich der Zuschussgeber Planungs- und Kontrollfunktionen natur- und pflichtgemäß vorbehält („Wer zahlt, schafft an“), abgesehen von der Rechtsaufsicht, die ohnehin beim Staat bleibt. Der Staat und seine Instanzen haben in einem solchen Fall zwar zunächst diese Rechtsaufsichtsfunktionen (allgemeine Körperschaftsaufsicht) und die Kontrollmöglichkeiten im Rahmen des noch verbliebenen Teils des Haushaltsrechts (bis hin zu den Zuständigkeiten der Landesrechnungshöfe).[25] In den Landeshochschulgesetzen lassen sich darüber hinaus dennoch ein Teil der Vorgaben des HRG in seiner letzten Fassung modifiziert verankern, was auch geschehen wird (und in NRW geschehen ist). Das gilt besonders für die bereits in Rn. 47 erwähnten neuen Steuerungsinstrumente und die dementsprechenden Instanzen außerhalb und innerhalb der Hochschulen (Hochschulentwicklungsplanung, Evaluation und Qualitätssicherung, Zielvereinbarungen, leistungsbezogene Mittelverteilung, Akkreditierung, Hochschulräte, vgl. §§ 5 bis 8 und 21 HG NRW). Diese Instrumentarien und Instanzen überleben die Doppelnatur nicht nur, sondern werden tendenziell als „Preis“ der gewonnenen Freiheit bedeutsamer und stärker. Denn „ganz“ will man die Hochschulen nun doch nicht in die Freiheit entlassen.[26] Außerdem gelten weiterhin grundsätzlich allgemeine Vorschriften, z.B. für den öffentlichen Dienst (insbesondere das Beamtenrecht[27]), auch wenn es sich nicht mehr um Landesbeamte handelt, sondern um solche der Körperschaft.
51
Weitere Sonderformen, wie die der Hochschulen in kommunaler Trägerschaft,[28] können an dieser Stelle mangels erheblicher praktischer Bedeutung vernachlässigt werden.
3. Kapitel Typisierung von Hochschulen: Pädagogische Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, kirchliche Hochschulen, private Hochschulen › III. Statusfragen, Hochschulorganisation und Hochschulmanagement › 3. Status und Management der staatlichen Hochschulen in anderer Rechtsform