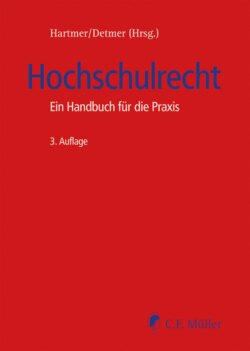Читать книгу Hochschulrecht - Группа авторов - Страница 110
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Das HRG von 1985
Оглавление13
Im Zuge der umfassenden Änderung des Hochschulrahmengesetzes vom 14.11.1985 wurde auch § 42 HRG neu gefasst. An die Stelle des Hochschulassistenten traten der wissenschaftliche Assistent, der Oberassistent sowie der Oberingenieur. Ergänzt wurde die Regelung um eine Option für die Landesgesetzgeber, an wissenschaftlichen Hochschulen und an Kunsthochschulen die Ämter für Hochschuldozenten einzurichten.
14
Der hier interessierende § 43 HRG wurde nur marginal geändert. Ergänzt wurde § 43 Abs. 1 HRG um die Aussage, dass nach näherer Bestimmung des Landesrechts die Wahrnehmung von Aufgaben in Einrichtungen der Wissenschaftsförderung, die überwiegend aus staatlichen Mitteln finanziert werden, auf Antrag des Professors zur dienstlichen Aufgabe erklärt werden kann, wenn dies mit der Erfüllung seiner übrigen Aufgaben vereinbar ist. Praktisch bedeutsamer für den einzelnen Hochschullehrer war die Ergänzung des § 43 Abs. 3 HRG um den folgenden S. 3:
„Das Landesrecht kann vorsehen, dass ein Professor auf begrenzte Zeit ausschließlich oder überwiegend Aufgaben der Forschung in seinem Fach wahrnimmt oder für Vorhaben nach § 26 von anderen Aufgaben teilweise freigestellt wird.“
15
Um Konkretisierungen ergänzt und redaktionell neu geordnet wurde § 44 HRG (Einstellungsvoraussetzungen für Professoren). Dabei wurden freilich auch neue hochschulpolitische Schwerpunkte gesetzt. So hieß es nun in § 44 Abs. 2 S. 1 HRG, dass die zusätzlichen wissenschaftlichen Leistungen nach Abs. 1 Nr. 4a „in der Regel“ durch eine Habilitation nachgewiesen wären. Alternativ hierzu besagte § 44 Abs. 2 S. 2 HRG, dass in Fächern, in denen eine Habilitation nicht üblich ist, bei Berufungen aus dem Ausland oder in Ausnahmefällen der Nachweis durch gleichwertige wissenschaftliche Leistungen erfolge, die auch in einer Tätigkeit außerhalb des Hochschulbereichs erbracht sein könnten.
16
Mit dieser Konkretisierung wurde die Bedeutung der Habilitation im Rahmen der Einstellungsvoraussetzungen für Universitätsprofessoren gestärkt.[8] Darüber hinaus regelte der Gesetzgeber nun positiv, dass es – vornehmlich in den Ingenieurwissenschaften – Fächerkulturen gibt, in denen eine Habilitation traditionell nicht üblich ist. Damit wurde der Weg an der Habilitation vorbei jedoch im Gegensatz zu § 44 HRG 1976 gleichzeitig auf bestimmte Tatbestände und bestimmte Fächer im Sinne eines Regel-/Ausnahmeverhältnisses beschränkt.
17
Ergänzt wurde § 44 HRG um einen neuen Abs. 3, der wie folgt lautete:
„Auf eine Stelle, deren Funktionsbeschreibung die Wahrnehmung erziehungswissenschaftlicher oder fachdidaktischer Aufgaben in der Lehrerbildung vorsieht, soll nur berufen werden, wer eine dreijährige Schulpraxis nachweist. Professoren an Fachhochschulen und für Fachhochschulstudiengänge an anderen Hochschulen müssen die Einstellungsvoraussetzungen nach Abs. 1 Nr. 4b erfüllen; in besonders begründeten Ausnahmefällen können solche Professoren berufen werden, wenn sie die Einstellungsvoraussetzungen nach Abs. 1 Nr. 4a erfüllen.“
18
Neben dem Hinweis in S. 1 „auf Professuren mit Aufgaben in der Lehrerbildung“ war von besonderer Bedeutung, dass in den Einstellungsvoraussetzungen nun – im Gegensatz zum HRG 1976 – auf die unterschiedlichen Profile der Hochschultypen explizit Bezug genommen wurde. Erstmals schrieb das HRG 1985 implizit fest, dass Universitätsprofessoren zusätzliche wissenschaftliche Leistungen (jenseits der Promotion) erbracht haben mussten, während Professoren, die in Fachhochschulstudiengängen eingesetzt werden sollten, den berufspraktischen Qualifikationsweg – zumindest regelmäßig – zu durchlaufen haben.
19
Damit wurde – insbesondere im Zusammenhang mit § 44 Abs. 2 S. 2 HRG 1985 – zum Ausdruck gebracht, dass auch in den Fächern, in denen eine Habilitation traditionell nicht üblich war, die zu rekrutierenden Universitätsprofessoren nicht aufgrund einer berufspraktischen Qualifikation, sondern aufgrund ihrer zusätzlichen wissenschaftlichen Leistungen eingestellt werden sollten. Nur sollte in diesen Fällen der Nachweis der gleichwertigen wissenschaftlichen Leistungen auch durch eine Tätigkeit außerhalb des Hochschulbereichs erbracht sein können. Grob skizziert kann festgehalten werden, dass die Änderung von 1985 somit keineswegs lediglich redaktioneller Natur war, sondern eine hochschulpolitische, wegen der geforderten Homogenität der Professorengruppe aber auch hochschulrechtliche Zielsetzung verfolgte. Der Streit, von welchen Professoren der berufspraktische Qualifikationsweg zu beschreiten sei, der naturgemäß mit dem Streit über das Wesen der beiden Hochschultypen Fachhochschule und Universität zusammenhing, wurde – durchaus zugunsten der Universitäten – durch den Gesetzgeber 1985 bereinigt. Die Frage, welcher Professor über eine Qualifikation im Sinne der Ziffer „4a“ und welcher über eine Qualifikation im Sinne der Ziffer „4b“ verfügte, wurde Anknüpfungspunkt bedeutender Rechtsfragen, so beispielsweise, wer berechtigt sei, als Prüfer an Promotionsverfahren teilzunehmen.[9]
20
Zementiert wurden die bestehenden Unterschiedlichkeiten zwischen Universitäten einerseits und Fachhochschulen andererseits des Weiteren durch eine kleine, aber bedeutsame Änderung des § 45 HRG. Diese Vorschrift wurde insoweit modifiziert, als eine Regelung (§ 45 Abs. 2 S. 3 HRG) aufgenommen wurde, wonach bei der Berufung von Professoren an Fachhochschulen und von Professoren für Fachhochschulstudiengänge an anderen Hochschulen in ein zweites Professorenamt das sog. Hausberufungsverbot[10] keine Geltung beansprucht. Damit wurde den Fachhochschulen gleichermaßen ermöglicht und attestiert, dass die Besetzungen der an Fachhochschulen ausgewiesenen Professuren der Besoldungsgruppe C 3 letztlich beförderungsähnlich verlaufen (können). § 46 HRG wurde durch das Änderungsgesetz vom 14.11.1985 nicht berührt.
4. Kapitel Das Recht der (Universitäts-)Professoren › I. Entwicklung des Dienstrechts der (Universitäts-)Professoren › 4. Das HRG von 1998