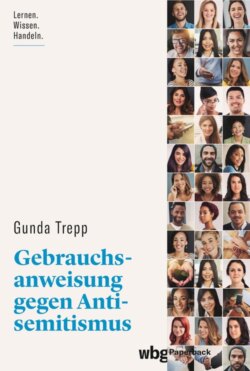Читать книгу Gebrauchsanweisung gegen Antisemitismus - Gunda Trepp - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Halbherzige Reaktionen
ОглавлениеManchmal hat man den Eindruck, dass, wenn es um Antisemitismus geht, sich die Juden am besten heraushalten sollten. Sie erfahren ihn zwar. Aber was besagt das schon? So schien 2015 selbst das deutsche Innenministerium noch zu denken, als es in die neue Expertenkommission zum Thema keinen einzigen Juden berief. Das ist so, als spräche man über den Missbrauch in der katholischen Kirche, ohne Missbrauchsopfer zu hören. Darüber hinaus, so kritisierte der damalige Antisemitismusbeauftrage des American Jewish Committee (AJC), seien viele der Handlungsanleitungen, die von der vorherigen Kommission 2011 erarbeitet worden waren, noch gar nicht umgesetzt. Warum man auf die jüdische Perspektive auf das Problem verzichtet habe, erklärte eine Sprecherin des Ministeriums so: Bei der Zusammensetzung des Expertenkreises habe man allein auf fachliche Erwägungen gesetzt, »die Frage der Religionszugehörigkeit einzelner Expertinnen und Experten war kein fachliches Kriterium.«
Nicht nur diskreditiert eine solche Aussage die Qualifikation jüdischer Antisemitismusexperten in Deutschland, sie trägt zudem das Bild nach außen, dass Juden nicht wirklich mit wissenschaftlichem Blick und fachbezogen über den Hass gegen sie nachdenken können. Mit dieser Haltung würde man auch denjenigen Afroamerikanern, die gerade die Rassismusdebatte in den Vereinigten Staaten dominieren, nicht zuhören müssen. Offensichtlich ist das absurd. Davon abgesehen, dass es in der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland weltweit renommierte Forscher zur Judenfeindlichkeit gibt, sind auch andere Juden im Laufe der Jahre durch eigene Betroffenheit und die dadurch angeregte intensive Beschäftigung mit dem Thema zu Experten geworden. Als Reaktion auf die massive Kritik berief das Ministerium einige Monate später auch zwei Juden in das Gremium.
Wenn selbst staatliche Institutionen keinen sicheren Blick mehr zu haben scheinen, wird es schwierig. Das gilt nicht nur für die Exekutive, sondern auch für Gerichte, die mit Urteilen nicht nur strafen, sondern daneben Zeichen setzen, wie mit bestimmten Haltungen und Handlungen umzugehen und was im wahrsten Sinne des Wortes zu verurteilen ist. Eines der prominentesten und unter Juden berüchtigtsten Beispiele war der Brandanschlag auf das Wuppertaler Gotteshaus der jüdischen Gemeinde. Synagogen und andere Gebäude jüdischer Gemeinden sind nirgends in Deutschland vor Übergriffen sicher. Die meisten von ihnen werden von der Polizei bewacht. Manche rund um die Uhr, andere zumindest an bestimmten Tagen oder zu bestimmten Tageszeiten. Dennoch gelingt es Tätern immer wieder, Wände oder Außenanlagen zu beschmieren oder die Gebäude auf andere Art zu beschädigen. Die Aufklärungsrate ist gering. Von den 21 Attacken im Jahr 2018 konnte die Polizei in nur fünf Fällen die Täter fassen. Immerhin sollte sich hier aber der antisemitische Beweggrund leicht nachweisen lassen.
Nicht so für das Amtsgericht Wuppertal. Nachdem drei junge Erwachsene palästinensischer Herkunft 2014 einen Brandsatz auf die Synagoge in Wuppertal geworfen hatten, verurteilten die Richter die Männer zwar wegen schwerer Brandstiftung zu Bewährungsstrafen. Sie erkannten aber kein antisemitisches Motiv. Dazu hieß es in der Urteilsbegründung:
»Das Gericht hat auch das Motiv der Angeklagten hinterfragt. Für die Angaben der Angeklagten F und B, dass sie durch ihre Tat die Aufmerksamkeit auf den israelisch-palästinensischen Konflikt zur Tatzeit lenken wollten, spricht zunächst die Tatsache, dass alle drei Angeklagte aus Palästina stammen und nicht wiederlegbar [sic!] zum Zeitpunkt der Tat aufgrund des andauernden Konflikts keinen Kontakt mehr zu ihren Angehörigen in Palästina hatten. Zudem zeigen auch Aufnahmen aus dem Facebook-Profil des Angeklagten F, dass dieser für einen palästinensischen Staat eintritt. Als Motiv der Tat kam allerdings auch Antisemitismus in Betracht. Dafür sprach der Umstand, dass die Angeklagten als Palästinenser und Angehörige muslimischen Glaubens eine jüdische Synagoge mit Brandsätzen beworfen haben. Diese zugegebenermaßen schwerwiegenden Indizien ließen für das Gericht allein jedoch nicht den hinreichend sicheren Schluss zu, dass die Tat in jedem Falle antisemitisch motiviert war. Denn das Ergebnis der Ermittlungen ergab ansonsten keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die Angeklagten antisemitisch eingestellt sind. Die Polizei hat die Wohnungen der Angeklagten durchsucht und Zeugen aus ihrem Umfeld befragt. Es ergaben sich daraus keine Umstände, die den Rückschluss zulassen könnten, dass die Angeklagten eine grundsätzlich judenfeindliche Einstellung haben.«
Soweit ein Teil des Urteils.
Dass die Täter in einer Wohnung »in arbeitsteiligem Zusammenwirken Brandsätze herstellten, sogenannte ›Molotowcocktails‹«, wie es in dem Urteil heißt, um sich dann »zu der in der Nähe fußläufig gelegenen Synagoge der jüdischen Gemeinde« zu begeben, mit der »Vorstellung, mit den Brandsätzen gegebenenfalls die Synagoge in Brand zu setzen«, wie es weiter heißt, all das reichte den Wuppertaler Amtsrichtern nicht, um eine antisemitische Einstellung festzustellen. Und was haben deutsche Juden überhaupt mit dem Nahostkonflikt zu tun? Liegt da nicht Judenfeindlichkeit näher? Nein, sagt das Gericht, immerhin haben die Angeklagten beteuert, nichts gegen Juden zu haben. Und schreibt weiter in dem Urteil: »Sicherlich ist dabei klarzustellen, dass die in Deutschland lebende jüdische Bevölkerung, insbesondere die jüdische Gemeinde in X [Was meinen die Richter? Die anderen vielleicht doch ein bisschen?], nichts mit der Politik der israelischen Regierung und ihrer Auseinandersetzung mit den im Gaza-Streifen lebenden Palästinensern zu tun hat. Andererseits ist aber bei Würdigung aller Umstände und der Persönlichkeit der Angeklagten auch zu berücksichtigen, dass es keineswegs fernliegend ist, dass sie gerade diesen Schluss nicht gezogen haben, sondern – auch mangels eines anderen dem Staat Israel in der Tatnacht eindeutig zuzuordnenden Tatobjekts – eine Synagoge als Zeichen jüdischen Lebens zum Tatobjekt gewählt haben, um daran ihr Anliegen, Aufmerksamkeit auf den zwischen Israel und den Palästinensern lodernden Konflikt zu lenken, deutlich zu machen.« Als Juristin kann ich mir nicht helfen zu denken: »Echt jetzt?«
Das Landgericht Wuppertal erhöhte die Bewährungsstrafen zwar von jeweils einem Jahr und drei Monaten auf Freiheitsstrafen von zwei Jahren beziehungsweise einem Jahr und elf Monaten. Bei der Einschätzung, ob man Antisemitismus als Motivation strafverschärfend werten könne, war die Kammer aber an die Einschätzungen der Vorinstanz gebunden. Hierzu hieß es im Urteil: »Demgegenüber war strafschärfend zu berücksichtigen, dass die Angeklagten durch die Tat eine Vielzahl von Personen, namentlich die Angehörigen der jüdischen Gemeinde, in Angst und Schrecken versetzt haben, wenn auch – an die insoweit von dem Amtsgericht getroffenen Feststellungen ist die Kammer gebunden – die Tat selbst nicht antisemitisch motiviert war. Zu ihren Lasten ging auch, dass sie bei der zwar dilettantisch ausgeführten Tat eine nicht unerhebliche kriminelle Energie (arbeitsteiliges Zusammenwirken, gemeinsames Vorbereiten und Herstellen verschiedener als Brandsatz dienender Molotowcocktails, Werfen von gleich fünf dieser Brandsätze) an den Tag legten.« Doch weil es auch strafmindernde Umstände gegeben habe, bleibe man bei der Aussetzung der Vollstreckung auf Bewährung, so das Gericht. Diese Entscheidung, gegen die einer der Angeklagten Revision einlegte, wurde abschließend vom Oberlandesgericht Düsseldorf bestätigt und damit rechtskräftig.18
Auch Anklagebehörden scheint Antisemitismus in seinen verschiedenen Ausprägungen nicht geläufig zu sein. So wies die Staatsanwaltschaft Braunschweig bereits mehrere Strafanzeigen ab, zum Beispiel eine gegen die Partei »Die Rechte«, die in der Zeit von 19.33 bis 19 . 45 Uhr mit einer Mahnwache unweit der Synagoge den »Zionismus stoppen« wollte.19 Einen Symbolismus und/oder Hinweis auf die Nazizeit wollten die Juristen darin partout nicht sehen.