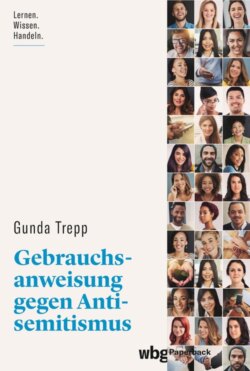Читать книгу Gebrauchsanweisung gegen Antisemitismus - Gunda Trepp - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Fakten anerkennen
ОглавлениеDie Anzahl antisemitischer Straftaten in Deutschland ist in den letzten Jahren gestiegen. Über die letzten zehn Jahre hinweg haben Studien, die von verschiedenen Organisationen oder Regierungsstellen in Auftrag gegeben oder als Forschungsprojekte an Universitäten durchgeführt worden sind, immer wieder bestätigt, dass zahlreiche Bürger Juden gegenüber Animositäten haben. Die neueste von ihnen, vom World Jewish Congress (WJC – der Jüdische Weltkongress) im Sommer 2019 in Auftrag gegeben, legt folgende Zahlen vor: Insgesamt stimmten 27 Prozent der Befragten judenfeindlichen Äußerungen zu. So meint mehr als ein Fünftel, dass Juden wegen ihres Verhaltens gehasst würden. Und 41 Prozent denken, dass die Juden zu viel über den Holocaust sprechen; dieselbe Anzahl geht davon aus, dass sie dem Land Israel gegenüber loyaler sind als Deutschland.2 Und mehr als 20 Prozent der 1000 Interviewten stimmten jeweils den Aussagen zu, dass die Juden zu viel Macht in Wirtschaft, Medien sowie auf den internationalen Finanzmärkten hätten.3 Studien wie die Leipziger Autoritarismusstudien, die auch das stillschweigende Einverständnis der Befragten zu bestimmten Vorfällen oder Aussagen miteinbeziehen, kommen zu teils wesentlich höheren Werten.4 Diese eher unauffällige Judenfeindlichkeit könne zwar durch fehlende eindeutige Festlegung an soziale Normen angepasst, aber jederzeit aktiviert werden, schreiben die Forscher.5
Die Reaktionen auf Studien wie diese könnten unterschiedlicher nicht sein. Nirgends klaffen Lebenswelten von Juden und Nichtjuden deutlicher auseinander als in der Wahrnehmung des Antisemitismus. Unterhält man sich mit Nichtjuden in Deutschland oder liest Kommentare zu Berichten, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, bekommt man immer wieder den Eindruck, wir beschäftigten uns mit einem Phantom-Problem.
Kaum waren die vorläufigen Ergebnisse der WJC-Studie veröffentlicht, fanden sich in Leserkommentaren aller seriösen Zeitungen Proteste. In zahlreichen Schreiben bezweifelten Leser die Zahlen oder nahmen an, dass sie nur so hoch sein könnten, weil man Vorgänge fälschlich als antisemitisch betrachtet und somit in eine Kategorie eingeordnet habe, in die sie nicht gehörten. Unter Kommentaren zu Berichten, in denen es um eine steigende Anzahl von antisemitischen Vorfällen oder die zunehmende Brutalität des Judenhasses geht, fanden sich im Laufe der Jahre immer wieder Aussagen mit folgendem Tenor: »Ich weiß nicht, wie Sie auf diese Zahlen kommen. In meinem privaten Leben bin ich noch keinem einzigen Antisemiten begegnet.« Glück gehabt, möchte man antworten. Nachdem diese Einschätzung allerdings relativ häufig vorzukommen scheint, fragt man sich irgendwann: Wo stecken sie dann – die Antisemiten? Vielen Bundesbürgern fällt es schwer, Antisemitismus überhaupt zu erkennen. Und selbst, wenn Menschen bereit sind zu akzeptieren, dass es Judenfeindlichkeit in der Gesellschaft gibt, und selbst wenn sie deren Ausmaß sehen – wahrgenommen wird sie meist bei anderen. Das mag verständlich sein: Naturgemäß behauptet kaum jemand von sich selbst, antisemitisch zu denken. Doch wenn auch Freunde, Bekannte, Mitglieder der eigenen Partei oder derselben ideologischen Ausrichtung grundsätzlich nicht in diese Kategorie fallen, man also den Antisemitismus sieht, aber keine Antisemiten, klingt es entweder nach Verdrängung oder nach einer mangelnden Beschäftigung mit dem Phänomen. Natürlicherweise erkennen Angehörige einer Minderheit das feindselige Verhalten von Teilen der Mehrheit im Umgang mit ihnen schneller und leichter, ganz einfach, weil sie unmittelbar betroffen sind. Doch sollte dann die Mehrheit die Erfahrungen dieser Gruppe nicht anerkennen und sich mit ihnen auseinandersetzen?
Wie will eine Demokratie einen Angriff abwehren, wenn sich die Demokraten nicht einmal einig darin sind, was sie bekämpfen? Denn nichts anderes als eine Bedrohung der Demokratie stellt der Antisemitismus dar. Zum einen war er über die Jahrhunderte stets ein Indikator dafür, dass etwas aus den Fugen gerät und gesellschaftliche Standards zu erodieren beginnen. Oder wie Deborah Lipstadt es ausdrückt: »Antisemitismus fängt mit den Juden an, doch er endet nie mit ihnen.« Genauso schwer aber wiegt, dass eine Demokratie, die keine Diversität mehr verträgt, eine Gesellschaft, in der Bürger nicht mehr anders als die Mehrheit sein können – mit anderem Glauben und anderen Gebräuchen –, dass eine solche Demokratie einen Teil der Bürger von der praktischen Ausübung der Volksherrschaft ausschließt. Diese Minderheit darf sich zwar noch in Wahlen äußern, wird aber oftmals konkret daran gehindert, ihre Rechte in der Gesellschaft wahrzunehmen. Das trifft für Juden in vielen Bereichen zu. Wenn sie keine Kippa mehr tragen, um sich zu schützen. Wenn sie ihre Gemeindezeitungen in Umschlägen geschickt bekommen. Wenn sie an der Universität verschweigen, dass sie Zionisten sind. Wenn sie lieber nicht in die Synagoge gehen, weil es an dem Tag keinen Polizeischutz gibt.
Antisemitismus ist ein Teil des jüdischen Alltags, wie alle wichtigen Studien der vergangenen Jahre zeigen. Sein Ausmaß lässt sich erahnen, wenn jüdische Bürger selbst in Bundesländern wie Baden-Württemberg, in denen sie sich nach eigenen Aussagen im Allgemeinen gut und sicher fühlen, den Hass gegen sie als Realität beschreiben, mit der sie eben leben.6
Anlässlich des jüdischen Gemeindetages in Berlin im Dezember 2019 sagte Bundespräsident Steinmeier: »Diese Republik ist nur vollkommen bei sich, wenn Juden hier vollkommen sicher sind.« Demnach kann man davon ausgehen, dass das Land nicht vollkommen bei sich ist. Denn Juden sind nicht sicher. Zumindest nicht so, wie es andere Bürger sind. In Deutschland müssen jüdische Einrichtungen geschützt werden. Ist das wirklich normal? Darf es normal sein? Soll es das sein? Diese Fragen muss sich die Mehrheitsgesellschaft stellen. Und sie muss ihren Blick schärfen, wenn es um Antisemitismus geht. Dringend!
Denn insgesamt bestätigen Antisemitismusforscher in verschiedenen Untersuchungen und Interviews bundesweit immer wieder ähnliche Zahlen wie die WJC-Studie.7 Antisemitismus ist in der Bundesrepublik ein gravierendes Problem. Und wir gehen in diesem Werk davon aus, dass man es nur wirksam bekämpfen kann, wenn man ihn als gesellschaftliches Phänomen ernst nimmt, auch wenn man meint, Feindseligkeit gegen Juden noch nie beobachtet zu haben. Hinter dieser Wahrnehmung steckt oft ohnehin lediglich eine frappierende Gleichgültigkeit.