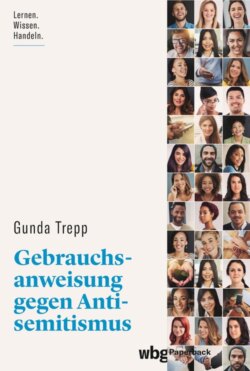Читать книгу Gebrauchsanweisung gegen Antisemitismus - Gunda Trepp - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das erste Pogrom in der Antike
ОглавлениеDoch schon in dieser Phase, also zum Ende des ersten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung, bemerken Historiker und Soziologen eine andere Haltung den Juden als den übrigen Gruppen gegenüber. Paula Fredriksen nennt es eine »bestimmte Nervosität« der jüdischen Gemeinschaft gegenüber, weil diese sich in keiner Weise und zu keiner Zeit freiwillig anzupassen bereit war.26 Mit der Zeit akzeptierten Völker wie die Römer diese Haltung immer weniger. »Nicht überraschend«, schreibt Robert Wistrich, habe es im Jahr 38 nach heutiger Zeitrechnung das erste dokumentierte Pogrom der Antike in Alexandria gegeben. Schon vorher seien Juden dort als Außenseiter dargestellt worden, ohne Respekt vor anderen Göttern oder Kulturen. Zudem ging dort das Gerücht um, dass sie einmal im Jahr einen Griechen entführten und ihn fett werden ließen, damit er anschließend von ihrem Gott im Heiligsten des Heiligen (gemeint ist der Ort, an dem sich die Lade mit der Tora befindet) verzehrt werden könne. Die Juden, die damals vierzig Prozent der Bevölkerung ausmachten, wurden zudem als unpatriotisch dargestellt; als Bewohner, die eine doppelte Loyalität zeigten.27
Es ist verblüffend, wie sehr die antike Wahrnehmung von Juden dem aktuellen antisemitischen Denken ähnelt. Und es belegt die Wichtigkeit und Richtigkeit des Hinweises mancher Wissenschaftler darauf, wie tief sich der Antisemitismus über Jahrtausende in das kollektive Bewusstsein eingegraben habe, und dass sich »die aktuellen Formen des Verbalantisemitismus nur über die Kenntnis der tradierten Konzeptualisierungstypen und der Sprachgebrauchsmuster von Judenfeindschaft als solche beschreiben und angemessen erklären lassen«, wie Monika Schwarz-Friesel und Jehuda Reinharz in Die Sprache der Judenfeindschaft im 21. Jahrhundert schreiben.28 Das heißt, dass man schon allein anhand der Sprache erkennt, dass die Stereotype gleich geblieben sind. Das heißt aber auch, dass wir Antisemitismus nur verstehen und angemessen bekämpfen können, wenn wir uns bewusst machen, dass er eine neue und spezifische Form des Hasses und der Diskriminierung ist. Er ist nicht nur Xenophobie – die Abneigung oder Furcht vor dem Fremden und das Betrachten der eigenen Gruppe als überlegen – oder Rassismus, sondern es kommt ein Faktor der Mutmaßung hinzu oder das, was Theodor Adorno Jahrhunderte später »das Gerücht über die Juden« nennen sollte. Der Antisemitismus basiert auf Konstruktionen bar jeder Vernunft und jedes Realitätsbezuges, wie beispielsweise Verleumdungen bezüglich Hostienschändung oder Kindsmord zeigen, und damit auf zugeschriebenen negativen Eigenschaften oder Charakterisierungen. Er beruhe also nicht, wie Vorurteile, auf Verallgemeinerungen und sei deshalb nicht ein »Vorurteilssystem unter vielen«, schreiben Schwarz-Friesel und Reinharz, sondern er sei verwurzelt »in ein[em] moralische[n] und konzeptuelle[n] Weltdeutungssystem, das so bei keiner anderen Form der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit« existiere. Damit sei Judenfeindschaft nicht nur ein Hass auf das Andere und Fremde, sondern »auf das (vermeintlich) ultimative Böse in der Welt«.29 Die Juden werden nicht aufgrund irgendwelcher realen Ereignisse gehasst, sondern weil sie Juden sind.30 Das einmal zu verstehen und es sich klarzumachen, ist der erste unumgängliche Schritt, den Antisemitismus wirksam zu bekämpfen. Das ist besonders wichtig nicht nur für Strafverfolgungsbehörden, sondern vor allem für Lehrer, die im Umgang mit Judenhass oft hilflos wirken, wie wir sehen werden. Ein Forschungsprojekt vom Tikvah Institut hat im Oktober 2021 gemeinsam mit drei Universitäten und einer Polizei-Hochschule angefangen, erste Schritte auf dem Weg zu einem besser informierten Umgang der Polizei und der Lehrerschaft mit antisemitischen Vorfällen zu erarbeiten. Man kann ihm nur Erfolg wünschen.