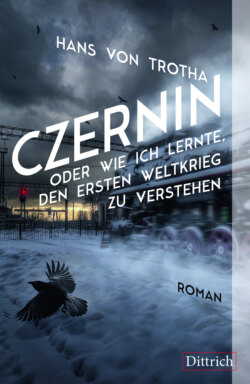Читать книгу Czernin oder wie ich lernte, den Ersten Weltkrieg zu verstehen - Hans von Trotha - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
8
ОглавлениеDie Ehre der Aufnahme ins Herrenhaus war ungewöhnlich für einen noch nicht Vierzigjährigen, der sich kaum hervorgetan hatte. Mit entsprechendem Unmut wurde die Nachricht aufgenommen. Am 3. Juli des Jahres 1912 hielt der frisch Berufene seine sogenannte Maiden Speech. Die in der Luft flirrende Feindseligkeit stachelte ihn auf. Mitunter schwoll das Tuscheln zum Raunen, eine musikalische Untermalung des bisweilen schrillen Solos, das Czernin in der manierierten Pose des Virtuosen gab, die ihm stand, wenn auch nicht zustand. Er galt hier als Parvenu und Ehrgeizling, als einer, der nichts konnte, arrogant und eingebildet, alles Todsünden, wenn auch verbreitet im Reich der Politik. Sie waren allerdings unverzeihlich, wenn nicht ein gewisses Lebensalter erreicht war.
Die Zeitungen berichteten eher unaufgeregt über die Rede. Gegner nannten sie eine Anmaßung, im Ton vergriffen, einen mäßig originellen Leitartikel. Ganz konnten sich Zuhörer und Berichterstatter dem rhetorischen Charme des Neulings dann aber nicht entziehen. Der hatte als Auftakt, nicht ganz aufrichtig, aber geschickt, mit einem Glückwunsch an die Regierung zur gelungenen Wehrreform eröffnet. So nahm er Wind aus den gegnerischen Segeln, bevor er sein Redeschiff beherzt ins offene Meer der allgemeinen Politik steuerte. Da heuchelte er Mitgefühl. Diese Regierung habe es viel schwerer als jede andere, weil die Majoritäten von Fall zu Fall auszuhandeln waren. Er sah dabei einem degeneriert dreinschauenden Reichsgrafen in die Augen. Das machte er immer vor großem Auditorium. Wie ein Vampir verbiss er sich in ein Augenpaar, um darüber den Saal auszusaugen.
Czernin verwahrte sich, erstes Crescendo, gegen die verbreitete Ansicht, der Nationalitätenstreit habe auch die Armee erreicht. Die Armee war ein heikles Feld. Er betonte, dass das nie passieren dürfe. Und er hatte ein Patentrezept: eine einheitliche Kommandosprache. Und das konnte naturgemäß keine andere sein als Deutsch. Applaus. Der erste Applaus ist immer wichtig. Er lockert die Atmosphäre und gibt dem, der klatscht, die Möglichkeit, sich und den anderen zu zeigen, dass er da ist. Da fühlen sie sich besser. So ist sie, die arme, kleine Menschenseele. Man muss nur mit ihr umgehen können. Deswegen husten sie im Konzert, und deswegen provoziert ein guter Redner Applaus auf der ersten Seite seines Manuskripts.
Bosnien. Vier Jahre zuvor hatte Österreich Bosnien und die Herzegowina annektiert. Es war darüber fast zum Krieg mit Serbien gekommen. Österreich, so Czernin, habe jetzt die Aufgabe, aus den Bewohnern der neuen Provinz zufriedene Staatsbürger zu machen. Ja, die südslawische Frage, rief er mit Tremolo in der Stimme, sei die allerwichtigste Frage für die ganze Zukunft überhaupt. Aber – im Decrescendo steuerte er geschickt zu seinem Ceterum Censeo, das er immer schon mal vor großem Publikum hatte orchestrieren wollen – in Anbetracht der dualistischen Verfassung sei jeder Schritt in der Monarchie mit großen Schwierigkeiten verbunden. Er hielt sich zurück. Zumindest in der Wortwahl, nicht aber, was die schneidende Schärfe seiner Stimme und die Eiseskälte seiner zusammengezogenen blauen Augen anging. Er zeigte ihnen die Instrumente. Und sie verstanden. Der Versuch, dies im Gesicht des aufs Korn genommenen Reichsgrafen zu überprüfen, scheiterte allerdings, der war friedlich eingeschlafen.
Dann kam dieser Satz, den sie ihm nicht verzeihen würden. Er wusste es, als er ihn niederschrieb, und erst recht, als er ihn in einem zur Optimierung der Wirkung künstlich erzeugten kleinen Grantanfall, große Oper, ins Auditorium schleuderte: »Dieses immerwährende Ausweichen vor allen heiklen Fragen ist der Fluch der Monarchie.« Da waren sie empört. »Schwadroneur!«, hörte er aus dem Saal. Das ermunterte ihn nachzutreten. »Hätte man nicht seit Jahren und Jahrzehnten immer eine Politik ›von der Hand in den Mund‹ getrieben, so hätten sich die Dinge im Reiche nicht so kompliziert.« Die Pause jetzt nicht zu lang werden lassen. Schuld musste natürlich der Ausgleich von 1867 sein. Er durfte nicht überreizen. Er musste sie provozieren, die Stimmung durfte aber nicht kippen. So ein Saal ist ein wildes Tier. Der Dompteur darf sich keinen noch so kleinen Fehler erlauben, sonst springt die Bestie. Sie sollten sich aufregen, ihm dann aber applaudieren. In seinem Gesicht setzte sich dieses wenig angenehme Grinsen fest, das sich einzustellen pflegte, wenn die Dinge liefen, wie sie laufen sollten, und das er für ein Lächeln hielt.
Dass der sogenannte Ausgleich, also die Einigung zwischen Österreich und Ungarn von 1867, seine Mission nicht erfülle, liege an einer unklaren Fassung des Gesetzes, die daraus hervorgehe, dass der magyarische und der deutsche Text nicht ganz identisch seien. Generalpause. Warum klatschten sie nicht. Er hatte sich zurückgenommen, den Lanzenstoß spontan zum Nadelstich verdichtet, blitzschnell zugestochen. Das war große Kunst. Es klang harmlos, barg aber mehr Zündstoff, als die Ruthenen in ihren Wäldern zusammensammeln konnten. Vor der Brise des Stolzes über das eigene rhetorische Geschick segelte Czernin elegant zur nächsten Volte. Die Ausfälle gegen die aktuelle Finanzpolitik gingen im Geraune fast unter. Aber der lebhafte Schwung, mit dem Czernin seine rhetorische Apotheose vorbereitete, und die mitreißend an- und abschwellende Stimme nahmen das Publikum in Geiselhaft. Jetzt würde er ihnen noch einmal sagen, wie wichtig sie waren und wie sehr man zusammenhalten müsse, dann brauchte er nur noch die Lieblingsmetapher der Monarchie zu orchestrieren, das Wetter.
»Ich habe das Gefühl«, pianissimo, das sorgt für Ruhe, »dass draußen im weiten Reiche ein Zustand herrscht, der den österreichischen Gedanken, das österreichische Gefühl, den österreichischen Patriotismus oft in Gefahr bringt, von dem Gestrüpp des nationalen Chauvinismus erstickt zu werden.« Viel sagte er da nicht, aber es klang gut. Jetzt konnte er Druck machen. »Im Herrenhause«, kurze Pause nach dem Wort, das schmeichelte ihnen, »hat die österreichische Pflanze so tiefe und feste Wurzeln, dass kein Sturm und Gewitter sie entwurzeln kann.« Zweimal wurzeln, das war nicht schön, hatte er übersehen, aber für Ärger war jetzt keine Zeit. »Das Herrenhaus war stets der Hort und Hüter des österreichischen Gedankens, und es wird seiner Rolle stets treu bleiben, wenn es auch in Zukunft über große staatliche Interessen wachen wird.« Jetzt steigern. »Erhalten wir uns zwei Dinge: eine starke einheitliche schwarzgelbe Armee, und sorgen wir für eine gesunde, sparsame Finanzpolitik.« Schnell weiterreden. »Wenn uns das gelingt, brauchen wir keine Besorgnis zu haben, nicht für die Gegenwart und nicht für die Zukunft.« Und jetzt großes Orchester. »Da mag noch mancher Sturm und manches Gewitter kommen – …« Triumphmarsch »… und es in unserm alten Österreich noch so manchesmal blitzen und donnern –, es wird jeder dieser Kämpfe keinen andern Effekt haben als den, dass unser liebes Vaterland neu gekräftigt und neu gestärkt daraus hervorgeht.«
Das Protokoll verzeichnet lebhaften Beifall. Der Thronfolger gratulierte per Telegramm, was Czernin, ebenfalls telegrafisch, artig erwiderte.
Wollen meinen ergebensten Dank für das gnädige Telegramm anlässlich meiner Rede im Herrenhaus entgegennehmen. Meine Leistung war wohl eine sehr bescheidene, welche das Lob gewiss nicht verdient.
Der Erzherzog verstand. Es musste gut gelaufen sein. Czernin war offenbar zufrieden mit sich.