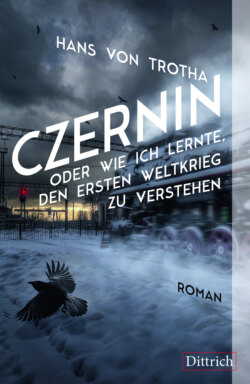Читать книгу Czernin oder wie ich lernte, den Ersten Weltkrieg zu verstehen - Hans von Trotha - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
14
ОглавлениеDie Nachricht von der Berufung des Grafen Czernin auf den Bukarester Posten löste in Ungarn schrille Empörung aus. Das Verhältnis zwischen Ungarn und Rumänien war wegen Siebenbürgen mehr als gespannt, wo zweieinhalb Millionen Menschen rumänischer Muttersprache von der ungarischen Regierung systematisch unterdrückt wurden. Czernin hatte seinen Ruf als Magyaren-Fresser weg. Dass es hieß, die Berufung gehe auf den Thronfolger zurück, machte die Sache nur ärger.
Diese Ausgangslage verschaffte Czernin eine der seltenen Begegnungen mit dem Grafen Tisza. Der empfing ihn freundlich in seinem Wiener Büro, kam ihm bis zur Tür entgegen und wies ihn mit generöser Geste zu einem der hohen, gardinenverhangenen Fenster, vor dem zwei mit hellblauer Seide bespannte Kanapees und dazu passende Fauteuils zum Ensemble gruppiert waren.
Vier Pflaster drückten einen quadratisch geschnittenen Mullverband auf die rechte Schläfe. Tisza trug dieses Mal wie eine Auszeichnung. Es warnte weithin sichtbar, dass dieser Mann jederzeit bereit war, den Säbel zu ziehen.
»Graf Czernin, wie man schon Ihrer Maiden Speech im Herrenhaus hat entnehmen dürfen, befinden Sie sich im Stande der Kenntnis der ungarischen Verfassung.«
Das südöstliche Timbre verlieh der Stimme etwas Verführerisches. Genau besehen, war es eine boshafte Eröffnung. Czernin fand sie intelligent. Er erwiderte nichts.
»Nun, nach dieser Verfassung muss, das wird Ihnen nicht entgangen sein, die äußere Politik der Monarchie ausdrücklich im Einverständnis mit dem jeweiligen Minister des Äußeren und mit dem ungarischen Ministerpräsidenten geführt werden.«
Czernin war bereits gewarnt worden, dass Tisza diesen Passus der Verfassung allen Gesandten gegenüber fortwährend im Mund führte.
»Sie können sich vorstellen, dass wenig von dem vielen Schmeichelhaften, was Sie über das Königreich Ungarn und uns Ungarn gesagt und geschrieben haben, in Einverständnis mit dem Ministerpräsidenten als offizielle Politik der k.u.k. Monarchie wird gelten können.«
Czernin holte Luft. Tisza redete weiter.
»Wir können es kurz machen, Czernin. Wenn Sie den Posten antreten wollen, müssen Sie sich von diesen Positionen distanzieren.« Czernin holte wiederum Luft.
»Ad eins. Ad zwei: Ich bestehe darauf, dass sämtliche, und damit meine ich sämtliche, vor allem die geheimen Nachrichten, die in der Gesandtschaft eingehen, unmittelbar nach ihrem Eintreffen an mich übermittelt werden.«
Czernin musste die eingeatmete Luft durch die Nase entweichen lassen.
»Außerdem werden Sie keinen Schritt von irgendeiner Bedeutung tun, der nicht mit mir persönlich vorher, und ich betone: vorher, abgestimmt worden ist.«
Czernin setzte erneut an.
»Wenn diese Punkte klar sind und ich mit der Überzeugung aus diesem Gespräch herausgehen kann, dass Sie als Vertreter der Monarchie nichts tun, sagen oder auch nur denken werden, was der offiziellen Politik des Ballhausplatzes widerspricht«, Tisza machte eine Pause, in die hinein Czernin aber unmöglich etwas sagen konnte, sodass ihm nichts anderes übrig blieb, als wieder auszuatmen, »dann werden Sie nach Bukarest reisen. Und ich kümmere mich um die Meinung in Budapest.«
Sie holten gleichzeitig Luft.
»Sie nehmen Ihre antiungarischen, wie soll ich sagen, Positionen zurück. Das Wort Ausfälle würde, unter uns, die Sache wohl besser treffen. Und Sie handeln nach meinen Anweisungen. Dann liegen gedeihliche Jahre im Dienste der gemeinsamen Sache vor uns. Und das ist, sollte ich meinen, die k.u.k. Monarchie Österreich-Ungarn. Nicht wahr?«
Im Luftholen aus dem Takt gebracht, wusste Czernin nicht, ob er ein- oder ausatmen sollte, und hörte die letzten Worte mit angehaltenem Atem an. Als ihm die Schärfe der Anordnung und die Zumutung im Ton bewusst wurden, brachte ihn das doch zu sich selbst zurück.
»Exzellenz«, begann er. Mit der Atmung waren auch die Gedanken aus dem Tritt. Hätte er seinem aufsteigenden Ärger nachgegeben, hätte er alles kaputt gemacht, die diplomatische Karriere ebenso wie die Freundschaft zu Tisza. Dass beides lediglich in seiner überreizten Fantasie existierte, fiel ihm nicht auf.
»Ja, bitte?« Der Ungar genoss die Verunsicherung. Das ärgerte Czernin.
»Man wird schwerlich von einem Ehrenmanne verlangen können, dass er sich von seinen aufrichtigen Überzeugungen wegen eines Dienstpostens distanziere. Sie werden mir zugeben, Exzellenz, dass ein Mann, der dieser Aufforderung nachkäme, kein ernst zu nehmender Gesprächspartner für Exzellenz wäre. Das zumindest erlaube ich mir zu hoffen.«
Mit dem Atemrhythmus kehrte der Gedankenstrom zurück. Tisza sah weiter scheinbar freundlich drein, jedoch wurde der Blick matter, das Lächeln, es war nur eine Nuance, zur Fratze. Das signalisierte Czernin, dass er mit seiner Parade die rhetorischen Pläne seines Gegenübers glücklich durchkreuzt hatte. Er wollte das Gespräch aber auf keinen Fall unversöhnlich enden lassen.
»Davon unberührt, und das, Exzellenz, dächte ich, sollte uns beiden gleichermaßen selbstverständlich sein, ist das Faktum, dass ein Gesandter der k.u.k. Monarchie im Amte kein anderes Wort führt als das offizielle seiner Regierung. Ohne Frage ist der Gesandte verpflichtet, sich als Rad in die große Staatsmaschine einzufügen und loyal die Politik des Ballplatzes zu unterstützen. Eine einheitliche Politik wäre ja ganz ausgeschlossen, wollte ein jeder subalterne Beamte seine eigenen Ansichten, seien sie nun richtig oder falsch, ins Leben setzen.«
Tisza würde die Feinheit bemerken, dass er den Ballplatz, unter Eingeweihten die Kurzform für das Außenministerium am Ballhausplatz, in Anschlag brachte, nicht aber Budapest.
»Gut«, sagte der Ungar, »Sie werden mir also Ihr Ehrenwort als Ehrenmann geben, dass Sie keinerlei Anstrengungen unternehmen, um eine Politik in den Sattel zu heben, die als der Wien-Pester Linie entgegengesetzt betrachtet werden könnte.«
Czernin war versucht, dem spontan zuzustimmen. Da erinnerte sich der Körper noch vor den Gedanken des heiligen Zorns, mit dem der Thronfolger ihn überzogen hatte, als er nur ein Gespräch mit Tisza vermitteln wollte. Wie würde er reagieren, wenn Czernin Tisza ein Ehrenwort gab, das zum Inhalt hatte, seine und des Thronfolgers Pläne in der Politik nicht umzusetzen. Beinahe wäre er zum zweiten Mal in die gleiche Falle getappt. Czernin zuckte leicht mit den Schultern, um das Unwohlsein abzuschütteln.
»Exzellenz werden Verständnis haben für die höfliche Bitte meinerseits, die Zusage eines derartigen Ehrenwortes aufschieben zu dürfen, bis ich Gelegenheit hatte, dieses Vorgehen mit Seiner Kaiserlichen Hoheit, dem Erzherzogthronfolger, zu bereden. Die Zustimmung Seiner Kaiserlichen Hoheit vorausgesetzt, können Sie sich auf mich verlassen.« Dann entfuhr ihm noch »wie auf einen Freund«. Er biss sich auf die Lippen.
Tiszas falsches Lächeln verwandelte sich wieder in das warme Original. Er erhob sich, Czernin ebenfalls, als habe er die plötzliche Bewegung geahnt.
»Lieber Graf Czernin, das ist doch ein ausgesprochen vernünftiger Vorschlag. Sie sprechen demnach mit Seiner Kaiserlichen Hoheit und geben mir anschließend die Ehre eines erneuten Besuchs. Vorausgesetzt natürlich, Seine Kaiserliche Hoheit stimmt zu.«
»Habediehre, Exzellenz.«
»Habediehre.« Mit diesem zu einem einzigen gedehnten Wort verwischten Gruß verabschiedeten sich die Grafen voneinander. Daraus müsste sich doch etwas machen lassen, fand Tisza, als er die Tür hinter dem neuen Gesandten der Monarchie in Rumänien schloss.
Ende November 1913 übernahm Czernin die Geschäfte. Marie und die Kinder sollten Weihnachten folgen. Bis dahin hatte er Zeit, die Akkommodation zu perfektionieren, Personal und Hauslehrer zu engagieren und mit der Arbeit zu beginnen. Das Terrain war heikel. Auf dem Balkan lebten zahlreiche Völker, deren traditionelle Gebiete sich nicht mit denen der Staaten deckten, die hier entstanden waren. In Bewegung war die Landkarte geraten, als das Osmanische Reich zu zerfallen begann. Bulgarien, Serbien, Griechenland und Montenegro schlossen sich in einem Balkanbund zusammen, der im Herbst 1912 das Osmanische Reich angriff, um dessen europäische Provinzen unter sich aufzuteilen. Dieser Balkankrieg dauerte zwar nicht lange, dafür folgte ihm schnell ein zweiter. Es gab Streit bei der Aufteilung der Beute. Vor allem die Bulgaren, die wie die Rumänen von einem deutschen Prinzen regiert wurden, waren unzufrieden. Sie brachen den neuen Krieg vom Zaun. Allein gegen alle, mussten sie allerdings bald aufgeben und verloren im Frieden von Bukarest im August 1913 den größten Teil dessen, was sie im ersten Krieg gewonnen hatten. Gespielt und verloren. Und viele ins Elend gerissen. Die Balkankriege waren besonders grausam. Die Zivilbevölkerung schonten sie nicht. Im Gegenteil. Andersgläubige wurden zwangsbekehrt, Moslems in ihre Moscheen gesperrt und in die Luft gesprengt, christliche Siedlungen ausgelöscht, die Bewohner massakriert. Gewinner des Gemetzels war am Ende wieder Serbien, das sogleich zur Befreiung von Bosnien und der Herzegowina aufrief, die Österreich 1908 annektiert hatte. In Belgrad, Sarajevo und Mostar waren die Habsburger verhasster als Teufel, Pech und Schwefel. Und in Österreich hörte man jetzt immer lauter den Schlachtruf Serbien muss sterbien.
Als der Graf Czernin in Bukarest eintraf, sprachen sie alle noch von der Konferenz, zu der sich die Delegationen in der Stadt gedrängt hatten, um die Grenzen auf dem Balkan neu zu ziehen. Es war gar nicht so leicht, sich in den Bündnisaktivitäten zurechtzufinden, die Europa zusammenhielten wie dicke Hanfschnur eine aus der Form geratene Paketsendung. Über allem standen drohend zwei große Allianzen, das gegen Russland gerichtete Bündnis Deutschlands mit Österreich-Ungarn, die sogenannten Mittelmächte auf der einen und das gegen Deutschland gerichtete Bündnis Russlands mit Frankreich auf der anderen Seite. Italien neigte dem ersten zu, England dem zweiten. Und dann gab es da noch ein paralleles Universum, ein monströses Spinnennetz, an dem von einer immer unbekannten Zahl von Zuträgern und Emissären, Informanten und Ganoven unentwegt geheim gesponnen wurde, ein Kokon, der sich immer enger um die handelnden Nationen und Personen schnürte. Oft waren nicht einmal die eigenen Leute über die Verbindlichkeiten ihrer Regierungen informiert.
So wurde dem Grafen Czernin zu seiner Überraschung mitgeteilt, dass Rumänien der Monarchie in einem Geheimvertrag verbunden war. Der Vertrag bestand bereits seit 1883 und war mehrfach erneuert worden, Deutschland und Italien waren jeweils beigetreten, zuletzt im Jahr 1902. Niemand wusste, ob dieser Vertrag noch irgendetwas bedeutete. Czernin sollte es herausfinden.
Unmittelbar vor der Abreise wurde er noch einmal zu Seiner Majestät beordert. Der greise Monarch zeigte sich bestens informiert und betonte, wie wichtig das Bündnis mit Rumänien sei. Denn, so Seine Majestät zu Czernin: »Der Bukarester Friede ist unhaltbar, und wir gehen einem neuen Kriege entgegen. Gebe nur Gott, dass er am Balkan lokalisiert bleibt.« Er erwarte bald Bericht. Schließlich fragte Czernin noch, ob er einen Besuch des rumänischen Königs anregen solle. Der Kaiser seufzte und meinte, versonnen in den Park blickend, wo er nicht das herbstkalte Schönbrunn, sondern das warme, grüne Ischl zu sehen schien: »Die Besuche des Königs von Rumänien in Ischl sind stets recht mühsam für mich. Einem anderen gibt man ein Gewehr in die Hand und er ist für einige Stunden versorgt. König Carol will aber fortwährend mit mir sprechen.«
Die Walachei war sprichwörtlich für ihre rückständige Abgeschiedenheit. Aber Bukarest war frisch, auf balkanische Weise pulsierend, vielerorts Baustelle. Auf Czernin, der in der französischen Hauptstadt gelebt hatte, machte die Stadt den Eindruck, als habe ein preußischer Offizier Paris befohlen. Da wurde viel investiert, rasant und gewiss nicht immer legal gebaut. Dem Hohenzollern-König war daran gelegen, dass es schnell ging. Er wollte eine richtige europäische Hauptstadt. Deswegen hatten private Bauherren alle Freiheiten, was neben wilden Spekulationsgeschäften eine gewagte Mixtur der unterschiedlichsten Stile zur Folge hatte. Wo die Stadt fertig wurde, zeigte sie sich stolz, immer ein bisschen oberflächlich und over the top.
Der Empfang war trüb. Es war feucht. Niemand erwartete den Grafen Czernin. Rund um den Bahnhof waren die Straßen aufgerissen und unbefestigt. Es arbeitete zwar keiner, aber der Zustand war der einer Baustelle. Mit seinen feinen Reiseschuhen, die prall gefüllte Aktentasche unterm Arm, musste Czernin die matschige Piste überqueren, um zu einem Wagen zu gelangen. Jeder Schritt durch den Kot verursachte ein schmatzendes Geräusch und verteilte neue Spritzflecken auf der dunklen Hose. Na bravo, fabelhaftes Willkommen, dachte der Gesandte schlecht gelaunt.
Das Hôtel du Boulevard war traditionell das Quartier der unverheirateten Diplomaten aus Österreich-Ungarn, aber auch aus Deutschland und anderen Ländern. Czernin bezog hier für die Zeit, in der das Gesandtenappartement hergerichtet wurde, eine Suite. Überschwänglich wurde er von Frau Bork begrüßt. Helene Bork war eine Bukarester Institution. Zu Zeiten des russisch-türkischen Kriegs hierhergekommen, führte sie zunächst ein Geschäft für Handschuhe und Krawatten. Als die Pacht des Hotels Continental frei wurde, ließ sie sich die Gelegenheit nicht entgehen. Nach einiger Zeit wechselte sie aus Gründen, über die spekuliert wurde, ins Boulevard und heiratete einen Engländer namens Mister Bork, der allerdings, so hieß es, nie selbst aufgetreten war. Mutter Bork war das Zentrum einer Galaxie aus Informationen, deren Wahrscheinlichkeitsgehalt nie ganz gering war. Bisweilen erfand sie Tatsachen, um aus rein sportlicher Neugier deren Werdegang zu verfolgen. Sie wusste alles und mehr, und es war nicht leicht, ihr eine Information vorzuenthalten, in deren Besitz zu gelangen sie sich vorgenommen hatte. Konsequent war sie auch selbst Gegenstand widerstreitender Theorien, etwa wenn es um ihre Vermögensverhältnisse oder um ihr Alter ging. Sie war, so der Sprachgebrauch, auf den man sich geeinigt hatte, in ihren besten Jahren, das allerdings seit einer ganzen Weile. Rosig und eher fällig, drückte sie die Jüngeren der ihr Anvertrauten gern an ihren ausladenden Busen, wobei niemand als sie selbst sich die Herren anvertraute. Bei ihren Aktivitäten hatte sie stets auch das Wohl ihrer einzigen Tochter Betsy im Auge, eine nicht gerade schöne, aber frische blonde Frau, die ein anscheinend dann doch nicht ganz unbeträchtliches Vermögen zu erben versprach. Es gehörte zu Mutter Borks Lebenszielen, Betsy gut im Diplomatischen Corps zu verheiraten, was unlängst gelungen war, als ein italienischer Legationsrat, der im Übrigen Spielschulden gehabt haben soll, dem Druck nicht standhielt.
Missmutig sah sich Czernin im Foyer um. Hier sah alles aus wie Falschgeld, die Herrschaften, die auf den Fauteuils herumlungerten, eingeschlossen. Das also würde für die nächsten Wochen sein Zuhause sein. Noch einmal entfuhr ihm ein Na bravo. Bevor Frau Bork ihn in ein Gespräch verwickeln konnte, hatte er den Zimmerschlüssel gegriffen und war zu den Aufzügen geeilt. Die waren naturgemäß alle besetzt.
Ein dumpf blechernes Geräusch, das ein Klingeln darstellen sollte, kündigte die Ankunft einer Liftkabine an. Eine hässliche rote Lampe signalisierte, dass es die linke sein würde. Breitbeinig stellte sich Czernin vor den Lift und kehrte dem Foyer so viel Rücken zu wie möglich. Routiniert wurde das Gitter vom Liftboy zur Seite geschoben. Czernin setzte zum Sprung in die Kabine an, blieb aber wie angewurzelt stehen.
Im goldenen Käfig stand, schlank und kerzengrad, gehüllt in dunkelgrauen, an der Taille eng geschnürten Taft, blauschwarz glänzendes, anscheinend lockenloses Haar unter einem modisch roten Hut, ein Wesen, so überirdisch schön, so sinnlich und so unbeschreiblich, dass es ihn, der sonst so sehr auf seine Erscheinung achtete, in einer reichlich dümmlichen Pose erstarren ließ. die Beine breit, die rechte Hand hüfthoch mit dem Schlüssel in der Luft, als gebe es hier etwas aufzuschließen, die Kinnlade zur Brust herabgesunken. Hätte er sich gesehen, er wäre vor Scham vergangen. Er sah aber nicht sich. Er sah sie.
Und sie sah ihn. Das brachte sie zum Lachen. Nicht abfällig, vielmehr herzlich und vor allem wissend. Sie sah ihn, und sie sah, was geschah oder schon geschehen war. Sie sah einen attraktiven, sinnlichen Herrn der besseren Gesellschaft, etwas feucht, den gerade jener Schlag getroffen hatte, der die Männer eben manchmal traf. Vielversprechend blitzten die grauen Augen ihn an, nahmen die seinen gefangen. Sie waren tief, von einem strahlend hellen Grau, wie er es noch nie gesehen hatte. Wären da nicht der rote Hut und der erdbeerrote Mund gewesen, mit der vornehm blassen Haut, den schwarzen Haaren, den hellgrauen Augen und dem dunkelgrauen Kleid, hätte es eine Schwarz-Weiß-Fotografie in goldenem Rahmen sein können. Ewig hätte er so dastehen mögen und schauen. Sie aber trat aus dem Rahmen der Liftkabine in die farbige Wirklichkeit, auf ihn zu, blieb dicht vor ihm stehen, ganz kurz, er konnte ihr schweres Parfüm riechen, setzte sodann ihren Gang fort, wobei das Kleid wie aus Versehen seinen Anzug streifte. Was blieb, waren der Blick in den leeren goldenen Käfig, das sich entfernende Rascheln von Taft und der Duft. Als Czernin gerade den Lift betreten wollte, schloss sich dessen Tür vor seinem Gesicht.