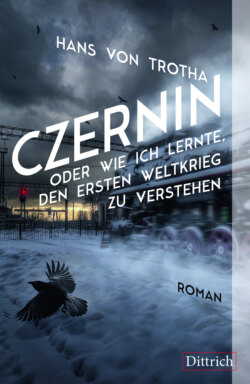Читать книгу Czernin oder wie ich lernte, den Ersten Weltkrieg zu verstehen - Hans von Trotha - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
12
ОглавлениеBukarest, das war eine Bombe. Den Grafen Czernin erreichte die Nachricht per Telegramm am See. Der schwere Schreibtisch des Fürsten war der seine geworden, die Villa Kinsky die Villa Czernin, nachdem der Fürst siebzigjährig an den Folgen eines Reitunfalls verstorben war. Der Elefant thronte jetzt für Czernin im Toten Gebirge über dem See.
Es lag nahe, dass der Thronfolger hinter der Idee steckte, ihn zum Gesandten der k.u.k. Monarchie in Rumänien zu ernennen. Es war einer der brisantesten Posten, die das Ministerium des Äußeren derzeit zu vergeben hatte. Und Berchtold hatte bestimmt nicht als Erstes an Czernin gedacht.
Leopold Graf Berchtold von und zu Ungarschitz, Fratting und Pullitz war der Inbegriff des verwöhnten Adeligen. Aber er genoss das Vertrauen des greisen Kaisers. Als dieser vorschlug, ihn zum Minister des k.u.k. Hauses und des Äußeren zu ernennen, gab selbst der Auserkorene zu bedenken, er fühle sich dem nicht gewachsen. Weder dieses Gefühl noch die ihm so offensichtlich entsprechende Wirklichkeit hinderten den Kaiser allerdings daran, Berchtold zu berufen. Er war ein leuchtender Stern am Himmel der Wiener Gesellschaft, elegant, groß, blass, blasiert. Er sah jünger aus, als er war. Von Frauen verstand er etwas und von Pferden. Er hatte viele Freunde in Wien, darunter gewiss genügend Anwärter auf einen frei werdenden Gesandtenposten. Aber was sollte er tun, wenn der Thronfolger drängelte.
Die Aufforderung, nach Bukarest zu gehen, kam unerwartet, zumal Czernins Freundschaft mit Erzherzog Franz Ferdinand einen Rückschlag erlitten hatte. Dabei hatte er, ausgerechnet er, doch nur versucht, ausgleichend zu wirken. Aber der Loyalitätszwang im misanthropischen Reich der Grantigen war, wie Czernin lernen musste, kompromisslos.
Der mächtigste Vertreter des verhassten Ungarn, einer der einflussreichsten Männer in der Doppelmonarchie, war der Graf Stephan Tisza. Schon sein Vater war ungarischer Ministerpräsident gewesen, er selbst hatte das Amt in diesem Jahr zum zweiten Mal übertragen bekommen. Als leidenschaftlicher Kämpfer für ungarische Interessen war er der geborene Feind Franz Ferdinands und Czernins. Für den Erzherzogthronfolger personifizierte Tisza denn auch alles Übel dieser Welt. Czernin hingegen zeigte sich beeindruckt von dem kultivierten Grafen. In fast allen politischen Fragen waren sie sich denkbar fern, aber in der Person Tiszas erlebte Czernin den unerwarteten Glücksfall eines harten, aber intelligenten Gesprächspartners. Da wucherte ein krauses Gefühl der Sympathie. Czernin wollte von dem um zehn Jahre Älteren akzeptiert werden und, mehr noch, gemocht. Dazu kam, ganz aktuell, das Duell. Markgraf Georg Pallavicini hatte Tisza vorgeworfen, Zeugen in einem Gerichtsverfahren gegen seinen Vorgänger beeinflusst zu haben, wodurch erst der Weg ins Amt für ihn frei geworden sei. Ohne mit der Wimper zu zucken, forderte der Graf den Markgrafen zum Säbelduell. Es hieß, beide hätten Kopfverletzungen davongetragen. Czernin war voller Bewunderung.
Wäre da nicht etwas Melancholisch-Spöttisches um die Augen gewesen, der Graf Tisza hätte auf den ersten Blick als Preuße durchgehen können. Er war von einer für einen Ungarn untypischen Disziplin und Arbeitswut. Er lenkte sämtliche Aktenströme über seinen Schreibtisch, ohne je die Kontrolle darüber zu verlieren. Das machte ihn stark und gefährlich. Nichts von alledem verriet das sympathische Gesicht mit dem grau melierten Vollbart und der hohen Stirn, unter der, geschützt von rund gefassten Brillengläsern, wache Augen blitzten.
Seine Majestät hielt große Stücke auf seinen ungarischen Ministerpräsidenten, für den er nicht der Kaiser, sondern der Apostolische König war, eine Ehrenbezeichnung, die sich die ungarischen Monarchen einst durch besonderes Engagement bei der Christianisierung verdient hatten. Mit Blick auf die Zeit nach ihm selbst, vor allem aber weil er es leid war, sich die fortwährenden Schimpftiraden beider übereinander anzuhören, wollte der Kaiser eine Aussprache zwischen Franz Ferdinand und Tisza. Czernin bot Hilfe an.
Als Franz Ferdinand von den »Intrigen hinter meinem Rücken«, von diesem »satten Verrat« und der »Erzschweinerei« erfuhr, brach der Damm, der gerade bei ihm immer so viel zu halten hatte. Alles, was sich aufgestaut hatte, entlud sich über Czernin. Erwiderungen ließ der Wütende nicht zu, verfluchte die »am Busen genährte Natter«, schlug Türen, brüllte, dass es durch die zugeschlagenen Türen und durchs ganze Obere Belvedere zu hören war, und begab sich schnaubend, verraten und enttäuscht aufs Land, um bei der Familie Linderung zu suchen.
Des Grafen Czernin erste diplomatische Initiative schien auch gleich seine letzte gewesen zu sein. Niedergeschlagen verließ er das Belvedere. Die grotesk dicklippige Fratze in dem steinernen Torbogen, durch den er den Hof des Unteren Schlosses verließ, schien mit ihren zusammengekniffenen Augen seit zwei Jahrhunderten darauf gewartet zu haben, in diesem Moment hämisch auf ihn herunterzuschauen. Fehlte nur, dass sie gespuckt hätte. Es war Sommer. Czernin nahm den nächsten Zug nach Ischl. Die Familie war am See. Und er hatte nichts mehr zu tun.
In Wien hatte man hinter den Wolken noch eine Sonne erahnen können. Das Salzkammergut war vollständig in durchdringende Feuchte gehüllt. Es herrschte Schnürlregen, eine die Region in den Sommermonaten über Tage, mitunter auch über Wochen fest umschließende, mit nichts zu vergleichende Dimension von Feuchtigkeit, in der die Unterschiede zwischen Nebel, Niesel und Regen aufgehoben sind. Wo sonst Landschaft ist, ist dann Grau. Dieses Phänomen, gegen das kein wasserabweisendes Kleidungsstück und kein noch so heiteres Gemüt etwas auszurichten vermögen, gilt vielen als Quell jener Geisteshaltung, die die Österreicher den Grant nennen. In dieses Wetter gewordene Ungemach fuhr der Graf Czernin, gedemütigt und verunsichert, je weiter je tiefer. Der Ärger steigerte sich zum Selbsthass. Schließlich hatte Czernin den Anlass zu seiner Demütigung selbst gegeben.
Obwohl er hatte telefonieren lassen, stand Werner nicht mit dem Wagen am Bahnhof und der begossene Graf im Regen wie ein Pudel. Nach dem Wutstau im Zug geriet das zum Anlass für einen veritablen Ausbruch, der in der Selbstwahrnehmung immerhin die Symmetrie zum Erzherzog wiederherstellte. Allerdings hatte Czernin auf dem leeren, regennassen Perron nicht einmal einen Adressaten für sein Gebrüll. Das verhallte wie von Watte gedämpft im Schnürlnebel, registriert lediglich von einem verwunderten Stationsvorsteher, der sich in seinem Kontor versteckt hielt, bis der schäumende Graf einen Wagen gefunden hatte.
In den vergangenen Jahren waren sie eine Familie geworden. Nach der Geburt des Stammhalters war es kaum eine Enttäuschung, dass als Zweites eine, immerhin gesunde, Tochter geboren wurde. Danach meinte es das Schicksal besonders gut mit dem Patriarchen Czernin und schenkte ihnen drei weitere Söhne. Da war er dann so weit, sich noch einmal eine Tochter zu wünschen. Aber derart ließ sich das Schicksal dann doch nicht herumkommandieren.
Befragt nach seinen Erziehungsprinzipien, pflegte der Graf Czernin zu antworten: Streng, aber ungerecht. Damit kam er der Wahrheit näher, als ihm bewusst sein mochte. Die Kinder fürchteten ihn. Sie liebten ihn, wenn er auf seine eigene, unkonventionelle Weise für Unterhaltung sorgte, gelegentlich zu zynisch für Kinderseelen, aber das mussten sie eben ertragen. Er war loyal. Er war fürsorglich. Er liebte die Mutter seiner Kinder. Die Kinder vergötterte er. Deswegen war er streng. Sie mussten mit den Wechselfällen der Geschichte leben, die sich ihrer Kindheit als changierende Gemütslagen ihres Familienoberhaupts darboten. Und doch spürten sie ihn und seine Nähe. Er war sinnlich. Seine Nervosität, die impulsive Unberechenbarkeit waren ja eine Seite dieser aus der Art geschlagenen, nie ganz kultivierten Sinnlichkeit. Und alles Sinnliche ist Kinderseelen nah. Das Höchste war es, mit dem Vater im Gras zu liegen, leger zerbeulte Hüte auf den Köpfen, jeder einen Halm im Mund, den Blick in die Landschaft genießend, den sie teilten. Das Maß an Einverständnis, die Sicherheit, in die man sich da fallen lassen konnte wie in einen Haufen Heu, vermochte nur er ihnen zu geben, selten, nie vorhersehbar, aber wenn, dann war es ein Hauch von Seligkeit, der fürs Leben imprägnierte. Wenn er dann in dieses Schweigen den Arm hob und ihn dem Kind neben sich über die Schulter legte, dann war das Glück, für beide.
Jedes der Kinder hatte eine Alter und Charakter angemessene Strategie, dem heiligen Zorn zu entkommen. Als ihr Vater an diesem unheilgesättigten Schnürlregentag unerwartet in der Villa am See auftauchte, bedurfte es keiner besonderen physiognomischen Kenntnisse, um sogleich zu erfassen, dass es besser war, Abstand zu halten. Die fünf einigten sich auf den Wettbewerb, wem es gelänge, dem Papa in diesen Tagen am seltensten im Haus zu begegnen. Sie verloren allerdings bald den Spaß daran, weil der gebeutelte Graf sich in seinem Arbeitszimmer verschanzte, das für sie eh tabu war. Am dritten Tag schließlich rang sich Czernin einen Brief an den Thronfolger ab. So lange hatte er gebraucht, um sich zu sedimentieren, wie er es nannte. Der Blick war während der ganzen Zeit in die schmutzig nasse Watte gerichtet. Wo das Fenster sonst den Elefanten in Szene setzte, beschränkte sich der Ausblick auf eine deprimierend dreckige weiße Wand. Es war der letzte Tag im August des Jahres 1913.
Ich interessiere mich gar nicht für den Grafen Tisza, ebensowenig wie für die ganze magyarische Gesellschaft. Diese magyarische Clique ist eine Pestbeule am Körper der Monarchie, und kein österreichischer Patriot kann daran zweifeln. Mein Gedanke bei dieser Audienz Tiszas unterscheidet sich in seinen Motiven auch sehr wesentlich von dem Gedankengange Sr. Majestät. Ich wünsche, dass Tisza einmal ordentlich der Kopf gewaschen wird und er einmal mit eigenen Augen sieht, dass noch ein stärkerer Wille für die Zukunft da ist als der seine. Nicht also, ihm zu helfen, sondern die Situation zu bessern, war mein Gedanke dabei, um dieser verderblichen Nationalitätenpolitik endlich zu steuern.
In seiner nervösen Unsicherheit unterstrich er viel und nicht immer das Richtige. Immerhin konnte Czernin davon ausgehen, dass das mit der Pestbeule dem Erzherzog gefallen würde. Er fand nie heraus, ob der Brief Franz Ferdinand beschwichtigte oder ob der sich zwischen seinen Rosenstöcken auch so beruhigt hatte. Er war gewarnt. So etwas passiert einem nicht zweimal. Da platzte die Aufforderung, als Gesandter nach Bukarest zu gehen, völlig überraschend in das Leben der Czernins.
Marie widerstand sowohl der Versuchung, dafür zu beten, dass aus Bukarest nichts wurde, als auch der Alternative, die darin bestanden hätte, die einflussreiche Verwandtschaft zu mobilisieren. Stattdessen würde sie sich fügen, so oder so. Schicksal war Schicksal. Es war nicht ihre Art, sich in den Lauf der Geschichte einzumischen.
Und so nahmen die Czernins die Vorbereitungen zur Übersiedlung in Angriff. Marie plante die Verlagerung des Haushalts und versuchte, die Kinder dem jeweiligen Alter entsprechend auf das vorzubereiten, was da auf sie zukommen mochte, auch wenn sie es selbst nicht wusste. Der Graf Czernin ließ sich unterdessen am Ballhausplatz über die politische Situation instruieren und traf seinen Vorgänger, den Prinzen Karl zu Fürstenberg. Den Kindern versprach er ein echtes Abenteuer. Er konnte nicht ahnen, wie sehr er dieses Versprechen halten würde.