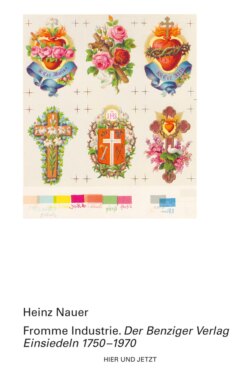Читать книгу Fromme Industrie - Heinz Nauer - Страница 8
Phasen und Übergänge
ОглавлениеDie historische Forschung hat verschiedene Indikatoren verwendet, um den Aufschwung der christlichen Konfessionen im 10. Jahrhundert zu belegen und zu beschreiben. Für den Katholizismus als Indikatoren häufig genannt wurden die Zahl neuer Kirchenbauten, die Gründung neuer Orden, Kongregationen oder religiöser Laiengesellschaften, die Anzahl an Konvertiten, die Partizipation der Gläubigen an Wallfahrten und Gottesdiensten oder die Präsenz religiöser Themen auf dem Buchmarkt. Es mag fragwürdig erscheinen, Religiosität quantitativ messen zu wollen. Veränderungen der Kirchen in ihrer Beziehung mit der Gesellschaft und sich wandelnde Praktiken der Gläubigen – kurz: Konjunkturen des Religiösen – dürfen dem Historiker aber nicht gleichgültig sein. Religionen wandeln sich, obschon sie selbst häufig den Anspruch auf eine zeitlose Wahrheit erheben.
In der Geschichte des Katholizismus lassen sich ab 1750 zwei Phasen intensiven Wandels feststellen: einmal zwischen etwa 1760 und 1830 und einmal in den Jahrzehnten um 1960. Die erste Phase prägten die Ideen der Aufklärung, die auch das Feld der Religiosität unmittelbar berührten. Lange wurde übersehen, dass die Exponenten der Kirche aufklärerische Ideen nicht unisono ablehnten. Erst in jüngerer Zeit ist eine Debatte über die katholische Aufklärung entstanden.5 Es gab in den Jahrzehnten um 1800 eine starke Bewegung einer katholischen Aufklärung, die sich nicht nur in theoretischen Reflexionen und Abhandlungen, sondern gerade auch in der kirchlichen Praxis äusserte. Aufklärerisch und antibarock gesinnte katholische Geistliche sahen sich als «Volkserzieher», pflegten den interkonfessionellen Austausch und forderten unter anderem einen stärkeren Einbezug der Gemeinde, neue Bibelübersetzungen und allgemein eine Hinwendung zu den Landessprachen auch in der Liturgie. Die katholischen Aufklärer verloren im Verlauf des 19. Jahrhunderts gegenüber den ultramontan-konservativ gesinnten Katholiken an Gewicht und gerieten schliesslich so weit in Vergessenheit, dass die ökumenischen Bestrebungen in den 1960er-Jahren den meisten Betrachtern als etwas komplett Neues erschienen.6
Die zweite Übergangsphase wird in der Regel mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962–1965) assoziiert. Das Konzil war allerdings viel eher Folge als Ursache des gesellschaftlichen Wandels in der Nachkriegszeit, der auch die katholischen Gebiete erfasst hatte. Eine bestimmte Ausprägung der katholischen Kultur verschwand in dieser Phase innerhalb weniger Jahrzehnte beinahe vollständig. Das «katholische Milieu» brach weitestgehend in sich zusammen, die Zahl der Gottesdienstbesucher und der Priesterordinationen ging rapide zurück, die letzten Überbleibsel einer barock-agrarischen Frömmigkeit verschwanden.7
Die Zeit zwischen den beiden Phasen des Übergangs, also zwischen etwa 1830 und 1960, beschreibt die Forschung verschiedentlich als eine Zeit homogener Geschlossenheit und hoher öffentlicher Sichtbarkeit für den Katholizismus. Olaf Blaschke hat für diese Phase den Epochenbegriff «Zweites Konfessionelles Zeitalter» geprägt.8 Diese Etikettierung wurde mit Hinweis auf regionale, zeitliche und auch interkonfessionelle Vielstimmigkeiten von verschiedenen Seiten kritisiert.9 Dass es im 19. Jahrhundert ein Revival der christlichen Konfessionen und ihrer Traditionen – häufig in gewandelter Form und mit neu besetzten Inhalten – gegeben hat, ist allerdings weitgehend unbestritten.