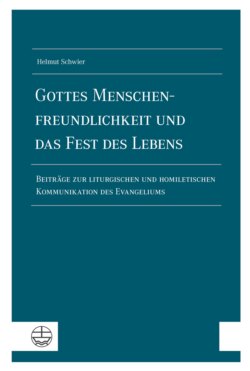Читать книгу Gottes Menschenfreundlichkeit und das Fest des Lebens - Helmut Schwier - Страница 31
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.2.1 Die Bibel als Material im Gottesdienst
ОглавлениеBiblische Worte, Metaphern und Sinnbilder prägen die Liturgie in den als Einsetzungs- oder Stiftungsworten verstandenen Berichten zu Taufe und Abendmahl, in den traditionellen Sprachformen von Vaterunser und aaronitischem Segen, im Psalmgebet, in den Wechselgesängen und Akklamationen (Kyrie, Gloria, Halleluja, Hosianna, Amen), in Worten zur Sendung (nach der Kommunion und vor dem Segen) sowie durch zahlreiche Summierungen, Auslegungen und Anspielungen im Glaubensbekenntnis, in Kirchenliedern und Gebeten (Abendmahlsgebete, Gebetsrufe in den Fürbitten), je nach Gegebenheiten auch in der Raumgestaltung. Besonders im Wortteil eines Gottesdienstes, also in der engen Verbindung von Lesung und Auslegung, sind die biblischen Texte zentral. Während in der katholischen Kirche ein alle drei Jahre sich wiederholender Lesezyklus den Wortteil bestimmt, ist in den deutschsprachigen evangelischen Kirchen ein sechsjähriger Zyklus von Lese- und Predigttexten in Gebrauch. Die beiden ersten Reihen beinhalten Zusammenstellungen der Evangelien bzw. Episteln, die bereits auf die Alte Kirche zurückgehen; in den weiteren Reihen sind in die Sammlung neutestamentlicher Texte (Reihe 3 und 5: Evangelien; Reihe 4 und 6: Episteln) auch alttestamentliche Texte eingefügt worden; außerdem liegt als siebte und achte Reihe eine Zusammenstellung von Marginaltexten und Psalmen vor, aus denen zumindest Predigttexte gewählt werden können. In der gottesdienstlichen Lesepraxis der evangelischen Landeskirchen sind ein, zwei oder drei Lesungen vorgesehen. Je nach örtlicher Tradition werden Evangelium (1. Reihe) und bzw. oder Epistel (2. Reihe), aber sehr selten AT-Texte gelesen. Als Predigttext wird der dem jeweiligen Sonntag zugeordnete Text der Reihe genommen, die für das laufende Kirchenjahr gilt. Die Predigttexte wiederholen sich also alle sechs Jahre, während die Lesungen in der Regel nur innerhalb eines Jahres variieren. Da die Lese- und Predigttextordnung von vielen als Anregung und Angebot verstanden wird, sind in der Praxis die Variationen häufiger. Wiedererkennbar sollen die Lesungen zu den hohen Festtagen sein, da sie deren biblische Grundlagen repräsentieren. Vor allem in ev.-reformierten Gemeinden sind auch Lesungen zusammenhängender biblischer Bücher, die über mehrere Sonntage verteilt sind (lectio continua), in Gebrauch. Diese Praxis ermöglicht eine stärkere Berücksichtigung des AT.
In Kasualgottesdiensten dienen die Lesungen meist der biblischen Begründung des Kasus (Taufe, Trauung, Ordination) bzw. der christlichen Hoffnung im Leben und Sterben (Bestattung); als Predigttext wird häufig ein Bibelspruch (vgl. 3.3.2) zugrunde gelegt, der persönlich ausgesucht (Tauf-, Konfirmationsoder Trauspruch) und nicht selten innerhalb einer Familie bei anderen Kasus wiederverwendet wird.13 Im Idealfall wird so gelebtes Christentum biblisch gedeutet, was sowohl Bestätigung als auch Korrektur und Horizonterweiterung beinhalten kann.