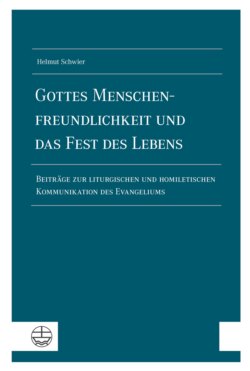Читать книгу Gottes Menschenfreundlichkeit und das Fest des Lebens - Helmut Schwier - Страница 43
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Bibelgebrauch im Unterricht
ОглавлениеDer Bibelgebrauch im schulischen Unterricht war bekanntlich seit den 1950er Jahren eng verknüpft mit den grundlegenden Konzeptionsdebatten um die Ausrichtung des Religionsunterrichtes. Kerygmatische, hermeneutische, problemorientierte und symboldidaktische Ansätze weisen der Bibel unterschiedliche Funktionen zu: Sie dient der Dialogaufnahme Gottes mit den Menschen (kerygmatisch), dem Verstehen existentieller Fragen (hermeneutisch), dem Entdecken des Problemlösungspotentials für das persönliche und gesellschaftliche Leben der Gegenwart (problemorientiert) und der Eröffnung des Zugangs zu den Tiefendimensionen des Lebens aufgrund biblischer Symbolsprache (symboldidaktisch).
Gerd Theißen hat diese vier Ansätze im Sinne einer »offenen Bibeldidaktik« weitergeführt.32 Der kerygmatische Ansatz wird religionswissenschaftlich fortgeschrieben, indem das Selbstverständnis des Christentums, in der Bibel ereigne sich Gottes Selbsterschließung, beachtet und beschrieben wird, ohne den damit gegebenen normativen Anspruch übernehmen zu müssen. Der hermeneutische Ansatz wird unter Aufnahme des Theorems des kulturellen Gedächtnisses (Jan Assmann) und einer Hermeneutik des Fremden differenziert, so dass auch hier die für jede Vermittlungsbemühung wichtige Konsequenz einer bleibenden Fremdheit zwischen Tradition und Gegenwart gezogen wird. Der problemorientierte Ansatz wird in den emanzipatorischen Anliegen bekräftigt, aber um die Dimension der Kontingenzbewältigung (Hermann Lübbe) erweitert, die existentielle und gesellschaftliche Grenzerfahrungen thematisiert. Aufgrund exegetisch-formgeschichtlicher und semiotischer Kritik wird die Geschichtlichkeit und Zeitgebundenheit biblischer Symbole stärker berücksichtigt und ihr Steuerungswert nicht nur in spirituellen, sondern auch in ethischen Fragen betont.
Insgesamt ist der Bibelgebrauch in der »offenen Bibeldidaktik« sowohl auf der Ebene der theoretischen Ansätze wie der konkreten Umsetzung in Unterrichtsvollzüge als dialogisch zu qualifizieren; gleichzeitig wird im Blick auf Lerninhalte die Forderung nach Elementarisierung erhoben, die in diesem Konzept durch das Spiel mit biblischen Axiomen und Grundmotiven, als Verkörperung des Geistes der Bibel kreativ erfolgt.33 Dialogizität und Elementarisierung sind insofern unauflöslich miteinander verknüpft, als die Axiome und Grundmotive in den interkonfessionellen, interreligiösen und säkularen Dialogen erst zu relevanter Anwendung gelangen.34 Der Bibelgebrauch hat die Diskurs und Dialogfähigkeit in der pluralistischen Welt zu fördern und wird auf diese Weise auch die gegenwärtige kulturelle Identität mitprägen.35
Der Gebrauch im konkreten Unterrichtsgeschehen wird auch durch die verwendeten Medien bestimmt. Es ist ein Unterschied, ob biblische Texte in Gestalt der – kaum noch verbreiteten – Schulbibel oder in Gestalt eines Textes auf einem kopierten Arbeitsblatt eingeführt werden. Im ersten Fall wird die wichtige Funktion, die das Buch der Bücher auch in seiner äußeren Gestalt für die christliche Religion hat, verstärkt, während ein Textblatt bereits die Aufgabenstellung kritischer Analyse evoziert. Der Zusammenhang mit dem Bibelgebrauch der christlichen Religion und Kirche kann heute eher durch zu inszenierende Rezitationen und Lesungen nahegebracht werden. Dabei hat solcher Bibelgebrauch vor allem die Aufgabe, christliche Religion in seiner Raumgestalt zu eröffnen und erfahrbar werden zu lassen.36
»Dem lauten Lesen als elementarer Gestalt von Auslegung setzen sich Zuhörende mit ihren Sinnen aus. Sie öffnen sich dem Klang und werden von seinen Schwingungen getragen. Schwebende Aufmerksamkeit auf sich selbst, auf das Körpergefühl, begleitet den Vorgang. Körperliches Wohlbehagen und Störungen beim Zuhören haben hermeneutische Signifikanz für das Gehörte. Niemand hat in der Hand, was sich tut, während er sich von einem Wortlaut tragen lässt. Innere Bilder entstehen, Klänge, Farben […] Zum Verfahren des Hörens gehört der Austausch über das Hören. Jeder hat anderes wahrgenommen, und im Wahrgenommenen teilt er sich selbst mit.«37
Dieser didaktische Gebrauch betont die Raum öffnende Kraft der sinnlich präsenten Worte und setzt aus sich heraus die Weiterarbeit in Form der Reflexion frei. Solche an den liturgischen Gebrauch angelehnte Verwendung markiert ebenso wie das Erzählen und gruppenweise Rezitationen38 den performativen Charakter biblischer Geschichten und Texte und ist vor allem als Initialphase eines Unterrichtsgeschehens denkbar. Dabei sollten die genannten differenzierten Funktionen gottesdienstlicher Lesungen Beachtung finden und didaktisch reflektiert werden.
Geht es im Religionsunterricht immer wieder um die pädagogisch verantwortete gemeinsame39 Entdeckung christlicher Religion, so versteht sich ein ästhetisch arbeitender Unterricht, z. B. mit verfremdeten und zunächst kaum entschlüsselbaren biblischen Motiven, als Anleitung zur offenen Spurensuche des Heiligen.40 Für sie ist die Verbundenheit mit der biblischen story, ihren Grundmotiven und Axiomen unverzichtbar.