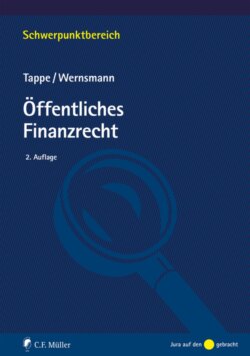Читать книгу Öffentliches Finanzrecht - Henning Tappe - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Öffentliche und private Finanzen
Оглавление4
Will man sich mit dem öffentlichen Finanzrecht befassen, liegt eine erste Schwierigkeit in der Beantwortung der Frage, unter welchen Voraussetzungen Finanzen bzw Geldmittel überhaupt öffentlich sind. Dem Geld ist nicht anzusehen, ob es zu den öffentlichen Finanzen gehört oder möglicherweise nur im Privateigentum des Staates steht. Macht es aus finanzwirtschaftlicher Sicht einen Unterschied, ob der Staat privatrechtlich handelt, also zB ein Grundstück verkauft, oder spezifisch öffentlich-rechtlich, zB Steuern erhebt? Kommt es darauf an, ob ein Angestellter im öffentlichen Dienst entlohnt wird (§ 611 Abs. 1 BGB) oder ob ein Beamter besoldet wird (§ 3 Abs. 1 BBesG)?
5
In Anlehnung an die (im allgemeinen Verwaltungsrecht herangezogene) so genannte modifizierte Subjektstheorie[5] könnte man formulieren, dass Finanzen dann öffentlich sind, wenn ein Hoheitsträger als solcher sie vereinnahmen und verausgaben kann. Damit wären Steuereinnahmen als der wesentliche Teil der staatlichen Einnahmen erfasst, denn § 3 Abs. 1 AO definiert Steuern als „Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft […]“ (Rn 213). Andere Einnahmearten (zB Veräußerungserlöse) sind aber weniger eindeutig zuzuordnen, und erst recht bei den Ausgaben würde diese Abgrenzung fraglich. Denn alle Ausgaben, bis hin zum Kauf eines Bleistifts für die Amtsstube, folgen staatlichen Aufgaben, dh sie werden zur Erfüllung staatlicher Aufgaben geleistet.
6
Für die Abgrenzung zwischen öffentlichen und privaten Finanzen ist es nicht entscheidend, ob hoheitlich gehandelt wird. Geldmittel, die wie zB Steuern hoheitlich eingenommen (einseitig auferlegt) werden[6], sind zwar schon aus diesem Grund dem öffentlichen Bereich zuzuordnen. Hoheitliches Handeln ist aber nicht notwendig, um die Finanzwirtschaft dem öffentlichen Bereich zuzuordnen und dem öffentlichen Recht zu unterwerfen.
7
Gerade die nicht hoheitlichen Tätigkeitsbereiche, das Verwaltungsprivatrecht und das fiskalische Verwaltungshandeln, sind Gegenstand des öffentlichen Haushaltsrechts, das sich auch mit dem Erwerb oder der Veräußerung von Vermögensgegenständen (zB § 63 BHO) und der Beteiligung an privatrechtlichen Unternehmen (zB § 65 BHO) befasst (Rn 664). Das öffentliche Finanzrecht findet auch dort Anwendung, wo der Staat privatrechtlich handelt[7]. Man spricht insoweit auch vom Fiskus oder der öffentlichen Hand in Abgrenzung zum Staat als Hoheitsträger.
8
Der Begriff „Fiskus“ (lat.: Korb/Geldkorb) bezeichnet den Staat als Eigentümer des Staatsvermögens. Im römischen Recht gab es neben der eigentlichen Staatskasse (aerarium populi) die kaiserliche Privatkasse (fiscus caesaris). Mit dem Übergang der republikanischen Staatsgewalt auf den Kaiser nahm auch dessen fiscus allmählich die staatlichen Einnahmen in sich auf und wurde zur neuen Staatskasse – zunächst tatsächlich, dann auch rechtlich[8].
9
Historisch wurde lange Zeit zwischen verschiedenen Sphären unterschieden[9]: Der König verfügte zB über ein privates „Hausgut“, ein privates, aber verfügungsbeschränktes „Krongut“ sowie das dem Amt zugeordnete „Reichsgut“ (Rn 41, 620). Diese Unterscheidung, die sich auch heute noch zT im kirchlichen Bereich findet („bischöflicher Stuhl“), ist für die staatliche und kommunale Ebene überholt. Im modernen Staat unterliegt das gesamte Eigentum aller staatlichen Ebenen öffentlich-rechtlichen Bindungen, insb dem öffentlichen Haushaltsrecht (Rn 519 ff, 619 ff). Sobald Geldmittel oder sonstige Vermögensgegenstände dem Staat (einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft) zugeordnet sind, auch bei einer privatrechtlichen Zuordnung des Eigentums (§ 903 BGB) zum Staat, kann man daher von öffentlichen Finanzen sprechen.
10
Mittel, die privatrechtlich verwaltet werden, können ebenfalls dem öffentlichen Finanz- bzw Haushaltsrecht unterfallen, wenn es entsprechende Anknüpfungspunkte gibt. So darf etwa der Rechnungshof auch die Haushalts- und Wirtschaftsführung von juristischen Personen des privaten Rechts prüfen, wenn diese staatliche Zuschüsse erhalten oder ein staatlicher Einfluss begründet ist (§ 104 BHO). Staatliches Eigentum ist daher hinreichendes, nicht aber notwendiges Kriterium, um öffentliches Finanzrecht anwenden zu können.
11
Zum Staat gehören dabei vor allem der Bund, die Länder und die Gemeinden (Gemeindeverbände). Aber auch die Sozialversicherung, sonstige Körperschaften des öffentlichen Rechts (KdÖR, zB Kammern, Universitäten) und Anstalten des öffentlichen Rechts (AöR, zB Rundfunkanstalten) wirtschaften nach den Regeln des öffentlichen Finanzrechts, ebenso die EU und deren Institutionen (Rn 792), für die auf europäischer Ebene finanzrechtliche Regelungen bestehen.
12
Häufig finden sich insb für kleinere Einheiten rechtliche Vorgaben, die sich denjenigen des privaten Sektors annähern, wenn diese Gebilde wirtschaftlich nach kaufmännischen Grundsätzen geführt werden sollen. So orientiert sich zB das Rechnungswesen der Gemeinden (kommunale Doppik, Rn 1078) an den Regelungen des für Kaufleute geltenden HGB (§§ 238 ff HGB). Bei formeller Privatisierung, dh der Verwendung privatrechtlicher Organisationsformen zur Erfüllung staatlicher Aufgaben, finden privates Recht (zB GmbHG, AktG, HGB) und öffentliches Recht auch nebeneinander Anwendung.