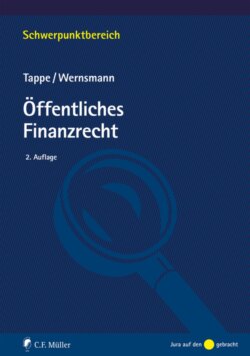Читать книгу Öffentliches Finanzrecht - Henning Tappe - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II. Geschichtliche Entwicklung des Finanzrechts
Оглавление41
In ihrem Ursprung unterscheidet sich die öffentliche Finanzwirtschaft kaum von der privaten. Zwar wurden schon früh öffentliches (zB der ager publicus oder die Allmende) und privates Eigentum unterschieden. Dennoch unterlag die Bewirtschaftung des „Haushalts“ eines Königs oder Fürsten den gleichen Regeln der ökonomischen Klugheit wie die Haushaltsführung anderer Familien – so sie denn Grundbesitzer und nicht Grund- oder Leibeigene waren. Auch die Finanzwissenschaft war im Ursprung eine privatwirtschaftlich orientierte Disziplin[38].
42
In der Antike ist das Finanzwesen zeitweise schon ein eigener Verwaltungsbereich. Zu Beginn der römischen Kaiserzeit wird, wie die biblische Weihnachtsgeschichte berichtet[39], die Steuererhebung unter Leitung der Prokuratoren professionalisiert, und auch die Ausgaben werden bereits geplant (zB wurden im 2. Jhdt. für eine Meile der zu erneuernden via appia rd 100.000 Sesterzen veranschlagt[40]). Mit dem Untergang des römischen Reiches lösen sich diese Verwaltungsstrukturen weitgehend wieder auf.
43
In den frühen agrarisch geprägten Gesellschaften war Grund und Boden die wesentliche (nahezu einzige) Einnahmequelle. Auch der Staat, in Person des Landesherrn, erwirtschaftete seine Einnahmen daraus – teils unmittelbar durch Land- und Forstwirtschaft, teils durch das Verleihen des Grundbesitzes („Lehen“). Der Lehnsmann (Vasall) schuldete dafür Hilfe und Rat (auxilium et consilium). Die Hilfe, das auxilium, bezog sich neben Naturalabgaben im Wesentlichen auf den Kriegsdienst[41], der zum Teil auch durch Ausgleichsabgaben (sog. Schildgeld) abgegolten werden konnte.
44
Grds hatte der Herrscher die (im Vergleich zu heutigen Staaten wenigen) Aufgaben, die ihm in dieser Rolle zufielen, aus seinem eigenen Besitz (Domäne, Krongut, Kammergut) zu finanzieren. In besonderen Notsituationen konnte der König jedoch die Stände um finanzielle Unterstützung durch spezielle Abgaben bitten[42]. Dieses Recht auf Hilfe wurde in der Folge zunehmend institutionalisiert. Die englische Magna Charta bindet Schildgeld (scutagium) und Hilfe (auxilium) im Jahr 1215 an konkrete formelle und materielle Voraussetzungen[43]; auf deutschem Gebiet lassen sich ab dem 13. Jhdt. „Bedeverträge“ nachweisen, die anerkannte Notfälle definierten[44] und aus denen sich das Steuerbewilligungsrecht der Stände entwickelte[45].
45
Diese Entwicklung ist allerdings keine lineare. Mit dem Wiedererstarken des Absolutismus v.a. in den größeren Ländern wird zB in Brandenburg-Preußen unter Friedrich Wilhelm I. die ständische Steuerbewilligung zur Formsache[46]. Im Preußischen Allgemeinen Landrecht von 1794 ist die Steuererhebung dann formal zum „Majestätsrecht“ geworden, das keiner ständischen Bewilligung mehr bedarf (§ 15 II 13 PrALR)[47].
46
Im 19. Jhdt. bildete sich das Steuerbewilligungsrecht der alten Landstände um zu den finanziellen Befugnissen der Landtage. Die frühkonstitutionellen Verfassungen, die zu Beginn des 19. Jhdts. in den deutschen Ländern eingeführt wurden, gestanden – nach dem Vorbild der französischen Verfassungen – den Landtagen auch das Recht zur Beratung der Ausgaben zu, für die diese Steuern verlangt wurden.[48] Da diese Beratung in regelmäßigen Zeitabständen wiederkehrte, besaßen die Landstände ab diesem Zeitpunkt tatsächlich das Budgetrecht[49]. Die sog. „Finanz-“ oder „Auflagengesetze“ des frühen 19. Jhdts. wiesen insoweit schon durchaus Ähnlichkeiten mit den modernen Haushaltsgesetzen auf. Ihnen gingen Haushaltsberatungen voraus und sie mussten, wie die Haushaltsgesetze der Gegenwart, periodisch erneuert werden[50].
47
Aus dieser Zeit stammt auch das sog. Bepackungsverbot (Rn 526), mit dem ein Übergreifen des Haushaltsgesetzgebers auf andere Politikbereiche verhindert werden sollte. Es ist in seiner Entstehung zurückzuführen auf die im Frühkonstitutionalismus für notwendig gehaltene Machtbalance zwischen dem regierenden Monarchen und den nach Einfluss strebenden Volksvertretungen, denen (nur) das Steuerbewilligungs- und Budgetrecht zustand[51]. Der historische Zweck, der monarchischen Regierung keine „Bedingungen“ aufzuerlegen, die mit der Bewilligung von Ausgaben (durch das Parlament) verbunden waren, ist in der parlamentarischen Demokratie überholt.[52]
48
Einen Höhepunkt des über den Haushalt ausgetragenen Machtkampfs zwischen Volksvertretung und König bildete in den Jahren 1862–1866 der preußische Budgetkonflikt. Hier regierte die preußische Staatsregierung unter Wilhelm I. und Bismarck ohne einen gesetzlich festgestellten Haushaltsplan auf der Grundlage der immer wieder vom Abgeordnetenhaus abgelehnten Haushaltsgesetzentwürfe[53]. Aufgrund der damals vertretenen sog. „Lückentheorie“[54] war, weil sich in der Verfassung keine ausdrückliche Regelung für diesen Fall fand, der König bzw die Regierung zu verbindlichem Handeln berufen, wenn das Haushaltsgesetz nicht zustande kam.
49
Aus diesem politischen Streit, der sich ähnlich auch in anderen deutschen Staaten zugetragen hatte[55], leitet sich ua der rechtliche Streit um die Rechtsnatur des Haushaltsplans ab (Rn 525 f). Sah man im Haushaltsplan ein nur formelles Gesetz, das nicht in „Freiheit und Eigentum der Bürger“[56] eingriff (= materielles Gesetz), sondern als Akt der Verwaltung[57] nur kraft ausdrücklicher verfassungsrechtlicher Anordnung (Art. 99 Abs. 2 PrVerfU 1850) in die Form eines Gesetzes gekleidet wurde, so war die gesetzliche Feststellung die staatsrechtliche Ausnahme von der Regel der Kompetenz des Monarchen. Wenn die Verfassung also im Zusammenhang mit dem Budgetrecht eine „Lücke“ aufwies, etwa weil sie keine Bestimmung für den Fall vorsah, dass der Haushalt nicht rechtzeitig verabschiedet wurde, war nicht das Parlament, sondern die Regierung (des Königs) zum Handeln berufen[58].
50
Bis heute kann man in präsidentiellen Regierungssystemen ähnliche Konflikte beobachten. So hat zB in den USA der Präsident zwar weitreichende Kompetenzen, auch im Bereich der Gesetzgebung. Weigert sich aber der Kongress, den Haushalt zu verabschieden oder die Aufnahme neuer Schulden zu genehmigen, kann es – wie zB im Jahr 2018 – zu einem „federal government shutdown“[59] kommen, bei dem die Handlungsfähigkeit staatlicher Institutionen eingeschränkt ist[60].
51
Eine der ältesten finanzrechtlichen Abhandlungen ist der Anfang des 12. Jhdts. in lateinischer Sprache erschienene „Dialog über das Schatzamt“, verfasst vom Schatzmeister des englischen Königs Heinrich II., Richard von Ely[61]. In Deutschland findet man Finanzpläne etwa seit dem 15. Jhdt. Erhalten ist zB der in Preußen zu Beginn der Regierung des Kurfürsten Friedrich III. im Jahre 1688 aufgestellte „General-Etat aller Domäneneinkünfte und -ausgaben“[62].
Einführung › § 1 Grundlagen › III. Rechtsquellen des Finanzrechts