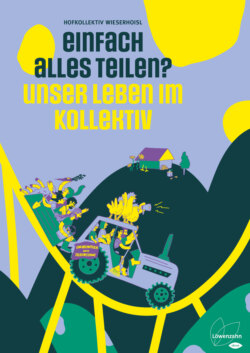Читать книгу Einfach alles teilen? - Hofkollektiv Wieserhoisl - Страница 26
Wir werden nicht die Letzten sein – von Hintergründen, Pionier*innen, Abenteurer*innen und unseren Vorbildern
ОглавлениеBevor wir uns hineinstürzen in all das, was am Wieserhoisl so vor sich geht, lass uns doch einen Blick auf die Ideengeschichte hinter dem Konzept des kollektiven Lebens und Arbeitens werfen. Woraus hat sich die Idee entwickelt, welche wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Entwicklungen und Standpunkte stecken dahinter? Hier findest du ganz viele Hintergrundinfos zum Kollektivgedanken, zur alternativen Ökonomie und darüber, wie wichtig es ist, sich untereinander zu vernetzen. Alles klar? Dann lass uns loslegen.
Alternative Formen des Lebens, Arbeitens, Wirtschaftens, fernab von traditionell-bürgerlichen Vorstellungen, entstanden insbesondere innerhalb der Gegenkulturen und Alternativbewegungen in Folge der 1968er-Proteste. Klar, alternative Vorstellungen in Bezug auf die Organisation von Gesellschaft und damit auch von Staat und Wirtschaft gibt es seit Urzeiten: von Platon, der an die Spitze seines utopischen Staates die Philosophen setzte, bis zu den Gesellschaftstheoretiker*innen des 19. Jahrhunderts, die sich Bilder eines gerechten Idealstaates ausmalten, in dem der Kollektivbesitz eine tragende Rolle spielt. In diesen Vorstellungen findet eine Umwälzung der gesamten Gesellschaft statt.
Der Kollektivgedanke, der aus der 68er-Bewegung (für nähere Infos schau auf Seite 36) entstanden ist, beginnt zunächst in der Gruppe, quasi eine andere Form der Familie, die unabhängig von Verwandtschaftsverhältnissen zusammenfindet. Er ist eng mit der Herausbildung der Graswurzelbewegungen verbunden; viele damals neu entstandenen Bürger*inneninitiativen agierten nach dem Motto: „Global denken, lokal handeln.“ Die Idee ist es, in diesem Mikrokosmos die Vorstellungen von Gleichheit, Fairness und Solidarität zu erproben. Und in der Folge die eigene Vision in die Welt zu tragen und anderen zu zeigen, dass es alternative Wege gibt. Heute ist der Kollektivgedanke vielerorts bereits in Unternehmen, Projekten und sogar Wirtschaftssystemen durchgedrungen (schau auf Seite 38).
› Ein Zusammenspiel: Welche Entwicklungen in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft sorgten eigentlich für die Herausbildung des Kollektivwesens? Wir nähern uns dem Gedanken hier spielerisch.
Dabei stehen Kollektive in ständigem Konflikt mit realpolitischen Gegebenheiten und institutionellen Hürden, was unter anderem die Frage des Besitzes verdeutlicht (mehr dazu findest du auf Seite 172). Wir sind uns natürlich bewusst, dass wir im weltweiten Vergleich zu den privilegiertesten Menschen zählen; dass wir die Möglichkeit haben, unsere Freiheiten auszuleben – eine Möglichkeit, die viele nicht haben. Aber letztlich sind es ja auch genau solche Missstände und Unfreiheiten, die wir anprangern möchten. Wir stellen die Kehrseiten unseres spätkapitalistischen Zeitalters massiv infrage. Wir wollen daran rütteln, die Fesseln der modernen Gesellschaft aufbrechen und in Richtung eines solidarischen Miteinanders gehen (mehr zu unserer Vision erzählen wir dir ab Seite 54).