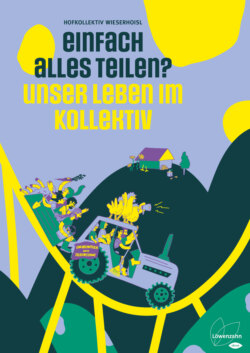Читать книгу Einfach alles teilen? - Hofkollektiv Wieserhoisl - Страница 31
Peace, Love, Happiness? Die 1968er-Bewegung und ihre Nachwirkungen
ОглавлениеMit diesen Hintergründen im Blick kann mensch auch die Ereignisse Mitte des 20. Jahrhunderts rund um die Gegenkulturen bewerten. Nach ihrer kurzen Blütezeit im Nachkriegs-Wiederaufbau beginnt die Wirtschaft wieder zu kriseln. Mit der Bildungsexpansion erlangen viel mehr Menschen eine höhere Ausbildung. Die Dekolonisation schreitet voran, der allgemeine Blick für Diskriminierung wird geschärft. Die beginnende Wirtschaftskrise, die vielen globalen Kriege und Auseinandersetzungen, die gesellschaftliche Ungleichheit fordern ihren Tribut und gipfeln in den heute grob als 1968er-Bewegung zusammengefassten weltweiten Protesten, die später in die sogenannten „Neuen Alternativbewegungen“ münden.
Die Ausrichtungen einzelner Initiativen und Gruppierungen unterscheiden sich dabei mal mehr, mal weniger stark. Manche richten sich primär gegen die Diskriminierung von marginalisierten Gruppen, andere wollen Aufmerksamkeit für ökologische Probleme und Umweltschutz schaffen und demonstrieren beispielsweise gegen die Atomenergie. Pazifistische Bewegungen wollen Kriegen und Gewalt eine Absage erteilen. Die von den USA ausgehende Hippiebewegung mit ihrer Antikriegs-, Antiautoritäts- und Antirassismus-Haltung leistete der Sexuellen Revolution Vorschub und beeinflusste nicht zuletzt die Mainstreamkultur sehr stark. Das Wohnen, steigende Mietpreise, Wohnungsnot, Leerstand und Spekulation wurden ebenfalls thematisiert; am bekanntesten wohl in der Hausbesetzer-Bewegung. Auch die gegenwärtige LGBTQ-Bewegung findet ihre Wurzeln in dieser Zeit. Auf nationaler Ebene lassen sich die Nachwirkungen der Öko-, Frauen- und Friedensbewegungen anhand von neuen Parteibildungen fernab der etablierten konservativen/christdemokratischen und sozialdemokratischen Parteien feststellen; so entstanden in den 1980er-Jahren in ganz Europa die neuen „grünen“ Parteien.
All diesen Bewegungen gemeinsam ist der Gedanke, das starre, konservative und als destruktiv empfundene Wirtschafts-, Werte- und Sozialsystem zu revolutionieren. Sie sind überzeugt, dass die wirtschaftliche Wachstumslogik nicht von Dauer sein kann, richten sich gegen die Ausbeutung unseres Planeten und gegen Unterdrückungen jeglicher Art. Dementsprechend können auch heutige Initiativen, die ökologisch motiviert sind oder die sich für Gleichheit und Gleichberechtigung einsetzen, oft noch auf diese Ursprungsbewegungen zurückgeführt werden.
– was heißt das eigentlich?
Unter dem Begriff „Kollektiv“ können gemeinhin verschiedene Gruppierungen von Menschen subsumiert werden. Seiner reinen Bedeutung nach kann es also in einem ersten Schritt schon einmal als Gegenentwurf zum „Individuum“ aufgefasst werden. Das ist auch insofern wichtig, als im Kollektiv nicht die individuellen, sondern die gemeinsamen Interessen im Vordergrund stehen.
In dem Verständnis, wie wir es hier nutzen, fallen darunter vor allem organisierte und handlungsorientierte Gemeinschaften. Sie finden mit einem bestimmten Vorhaben, etwa einem sozial, politisch oder ökologisch motivierten oder gemeinwohlorientierten Ziel, zusammen. Dabei gibt es verschiedene Rechts- und Organisationsformen (abhängig natürlich auch von der jeweiligen Rechtsordnung). Nonprofit-Kollektive können etwa als Vereine oder NGOs organisiert sein. Daneben finden sich auch erwerbswirtschaftlich orientierte Kollektive, die als Genossenschaften oder Kooperativen organisiert sein können.
Es gibt Grundprinzipien, an denen sich viele bzw. die meisten Kollektive orientieren. (Näheres zu unseren Visionen und Prinzipien erfährst du ab Seite 54.) Für einen ersten Überblick fassen wir sie dir hier zusammen:
SELBSTVERWALTUNG / SELBSTORGANISATION:
Kollektive werden von ihren Mitgliedern geführt – die im Falle von Betrieben auch gleichzeitig ihre Eigentümer*innen sind.
HIERARCHIEFREIHEIT:
Es gibt kein Oberhaupt und keine Untergebenen, keine*n Geschäftsführer*in und keine Angestellten, alle sind Mitglieder auf der gleichen Ebene.
BASISDEMOKRATIE:
Alle haben das gleiche Stimmrecht und entscheiden direkt (im Gegensatz zur repräsentativen Demokratie, wie sie in vielen Staaten verankert ist, wobei Repräsentant*innen vom Volk gewählt werden).
KONSENSPRINZIP:
Entscheidungen werden in vollständigem Einklang getroffen. Also: Es wird so lange konzipiert und diskutiert, bis eine passende Lösung für alle gefunden wird (im Gegensatz zum Mehrheitsprinzip, nach dem die meisten öffentlichen Wahlen funktionieren und bei dem immer eine Minderheit auf der Strecke bleibt).
KONSENTPRINZIP:
Alternative zum Konsensprinzip. Bei Entscheidungen gibt es keinen schwerwiegenden oder begründeten Einwand. Widersprüche und Einwände sind Teil der Lösung. Abstimmungen verlaufen effizienter und es werden qualitativ bessere Entscheidungen getroffen.
SOLIDARITÄT:
Kollektivmitglieder stehen füreinander ein, verfolgen Gemeinwohl-Ziele, Kollektive unterstützen sich gegenseitig.
GLEICHHEIT:
Jeder Mensch ist gleich viel wert und hat dieselben Rechte. Immer und überall.