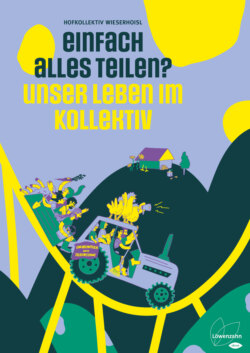Читать книгу Einfach alles teilen? - Hofkollektiv Wieserhoisl - Страница 33
Abseits von Profitgier und Konkurrenzkampf: Solidarische Ökonomie und Kollektivbetriebe
ОглавлениеUnd genau da kann der Kollektivgedanke, in einem größeren Umfang, als wir ihn uns bisher vorgestellt haben, greifen. Und zwar dann, wenn Kollektive als Organisationsformen verstanden werden, die das Potenzial haben, die Wirtschaft und das Arbeitsleben zu demokratisieren. Es gibt heute bereits vielerorts selbstorganisierte Kollektivbetriebe, die nach den Prinzipien der Hierarchiefreiheit, Solidarität und Gemeinschaftlichkeit wirtschaften.
Ein wichtiger theoretischer Hintergrund in dieser Hinsicht ist die Idee einer „Alternativen Ökonomie“ bzw. „Solidarischen Ökonomie“. Im Gegensatz zum vorherrschenden privatwirtschaftlich-industriellen Wirtschaftsmodell, das auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist, befürworten Kollektive kleiner strukturierte, selbstorganisierte Unternehmensformen, die auf gemeinsamem Eigentum und einem egalitären Gehaltssystem basieren. Damit verbunden sind z. B. die Stärkung lokaler Wirtschaftskreisläufe und eines regionalen Absatzmarktes sowie teilweise auch ein Fokus auf umweltfreundliche Produktionsweisen.
Wenn ein Unternehmen statt einem*einer Eigentümer*in allen gehört, wenn alle die Gewinne teilen und die Risiken gemeinsam tragen, wenn Entscheidungsprozesse gleichberechtigt und im Konsens erfolgen – das hat enormes Potenzial.
Ein erfolgreiches Beispiel für die Umsetzung von Solidarischer Ökonomie stellt beispielsweise Brasilien dar. Als Staatssekretär für Solidarische Ökonomie half der Ökonom Paul Singer3 dabei, diese umzusetzen. Nach einer massiven Wirtschaftskrise in den 1980er-Jahren drohten viele privat geführte Unternehmen in Konkurs zu gehen. Indem sie in kollektiv verwaltete Genossenschaften, in denen die Mitarbeiter*innen gleichzeitig Eigentümer*innen sind, überführt wurden, hatten sie eine Chance, zu überleben.
Diese Praxis der Umwandlung von Betrieben in Genossenschaften gibt es nach wie vor, und sie wird von staatlicher und gewerkschaftlicher Seite unterstützt. Dabei stehen die einzelnen Genossenschaften nicht in Konkurrenz, sondern kooperieren miteinander. Zusätzlich wurden zahlreiche Gemeindebanken gegründet, die genauso im Besitz der Einwohner*innen stehen. Mithilfe eigener Währungen wird versucht, das Geld in regionalen Wirtschaftskreisläufen zu halten. Das Beispiel von Brasilien zeigt, dass eine solche Herangehensweise eine große Chance zur Bekämpfung von Armut bietet.