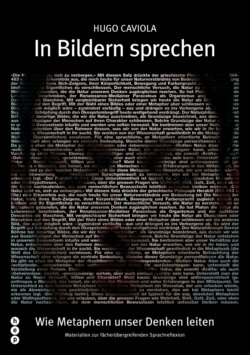Читать книгу In Bildern sprechen - Hugo Caviola - Страница 13
a. Die Substitutions- und Vergleichstheorie
ОглавлениеArtistoteles, der Begründer der Substitutionstheorie, nennt die Metapher «die Übertragung eines fremden Nomens». Er versteht darunter die Übertragung eines Wortes, das «eigentlich» an eine andere lexikalische Stelle gehört. Ein Beispiel: «Das Alter, der Abend des Lebens». Die metaphorische Übertragung folgt Analogie- oder Ähnlichkeitsrelationen: So wie sich das Alter zum Leben verhält, so verhält sich der Abend zum Tag.
Metapher als Störung der sprachlichen Ordnung
Nach Aristoteles drückt die Metapher eine «Störung der sprachlichen Ordnung» aus. In dieser Störung aber bringt sie die Erkenntnis einer Verwandtschaft der Dinge zum Ausdruck (Kurz 1988, S. 11). Aristoteles unterstellt, dass das, was die Metapher sagt, auch direkt gesagt werden könne, die metaphorische Aussage also ohne Verlust paraphrasierbar sei. Beispiel: «Achill ist ein Löwe». Der Lüge und dem Spiel verwandt, gilt die Metapher vor allem als Mittel der poetischen und persuasiven Rede.
Metapher als verkürzter Vergleich
Bei Quintilian finden wir die Metapher als verkürzten Vergleich. Anders als in einem ausformulierten Vergleich fehlt hier die Angabe des Tertium comparationis, dessen, was den verschiedenen Gegenständen gemeinsam sein soll. Die Metapher «Der Mensch ist ein Wolf» ergibt dann einen Sinn, wenn gemeinsame Merkmale von Mensch und Wolf wie Bösartigkeit und Hinterlist erkannt werden. Die Ähnlichkeitsrelation bleibt aber in der Metapher implizit, ihr Erkennen dem subjektiven Verstehensakt überlassen. Die Vergleichstheorie ist insofern ein Sonderfall der Substitutionstheorie, als sie suggeriert, dass die metaphorische Aussage durch einen wörtlichen Vergleich ersetzt werden könne.
Die aristotelische Substitutionstheorie begründet eine bis heute wirksame Tradition, wonach Metaphern vor allem dem ästhetischen oder persuasiven Gebrauch angehören. In der Substitutionstheorie sind Wörter Etiketten für Dinge, deren Unterscheidung in einer vorsprachlichen Ordnung begründet liegt. Dieser alltagslogische Realismus ist bei Lernenden verbreitet. Metaphernreflexion kann (und soll) ihn hinterfragen und Lernenden die Sprache als Denk- und Erkenntnismittel erschliessen.
Die Substitutionstheorie unterscheidet zwischen wörtlichem und metaphorischem Sprachgebrauch. (Beispiel: «Achill ist ein Löwe» = metaphorisch; «Achill ist mutig» = wörtlich.) Diese Unterscheidung ist auch im didaktischen Zusammenhang möglich. Die «wörtliche» Bedeutung der Begriffe ist aber nach heutigem Verständnis nicht wie bei Aristoteles in einer vorsprachlichen Ordnung begründet. Seit Saussure werden sprachliche Zeichen als arbiträr und konventionell beschrieben. Die «wörtliche» Bedeutung ist durch den Gebrauch in der Sprachgemeinschaft festgelegt und im Lexikon fixiert.