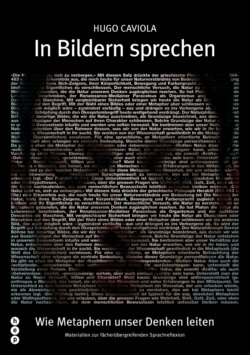Читать книгу In Bildern sprechen - Hugo Caviola - Страница 20
Theoriekonstitutive Funktion
ОглавлениеMetaphern als Grundbestände der Sprache
Manche modellbildenden Metaphern werden später Teil von Theorien. Theorien sind geordnete Satzsysteme, die das Wissen in einem Gegenstandsbereich zusammenfassend darstellen, um es lehren und lernen zu können (Janich u. Weingarten 1999, S. 84). Als theoriekonstitutive Metaphern gelten im Sinne Blumenbergs «Grundbestände der Sprache» (Blumenberg 1960, S. 288f.), d.h. fundamentale oder absolute Metaphern, die nicht ersetzbar sind, weil sie die «Leitdifferenz» setzen, unter der eine Theorie gedacht wird (Debatin 1996, S. 87). Diese liegt vor, wenn neue Gegenstandsbereiche auf paradigmatische Weise durch Metaphern erschlossen werden. Besondere Beachtung gefunden haben zum Beispiel die Computermetaphern in der Psychologie und Kognitionswissenschaft (Gehirn als informationsverarbeitendes Netzwerk), die Planetenbahnmetapher im Bohr’schen Atommodell (Elektronen kreisen um den Atomkern) oder die Kampfmetapher im Darwinismus («struggle for existence»). Solche Metaphern können durch ihre Implikationen weitere Forschungsfragen aus sich herausspinnen. Beispiel: Das Gehirn ist ein Computer. Folgefragen: Wie und wo werden im Gehirn Informationen gespeichert? Kann sich das Gehirn selbst programmieren? Wie sind die verschiedenen Gehirnregionen miteinander vernetzt?
Fachbegriffe können zu Dogmen werden
Hat eine wissenschaftliche Metapher die in einer Wissenschaft gängigen Methoden der Rechtfertigung (z.B. experimentelle Prüfung, Integration in eine Theorie, Anerkennung in der wissenschaftlichen Gemeinschaft) durchlaufen, «stirbt» sie und kann so zum Fachbegriff avancieren. Sie wird normiert und geht in Schul- und Handbücher ein. Im Laufe dieses Vorgangs kann sie auch zum Dogma werden. Dies ist dann der Fall, wenn vergessen geht, dass sich ein Begriff metaphorischen Vermittlungen verdankt und keinen theorieunabhängigen Zugang zur Wirklichkeit garantiert, wie dies Alltagsbegriffe wie etwa Tisch oder Baum tun.
Metaphern in der Wissenschaft sind letztlich unüberwindbar
Die Metaphorizität eines wissenschaftlichen Terminus bleibt aber auch dann noch bewahrt, wenn er auf Fakten verweist. Die im Anwendungsbereich gewonnenen Erkenntnisse bleiben gebunden an die mit der Metapher ursprünglich eingeführte Hypothese. Dass Metaphern im Spiel sind, wird zum Beispiel dann deutlich, wenn es konkurrierende Begriffe gibt, wie etwa in der Mikrophysik des Lichts das Nebeneinander der Begriffe «Welle» und «Partikel» zeigt. Dass Metaphern in der Wissenschaft letztlich unüberwindbar sind, ist auch daraus ersichtlich, dass sich die Wissenschaftssprache immer wieder durch metaphorischen Gebrauch ausdehnen und umorientieren muss, soll der wissenschaftliche Prozess nicht zum Stillstand kommen (Bühl 1984, S. 147).