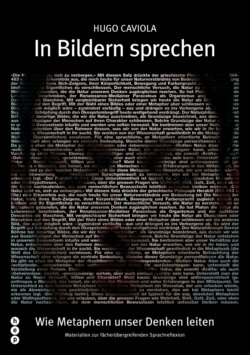Читать книгу In Bildern sprechen - Hugo Caviola - Страница 8
Fächerübergreifendes Denken durch Metaphernreflexion: Einleitendes zur Methode 1. Metaphernreflexion im gymnasialen Deutschunterricht
ОглавлениеLiest man Lehrbücher des Sachunterrichts mit sprachkritischem Blick, so tritt man in eine Welt der Metaphern ein: Da finden wir etwa in der Biologie «Stoffkreisläufe» und «Energieflüsse», «Nahrungsketten», ökologische «Nischen» und «Netze». Zellen sind «Grundbausteine», Gene «Texte», und die Geschichte des Lebens wird im Bild des Stammbaumes dargestellt. Im Wirtschaftslehrbuch stösst man auf Metaphern wie «Wachstum» und «Strategie», «Marktanteile», «Geldflüsse» und «Steuerfüsse»; Unternehmen sind «Schiffe», «Pflanzen» oder «Maschinen». Auch die Informatik baut ihre zentralen Begriffe auf Metaphern. Man denke nur an ihre «Netze», «Speicher» und «Viren».
Metaphernblindheit im Sachunterricht
Die Fähigkeit der Metapher, Ungegenständlichem plastische Gestalt zu verleihen, macht sie in allen abstrakten Sinnbereichen unverzichtbar. Beim Lesen von Sachtexten aber erweisen sich Lernende (und nicht nur sie!) als weitgehend blind für Metaphern. Durch häufigen Gebrauch verblassen Metaphern und geben einen trügerisch direkten Blick frei auf die Dinge. Diese Metaphernblindheit im Sachunterricht widerspiegelt die traditionelle Ausrichtung der schulischen Sprachbetrachtung. Der Deutschunterricht beschränkt sich meist auf die literarischen Aspekte der Metapher. Seltener gelangt auch die manipulative Funktion metaphorischer Rede, etwa in der politischen Rhetorik oder der Werbung, ins Blickfeld der Sprachbetrachtung.
Metaphernreflexion als Zugang zum fächerübergreifenden Denken
Dieses Lehrmittel geht über diese angestammte Wertung der Metapher hinaus. Es macht Lernende mit ihrer kognitiven, Erkenntnis schaffenden und lenkenden Funktion vertraut, wie sie in der Alltagssprache und in der Wissenschaft wirkt. Fachsprachenforschung, Wissenschaftsphilosophie und -soziologie der letzten Jahrzehnte haben der Einsicht Geltung verschafft, dass Metaphern für den Aufbau und die Vermittlung von Wissen unverzichtbar sind (Blumenberg 1971, Bono 1990, Danneberg 1995, Debatin 1996, Hesse 1995, Niederhauser 1995, Maasen u. Weingart 2000, Liebert 2002). Metaphernreflexion, wie sie dieses Lehrmittel vorschlägt, schliesst an diese Erkenntnisse an. Sie richtet sich auf nicht-literarische Metaphern und betrachtet diese, als ob sie literarische, also deutungsbedürftige rhetorische Figuren wären (z.B. Gedächtnis als Speicher, Gen als Text). Indirekt eröffnet sie damit auch einen Zugang zum fächerübergreifenden Denken.
Sprachkritik als Ideologiekritik und als Hermeneutik der Fachsprachen
Metaphernreflexion dieser Art hat ihren Ort im Deutsch- oder Philosophieunterricht. Sie verfährt interdisziplinär, indem sie die geisteswissenschaftliche Methode der Sprachbetrachtung (Hermeneutik) auf Sachtexte und Alltagsfelder ausdehnt, die gewöhnlich von sprach- und ideologiekritischer Betrachtung ausgeschlossen bleiben.
Diese Ausweitung der Zuständigkeit des Fachs Deutsch (und Philosophie) kann bei Lernenden zunächst Irritation und Widerstand auslösen, der kulturell eingespielte Wahrnehmungsgewohnheiten zum Ausdruck bringt («Was haben Sachtexte im Sprachfach zu suchen?»). Ihre Überwindung aber gewinnt in der Metaphernreflexion ein Verfahren, das auf alle Fachsprachen übertragbar ist. Im Unterschied zu anderen Formen des fächerübergreifenden Unterrichts, etwa dem Projektunterricht oder dem Teamteaching, bedarf Metaphernreflexion keiner besonderen schulischen Organisationsformen (obwohl Teamteaching von Fall zu Fall als Ergänzung möglich ist). Ihre Interdisziplinarität ist vorab Interdisziplinarität «im Kopf».