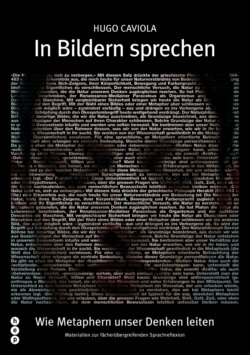Читать книгу In Bildern sprechen - Hugo Caviola - Страница 9
2. Metaphern schlagen Brücken und erhellen das Disziplinendenken a. Analogien erkennen
ОглавлениеMetaphern sind diskursübergreifend
Metaphern schlagen Brücken zwischen Gegenstandsbereichen, die im gewohnten Sprachgebrauch getrennten Kategorien angehören, aber durch Ähnlichkeits- oder Analogiebezüge verbunden sind. Beispiele: «Das Vermögen wächst» verbindet Geld mit der Welt der Pflanzen, die Standardmetapher «Der Mensch ist ein Wolf» schlägt eine Brücke zwischen Mensch und Tier. Metaphernreflexion folgt der Übertragungsfunktion, die der Metapher ihren Namen verleiht (metaphorá geht zurück auf: metá=herüber und phérein=tragen). Der bewusste Umgang mit Metaphern leitet Lernende dazu an, Analogien zwischen getrennten Wissensgebieten zu erkennen, aber auch die Unterschiede zwischen ihnen (Dysanalogien) wahrzunehmen.
Metaphernreflexion eröffnet einen anderen Umgang mit Begriffen, als ihn die auf Aristoteles zurückgehende Begriffslogik vorgibt, die für die neuzeitliche Wissensform bestimmend ist (Satz der Identität, Satz des auszuschliessenden Widerspruchs und Satz vom ausgeschlossenen Dritten). Während die neuzeitliche Wissenschaft distinkte Gegenstände festhält (z.B. Tiere, Pflanzen, Menschen, Steine) und sie nach Gattungen, Arten, Unterarten etc. ordnet – und damit auch für die Ausbildung von Disziplinen verantwortlich ist – vollzieht das Analogiedenken die Zuordnung quer durch die Gattungen bzw. Arten, indem sie ihre Ähnlichkeiten festhält. Analogiedenken ist heute nicht nur in der Sprachform der Metapher präsent, es hat sich in den letzten Jahrzehnten auch in der Theorie der fuzzy logic (Mengenlehre) und der Selbstähnlichkeit (Fraktale in der Mathematik und Physik) etabliert, ebenso wie in der Mehrweltentheorie der Quantenphysik (Licht besitzt sowohl Teilchen- als auch Wellennatur) (Gloy 2001).
Anleitung zum «analogen und vernetzten Denken»
Schulische Sprachreflexion bietet eine Chance, die «kalkulierte Absurdität» der Metapher zu durchschauen und eine «geregelte Identifikation von Verschiedenem» zu erlernen (Gloy 2001, S. 323). Sie nimmt damit die Ansprüche des heutigen Bildungswesens auf, die, wie z.B. das Schweizerische Maturitätsreglement (MAR 5.2.), eine Schulung des «analogen und vernetzen Denkens» fordern.