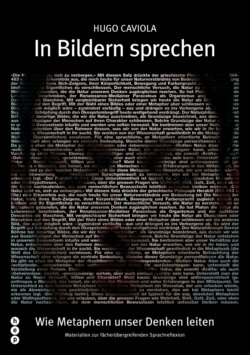Читать книгу In Bildern sprechen - Hugo Caviola - Страница 6
ОглавлениеDer Stellenwert dieses Lehrmittels und die Frage der Interdisziplinarität
Prof. Dr. Anton Hügli
Präsident der Schweizerischen Maturitätskommission (2001–2008)
Warum gerade Metaphern? Und warum dazu gleich noch ein Lehrmittel? Als Spielwiese für unterbeschäftigte Germanisten? Die Antwort – bezogen auf den Sprachunterricht – gibt dieses Lehrmittel gleich selbst, in der lesenswerten Einleitung. Welche Bedeutung ihm für den gymnasialen Unterricht generell zukommt, sei hier – anhand des Stichworts «Interdisziplinarität» – kurz verdeutlicht.
Kaum eine Forderung des neuen Maturitätsreglements 1995 stösst auf derart grossen Widerstand wie die in § 5, Absatz 2 eingeklagte «Übung im vernetzten Denken» und keine Frage auf so grosse Ratlosigkeit wie die, was denn nun eigentlich Interdisziplinarität bedeute und wie sie zu realisieren sei.
Die Ratlosigkeit zeigt sich bereits in dem Wirrwarr der Termini und Begriffe, von der Trans- und Inter- über die Multi- bis hin zur Pluridisziplinarität. Ihre Hauptquelle aber liegt darin, dass von Interdisziplinarität in verschiedensten Kontexten die Rede ist und diese Kontexte immer wieder vermengt werden. Interdisziplinarität im Kontext der Forschung ist zweifellos eine andere als die Frage, wie Schule und Unterricht organisiert werden sollen, damit die Fächer oder, genauer, die Fachlehrkräfte miteinander kooperieren. Der schulorganisatorische Kontext wiederum ist ein anderer als der, auf den es am Ende wohl ankäme: die inhaltliche Frage, wie die fachlichen Termini, Begriffe und Theoreme sich in den Köpfen der Lernenden miteinander verknüpfen. Die entscheidende erste Frage ist dann, was überhaupt eine Disziplin ausmacht. Merkmale, an denen man sich orientieren könnte, wären etwa: ein unterscheidbares Gegenstandsgebiet, ein Korpus von akzeptierten Aussagen und eine spezifische Terminologie, spezifische Fragestellungen, die für dieses Untersuchungsgebiet als relevant und wichtig angesehen werden, akzeptierte leitende Hypothesen und allgemein akzeptierte methodische Instrumentarien und Verfahrensregeln, Kriterien dafür, was als Antwort auf eine Frage gelten kann und was nicht etc. Eine solche inhaltliche Bestimmung von Disziplinarität, wie immer sie ausformuliert werden mag, zeigt: Eine Disziplin ist keineswegs identisch mit einem Schulfach, das immer eine durch Tradition und Willkür bestimmte äussere Lehreinheit darstellt. Eine Disziplin ist aber auch nicht notwendigerweise identisch mit einem akademischen Studiengang oder einem universitären Prüfungsfach. Prüfungsfächer sind häufig selber nur Spezialisierungen innerhalb einer Disziplin, oder, im umgekehrten Fall, eine arbiträre Verbindung verschiedener Disziplinen. Was aber heisst nun Interdisziplinarität auf der Ebene der Inhalte?
Interdisziplinarität auf der Ebene der Inhalte
Interdisziplinarität liegt dann vor, wenn zwei oder mehr Disziplinen miteinander kooperieren, um das ihnen übergeordnete Ziel, den Erkenntnisgewinn, auf diese Weise besser erreichen zu können. Dies kann auf verschiedene Weise geschehen:
Der Phänomen- oder Problembereich erweist sich als zu komplex, als dass er von einer Disziplin allein erschlossen werden könnte. Gefordert ist ein Zusammenwirken verschiedener Disziplinen, die, mit ihrem jeweiligen disziplinären Zugriff, das Problem angehen. Diese Art der Interdisziplinarität wird zumeist als Pluridisziplinarität bezeichnet.
Eine andere Form der Kooperation entsteht, wenn Disziplinen nicht Gegenstandsbereiche, sondern Methoden teilen. Als Beispiel: Die ökonomische Theorie der rationalen Wahl findet Anwendung in der Soziologie, der Politikwissenschaft oder gar in der Biologie.
Wo ursprünglich getrennte Disziplinen Gegenstandsgebiet und Methoden auf Dauer zu teilen beginnen, kann schliesslich eine neue, integrative Disziplin entstehen, wie Biochemie zum Beispiel aus Chemie und Biologie oder Sozialisationstheorie aus Psychologie und Soziologie.
Um Interdisziplinarität ganz anderer Art handelt es sich, wenn eine Disziplin zum Gegenstand einer anderen Disziplin gemacht wird. Prominente Beispiele dafür sind: Wissenschaftsgeschichte, Wissenschaftsphilosophie, Wissenschaftssoziologie. Man kann diese Form der Interdisziplinarität am besten als Metadisziplinarität bezeichnen. Ein nicht uninteressantes Merkmal solcher möglicher Metadisziplinen zeigt sich am Grenzfall: Metadisziplinen können, im Prinzip, immer auch sich selbst zum Gegenstand machen, sie sind, mit einem Wort, reflexiv: Geschichte der Geschichtsschreibung, Philosophie der Philosophie etc.
Mit einer kategorial neuen Art der Interdisziplinarität haben wir es zu tun, wenn das Problem, das in Angriff genommen werden soll, nicht aus der Wissenschaft selber stammt, sondern einen lebensweltlichen Ursprung hat. Probleme dieser Art sind in der Regel nicht Erkenntnisprobleme, sondern Handlungsprobleme: Unser Handeln ist blockiert, eine Diskrepanz entsteht zwischen dem, was sein sollte, und dem, was faktisch ist. Zum Beispiel: Wie kommt man dem Problem des Illetrismus bei? Wie können wir die CO2-Emissionen reduzieren? Die Anfrage ergeht an die für dieses Problem relevanten Wissenschaftsdisziplinen, was sie, aufgrund ihrer bisherigen Erkenntnisse, zu seiner Klärung oder Lösung beitragen können. Diese Form der Interdisziplinarität wird häufig Transdisziplinarität genannt.
Interdisziplinarität im gymnasialen Unterricht und ihre Schwierigkeiten
Soweit die Hauptformen der inhaltlich bestimmten Interdisziplinarität. Welches aber sind die für uns interessanten Formen des Interdisziplinären im Kontext des gymnasialen Unterrichts? Von dem in §5 MAR formulierten Bildungsziel her gesehen, ist die Antwort, meine ich, eindeutig: Die Interdisziplinarität, auf die es letztlich ankommt, ist die Transdisziplinarität: der transdisziplinäre Gebrauch der Disziplinen zur Orientierung der in der Lebenswelt stehenden jungen Menschen in ihrer Lebenswelt: zur Orientierung, Deutung, Erklärung ihrer Welt und als Grundlage von Entscheidungen und Handlungen. Eben darin liegt auch die paradoxe und Ratlosigkeit erzeugende Schwierigkeit des gymnasialen Unterrichts. Orientierung durch Wissenschaft bedeutet zum einen: aus lebensweltlichen Bezügen heraustreten, sich von subjektiver Befangenheit, sozialen Vorurteilen, überkommenen Meinungen und fraglich gewordenen Autoritäten befreien durch Eintritt in die Welt der Wissenschaften und durch das Sich-Disziplinieren-Lassen in den Disziplinen. Es bedeutet aber auf der anderen Seite wiederum: sich am Ende auch von den Disziplinen selber wieder zu befreien, zu ihnen Distanz zu gewinnen, um ihre Voraussetzungshaftigkeit und ihre Grenzen zu sehen und ihre relative Bedeutung für die Lebenswelt abschätzen zu können. Diese Distanz aber ist nicht dadurch zu erreichen, dass man zu sagen weiss, was die Disziplin sagt, sondern dass man Rechenschaft darüber abzulegen weiss, was man eigentlich tut, wenn man diese Disziplin betreibt. Gefragt also ist Reflexion. Diese Reflexion jedoch, wenn sie selber wieder wissenschaftsgestützt sein will, kann nur auf eine Art gewonnen werden: durch Metadisziplinarität, das heisst durch den Blick der reflexiven Disziplinen auf die anderen Disziplinen und auf sich selbst: philosophisch – in Bezug auf Logik, Methodologie und Argumentationsweise der Disziplinen, historisch – bezogen auf das Werden und Entstehen von Wissenschaft, soziologisch – im Hinblick auf den Stellenwert von Wissenschaft in unserer Gesellschaft, und nicht zuletzt eben auch literatur- und sprachwissenschaftlich – in Bezug auf die sprachliche Verfasstheit wissenschaftlicher Texte.
Wie aber steht es mit dieser Reflexion, auf die es so sehr ankäme, im heutigen Gymnasialunterricht? Eine nicht unbegründete Vermutung: Metadisziplinäre Reflexion ist ein seltener Glücksfall. Es gibt dazu keine Unterrichtsgefässe, es fehlen die nötigen Lehrmittel und insbesondere mangelt es an einer auf dieses Bildungsziel hin orientierten Ausbildung der Lehrkräfte. Welche geistes-, sozial- oder literaturwissenschaftlich ausgebildete Lehrperson hat sich schon mit Naturwissenschaften oder den historischen oder philosophischen Grundlagen ihrer eigenen Wissenschaftsdisziplinen befassen müssen, welche Lehrperson der Naturwissenschaften mit einer philosophischen oder geisteswissenschaftlichen Betrachtungsweise ihrer Fächer? In diesem Brachland der gymnasialen Bildung ist jede noch so kleine unterrichtsbezogene Hilfestellung willkommen. Das hier vorliegende Lehrmittel kann für sich beanspruchen, auf exemplarische Weise zu zeigen, wie die postulierte metadisziplinäre Reflexion aussehen könnte. Dass diese Reflexion als Sprachreflexion am Beispiel der Metapher einsetzt, macht ihre besondere Attraktivität aus: Metaphern haben, wie die heute blühende Metaphernforschung beweist, eine Sogkraft, der sich auch Schülerinnen und Schüler nicht leicht werden entziehen können. Das Forschungsteam jedenfalls, das hinter diesem Lehrmittelprojekt steht, hat sich durch den stimulierenden Geist der Metaphern immer wieder beflügeln lassen, und ich kann mir nur wünschen, dass dieser Geist auch viele gymnasiale Klassen ergreifen wird.