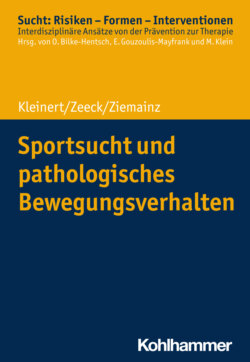Читать книгу Sportsucht und pathologisches Bewegungsverhalten - Jens Kleinert - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2.1 Toleranzentwicklung
ОглавлениеIm Zusammenhang mit Sportsucht wird Toleranzentwicklung damit beschrieben, dass ein zunehmender Umfang an Sport notwendig wird, um gewünschte Effekte zu erreichen oder dass bei gleichbleibendem Umfang Effekte niedriger ausfallen (Hausenblas und Symons Downs 2002a). Der hiermit beschriebene suchtrelevante Mechanismus der »Toleranzentwicklung« ist jedoch bezogen auf den Sport ein normaler Prozess der Leistungsentwicklung. Mit anderen Worten: Ohne eine stetige Steigerung von Trainingsumfängen ist im Sport (insbesondere im Wettkampf- und Leistungssport) eine Steigerung von konditionellen Komponenten (z. B. Kraft, Ausdauerleistung, Beweglichkeit) oder von technisch-taktischen Kompetenzen nicht möglich. Die Steigerung von Trainingsumfängen und/oder Trainingsintensitäten ist daher in normaler und notwendiger Prozess, um neue Trainingsreize zu schaffen und hierdurch Anpassungsprozesse auszulösen (Hottenrott und Neumann 2017). Das Kriterium »Toleranzentwicklung« besitzt daher im Falle der Sportsucht einen zweifelhaften, doppeldeutigen Wert.
Allerdings wäre das Suchtkriterium »Toleranzentwicklung« dann angebracht, wenn der Effekt einer Dosissteigerung (mehr oder intensiverer Sport) nicht an einem Trainings- oder Leistungsziel ausgerichtet ist, sondern auf die Affektregulation (d. h. die Regulation von Spannungszuständen oder einer emotionalen Balance). Das bedeutet, eine suchtrelevante Toleranzentwicklung besteht nur dann, wenn Intensitäten und Umfänge ausschließlich aus Gründen der Psychoregulation gesteigert werden. Toleranzentwicklung dürfte demnach nicht allein an der Steigerung des zeitlichen Aufwands für Sport gemessen werden, sondern an der hiermit verbunden Zwecksetzung.
Unter Berücksichtigung des Zusatzkriteriums »Zwecksetzung« können jedoch Veränderungen von Sportumfängen durchaus wichtige Anzeichen für ein problematisches, vielleicht klinisch relevantes Verhalten sein. Allerdings müssen solche Beobachtungen fachgerecht (d. h. sportwissenschaftlich) interpretiert werden und in den psychosozialen Gesamtkontext des Betroffenen eingeordnet werden. Die fachgerechte Beurteilung betrifft gleichermaßen die Trainingssituation (z. B. extreme muskuläre Veränderungen bei exzessivem Bodybuilding oder extreme Verlängerung von Laufstrecken) als auch die hiermit verknüpften Einstellungs- und Motivstrukturen der Betroffenen (vgl. Bamber et al. 2003).